
The Project Gutenberg EBook of Inferno Legenden, by August Strindberg This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Inferno Legenden Author: August Strindberg Translator: Emil Schering Release Date: June 8, 2014 [EBook #45916] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK INFERNO LEGENDEN *** Produced by Marc D'Hooghe at http://www.freeliterature.org (Images generously made available by the Internet Archive.)

Die grosse Krisis mit fünfzig Jahren Revolutionen
im
Seelenleben, Wüsten-Wandrungen, Verödung,
Swedenborgs
Höllen und Himmel.
Deutsche Original-Ausgabe gleichzeitig
mit der
schwedischen Ausgabe unter Mitwirkung von
Emil
Schering als Übersetzer vom Dichter selbst
veranstaltet.

Strindberg — 1897.
Personen:
DER EWIGE, unsichtbar.
GOTT, der böse Geist, der Usurpator, der Fürst dieser Welt.
LUCIFER, der Lichtbringer, entthront.
Erzengel.
Engel.
Adam und Eva.
Erster Akt
DER HIMMEL
Gott und Lucifer, jeder auf seinem Thron. Sie sind von Engeln umgeben. Gott ist ein Greis, dessen Gesichtsausdruck streng, fast böse ist; er hat einen langen weissen Bart und kleine Hörner, wie der Moses Michelangelos.
Lucifer ist jung und schön, hat etwas von Prometheus, Apollo, Christus; die Farbe des Gesichts ist weiss, leuchtend, die Augen blitzen, die Zähne glänzen; hat einen Heiligenschein über dem Kopf.
GOTT:
Es sei Bewegung, denn die Ruhe hat uns verdorben! Ich will noch eine Offenbarung wagen, auf die Gefahr hin, mich zu zerteilen und in der rohen Menge zu verlieren.
Seht, dort unten zwischen Mars und Venus sind noch einige Myriameter frei in meinem Sonnensystem. Dort will ich eine neue Welt schaffen: aus Nichts soll sie geboren werden, und ins Nichts soll sie einst wieder zurückkehren. Die Geschöpfe, die dort leben werden, sollen sich für Götter halten wie wir, und unsere Freude soll sein, sie kämpfen und prahlen zu sehen. Die Welt der Torheit soll sie darum auch heissen. Was sagt mein Bruder Lucifer, der mit mir die Macht über diese Reiche südlich der Milchstrasse teilt?
LUCIFER:
Herr und Bruder, dein böser Wille heischt Leid und Verderben; ich liebe deinen Gedanken nicht.
GOTT:
Was sagen die Engel zu meinem Vorschlag?
DIE ENGEL:
Der Wille des Herrn geschehe!
GOTT:
Es werde, wie ich gesagt! Und wehe denen, welche die Tröpfe in der Welt der Torheit über ihren Ursprung und ihre Aufgabe aufklären.
LUCIFER:
Wehe denen, die böse gut und gut böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus bitter süss und aus süss bitter machen! Ich lade dich vor das Gericht des Ewigen!
GOTT:
Das warte ich ab! Denn begegnest du dem Ewigen öfter als alle zehn mal zehntausend Jahre, wenn er diese Gebiete besucht?
LUCIFER:
Ich werde den Menschen die Wahrheit sagen, auf dass deine Anschläge zu nichte werden.
GOTT:
Verflucht seist du Lucifer! Und dein Platz sei in der Welt der Torheit, damit du ihre Qualen siehst; und die Toren sollen dich den Bösen nennen!
LUCIFER:
Du wirst siegen, weil du stark bist wie das Böse! Für die Menschen wirst du Gott sein, Du, der Verleumder, der Satan!
GOTT:
Hinunter mit dem Empörer! Vorwärts, Michael, Raphael, Gabriel, Uriel! Stosst: Samael, Azarël, Mehazaël! Blast: Oriens, Paymon, Egyn, Amaimon! (Lucifer wird von einem Wirbelwind erfasst und in die Abgründe gestürzt.)
Zweiter Akt
AUF ERDEN
Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntnis. Dann Lucifer in der Gestalt einer Schlange.
EVA:
Diesen Baum habe ich noch nie gesehen.
ADAM:
Diesen Baum dürfen wir nicht berühren.
EVA:
Wer hat das gesagt?
ADAM:
Gott.
LUCIFER: (erscheint). Welcher Gott? Es gibt mehrere!
ADAM:
Wer spricht da?
LUCIFER:
Ich, Lucifer, der Lichtbringer, der euer Glück wünscht, der unter euren Leiden leidet. Seht den neuen Morgenstern, der die Rückkehr der Sonne verkündet! Das ist mein Stern, und darüber befindet sich ein Spiegel, der das Licht der Wahrheit zurückstrahlt. Wenn die Zeit erfüllt ist, wird der Stern aus einer Wüste Hirten an eine Krippe führen, in der mein Sohn geboren werden wird, der Erlöser der Welt.
Sobald ihr von diesem Baum esset, werdet ihr wissen, was gut und was böse ist. Ihr werdet wissen, dass das Leben ein Übel ist, dass ihr keine Götter seit, dass der Böse euch mit Blindheit geschlagen hat, dass euer Dasein sich nur abrollt, um die Götter zum Lachen zu bringen. Esset davon und ihr werdet die Befreiung von den Schmerzen, die Freude des Todes, besitzen!
EVA:
Ich möchte wissen und befreit werden! Iss auch, Adam. (Sie essen die verbotene Frucht.)
Dritter Akt
DER HIMMEL
Gott und Uriel.
URIEL:
Wehe uns, unsere Freude ist aus.
GOTT:
Was ist geschehen?
URIEL:
Lucifer hat den Bewohnern der Erde unsere Handlungsweise enthüllt; sie wissen alles und sind glücklich.
GOTT:
Glücklich! Wehe uns!
URIEL:
Noch mehr, er hat ihnen das Geschenk der Befreiung gegeben: sie können also ins Nichts zurückkehren.
GOTT:
Sterben!... Gut! Dann sollen sie sich vermehren, ehe sie sterben. Es werde die Liebe!
Vierter Akt
IN DER HÖLLE
LUCIFER:
(gebunden). Seit die Liebe in die Welt gekommen ist, ist meine Macht tot. Abel wurde durch Kain befreit, aber erst, nachdem er sich mit seiner Schwester fortgepflanzt hatte. Ich will euch alle befreien! Wasser, Meere, Quellen, Flüsse, ihr wisst die Flamme des Lebens zu erlöschen, steigt! vernichtet!
Fünfter Akt
DER HIMMEL
Gott und Uriel.
URIEL:
Wehe uns, unsere Freude ist aus.
GOTT:
Was ist geschehen?
URIEL:
Lucifer hat auf das Wasser geblasen: es steigt und befreit die Sterblichen!
GOTT:
Ich weiss! Aber ich habe ein Paar von den am wenigsten Aufgeklärten gerettet, das niemals das Wort des Rätsels erfahren wird. Die Arche der beiden ist schon auf dem Berg zwischen den drei Wassern gelandet, und sie haben Dankopfer dargebracht.
URIEL:
Aber Lucifer hat ihnen eine Pflanze gegeben, die sie Weinrebe nennen und deren Säfte die Torheit heilt. Ein Trunk Wein, und sie werden sehend.
GOTT:
Die Vorwitzigen! Sie wissen nicht, dass ich ihre Pflanze mit seltsamen Tugenden begabt habe: Wahnsinn, Schlaf, Vergessen. Sie werden nicht mehr wissen, was ihre Augen gesehen haben.
URIEL:
Wehe uns! Was machen sie dort unten, die törichten Bewohner der Erde?
Sie bauen einen Turm. Sie wollen den Himmel stürmen. Lucifer hat sie fragen gelehrt. Gut! Ich werde ihre Zungen berühren, dass sie Fragen fragen, ohne Antwort zu erhalten; und mein Bruder Lucifer verstumme.
Sechster Akt
DER HIMMEL
Gott und Uriel.
URIEL:
Wehe uns, Lucifer hat seinen Sohn gesandt, der den Menschen die Wahrheit lehrt....
GOTT:
Was sagt er?
URIEL:
Geboren von einer Jungfrau, will dieser Sohn gekommen sein, um die Menschen zu befreien, und durch seinen eigenen Tod will er den Schrecken des Todes aufheben.
GOTT:
Was sagen die Menschen?
URIEL:
Die einen sagen, der Sohn sei Gott, die andern, er sein der Teufel.
GOTT:
Was verstehen sie unter dem Teufel?
URIEL:
Lucifer!
GOTT:
(zornig). Mich reut, den Menschen auf Erden geschaffen zu haben; er ist stärker geworden als ich, und ich weiss nicht mehr, wie ich diese Menge von Toren und Dummen lenken soll. Amaimon, Egyn, Paymon, Oriens, nehmt mir diese Last ab; stürzt den Ball in die Abgründe. Fluch auf das Haupt der Rebellen! Pflanzt auf der Stirn des verwünschten Planeten den Galgen auf, das Zeichen des Verbrechens, der Züchtigung und des Leidens.
(Egyn und Amaimon erscheinen.)
EGYN:
Herr! Euer grausamer Wille und das ausgesprochene Wort haben ihre Wirkung getan! Die Erde stürmt auf ihrer Bahn dahin; die Berge stürzen ein, die Wasser überschwemmen das Land; die Achse zielt nach Norden; Kälte und Finsternis, Pest und Hunger verheeren die Völker; die Liebe ist in tödlichen Hass verwandelt, die kindliche Ehrerbietung in Elternmord. Die Menschen glauben in der Hölle zu sein, und Ihr, Herr, Ihr seid entthront!
GOTT:
Zu Hilfe! Ich bereue meine Reue!
AMAIMON:
Zu spät! Alles geht seinen Gang, seit Ihr die Kräfte entfesselt habt....
GOTT:
Ich bereue! Ich habe Funken meiner Seele in unreine Geschöpfe gelegt, deren Hurerei mich erniedrigt, wie die Gattin ihren Gatten besudelt, wenn sie ihren Körper besudelt.
EGYN (zu Amaimon):
Der Alte redet irre!
GOTT:
Meine Tatkraft erschöpft sich, wenn sie sich von mir entfernen; ihre Verderbnis ergreift mich; die Torheit meiner Nachkommenschaft steckt mich an. Was habe ich begangen, Ewiger? Habe Erbarmen mit mir! Weil er den Fluch geliebt hat, falle der Fluch auf ihn zurück; und weil er kein Wohlgefallen am Segen gehabt hat, weiche der Segen von ihm.
EGYN:
Welcher Wahnsinn!
GOTT:
(wirft sich nieder). Herr, Ewiger, es gibt unter den Göttern keinen, der dir ähnlich ist! Deine Werke sind unvergleichlich. Denn du bist gross und du tust Wunder; und du allein bist Gott, du allein!
AMAIMON:
Wahnsinn!
EGYN:
Das ist der Lauf der Welt: wenn die Götter sich vergnügen, die Sterblichen sie drum betrügen!...
Motto
Beuge dein Haupt, stolzer Recke
Bete an, was du verbrannt hast;
Verbrenne, was du angebetet hast!
Und will mein Angesicht wider ihn setzen
und ihn mit Schauder schlagen,
dass er zum Zeichen und Sprichwort wird.
Hesekiel 14,8.
Unter welchen ist Hymenäus und Alexander,
welche ich habe dem Satan übergeben,
dass sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern.
1. Timotheus I,20.
Mit einem Gefühl wilder Freude kehrte ich vom Nordbahnhof zurück, wo ich meine liebe Frau verlassen hatte; sie fuhr zu unserm Kind, das in fernem Land erkrankt war. Vollbracht war also das Opfer meines Herzens! Die letzten Worte: "Wann sehen wir uns wieder?—Bald!" klangen mir noch im Ohr, wie Lügen, die man sich nicht eingestehen will; eine Ahnung sagte mir: "Niemals!" Und wirklich, diese Abschiedsworte, die wir in November 1894 wechselten, waren unsere letzten, denn bis zu diesem Augenblick, im Mai 1897, habe ich meine geliebte Gattin nicht wiedergesehen.
Als ich ins Café de la Régence kam, setzte ich mich an den Tisch, an dem ich mit meiner Frau zu sitzen pflegte, meiner schönen Gefangenenwärterin, die Tag und Nacht meine Seele belauerte, meine geheimen Gedanken ahnte, den Flug meiner Ideen bewachte, auf mein Forschen im Unbekannten eifersüchtig war....
Durch die wiedergewonnene Freiheit dehnt sich mein Ich aus und ich werde hinausgehoben über die kleinen Sorgen der grossen Stadt. Auf diesem Schauplatz geistiger Kämpfe hatte ich eben einen Sieg davongetragen, der an sich wertlos, für mich aber über die Massen gross war, da er die Erfüllung meines Jugendtraumes ausmachte, von allen meinen Landsleuten geträumt, aber allein von mir verwirklicht: auf einer Pariser Bühne gespielt zu sein. Das Theater stiess mich ab, wie alles, was man erreicht hat, und die Wissenschaft zog mich an. Zwischen Liebe und Wissen wählen müssend, hatte ich mich dafür entschieden, nach der höchsten Erkenntnis zu streben; und da ich selber meine Liebe opferte, vergass ich das unschuldige Opfer, das ich meinem Ehrgeiz oder meinem Beruf brachte.
Sobald ich in mein schlechtes Studentenzimmer im lateinischen Viertel zurückkehre, durchsuche ich meinen Koffer und ziehe aus ihrem Versteck sechs Tiegel aus feinem Porzellan hervor; die habe ich längst gekauft, obwohl sie mir für meine Verhältnisse zu teuer waren. Eine Zange und ein Paket reinen Schwefels vollenden die Einrichtung des Laboratoriums.
Ein Schmelzofenfeuer ist im Kamin angezündet, die Tür geschlossen und die Vorhänge heruntergelassen; denn drei Monate nach der Hinrichtung Caserios ist es nicht klug, in Paris chemische Werkzeuge in die Hand zu nehmen.
Die Nacht sinkt herab, der Schwefel brennt wie höllische Flammen, und gegen Morgen habe ich Kohlenstoff in diesem für ein Element gehaltenen Körper festgestellt. Damit glaube ich das grosse Problem gelöst, die herrschende Chemie gestürzt und die Sterblichen vergönnte Unsterblichkeit erworben zu haben.
Aber die Haut meiner Hände, die von dem starken Feuer fast gebraten ist, schält sich in Schuppen ab, und der Schmerz, den ich beim Auskleiden an den Händen leide, zeigt mir, welchen Preis ich für meinen Sieg gezahlt habe. Doch als ich allein im Bette liege, das noch nach der Frau duftet, fühle ich mich selig. Ein Gefühl seelischer Reinheit, männlicher Jungfräulichkeit empfindet das vergangene Eheleben als etwas Unreines; und ich bedaure nur, niemand zu haben, dem ich für meine Befreiung aus seinen schmutzigen, nun ohne viel Worte zerrissenen Fesseln danken könnte. Ich bin nämlich im Lauf der Jahre Atheist geworden, da die unbekannten Mächte die Welt sich selber überlassen haben, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben.
Jemand, dem ich danken könnte! Es ist niemand da, und meine mir aufgedrängte Undankbarkeit bedrückt mich!
Auf meine Entdeckung eifersüchtig, tue ich keine Schritte, um sie bekannt zu machen. In meiner Schüchternheit wende ich mich weder an Autoritäten noch an Akademien. Während ich meine Experimente fortsetze, verschlimmern sich meine aufgesprungenen Hände, die Schrunden brechen auf und füllen sich mit Kohlenstaub; das Blut sickert hervor und die Schmerzen werden so unerträglich, dass ich nichts mehr anfassen kann. Diese Qualen, die mich rasend machen, möchte ich den unbekannten Mächten zuschreiben, die mich seit Jahren verfolgen und meine Anstrengungen vereiteln. Ich meide die Menschen, versäume die Gesellschaften, lehne Einladungen ab, entfremde mich den Freunden. Schweigen und Einsamkeit breiten sich um mich. Es ist die feierliche und furchtbare Stille der Wüste, in der ich aus Trotz den Unbekannte herausfordere, um mit ihm zu ringen Leib an Leib, Seele an Seele.
Dass der Schwefel Kohlenstoff enthält, habe ich nachgewiesen; jetzt will ich Wasserstoff und Sauerstoff entdecken, denn die müssen ebenfalls darin vorhanden sein. Doch meine Apparate reichen dazu nicht, mir fehlt Geld, meine Hände sind schwarz und blutend, schwarz wie das Elend, blutig wie mein Herz. Denn während dieser Zeit stand ich im Briefwechsel mit meiner Frau. Ich erzählte ihr von meinen Erfolgen in der Chemie; sie antwortet mit Berichten über die Krankheit unseres Kindes, in die sie hier und dort einstreut, dass meine Wissenschaft eitel sei, und dass es töricht sei, dafür Geld fortzuwerfen.
In einer Anwandlung gerechten Stolzes, in dem leidenschaftliches Verlangen, mir selber ein Leid anzutun, begehe ich den Selbstmord, in einem nichtswürdigen, unverzeihlichen Briefe Weib und Kind von mir zu stossen, indem ich zu verstehen gebe, dass ein neues Liebesverhältnis meine Gedanken beschäftige.
Der Hieb sitzt. Meine Frau antwortet mit einer Klage auf Scheidung.
Allein, des Selbstmordes und Meuchelmordes schuldig, vergesse ich das Verbrechen über den Kummer und die Sorgen. Niemand besucht mich, und ich kann niemand sehen, da ich alle gekränkt habe.
Über die Fläche eines Meeres treibe ich allein dahin; den Anker habe ich gelichtet, doch ich habe keine Segel.
Aber die Not, in der Form einer unbezahlten Rechnung, unterbricht meine wissenschaftlichen Arbeiten und meine metaphysischen Spekulationen und ruft mich auf die Erde zurück.
Weihnachten nähert sich. Die Einladung einer skandinavischen Familie, deren Atmosphäre mir wegen ihrer peinlichen Unregelmässigkeiten missfällt, habe ich schroff abgelehnt. Als aber der Abend da ist und ich allein bin, reut es mich und ich gehe doch hin.
Man setzt sich zu Tisch, und das Nachtmahl beginnt mit grossem Lärm und ausgelassener Freude, denn die jungen Künstler fühlen sich hier wie zu Hause. Eine mich abstossende Vertraulichkeit der Gebärden und Mienen, ein Ton, der nicht nach Familie klingt, drückt mich in einer Weise nieder, wie ich sie nicht beschreiben kann. Mitten in den Saturnalien lässt meine Traurigkeit vor meinem Innern das friedliche Haus meiner Frau erscheinen. Der Salon ruft eine plötzliche Vision in mir hervor: der Weihnachtsbaum, die Mistel, mein Töchterchen, ihre verlassene Mutter.... Gewissensqual packt mich; ich stehe auf, schütze ein Unwohlsein vor und gehe.
Ich gehe die schreckliche Rue de la Gaieté hinunter, auf der die gekünstelte Fröhlichkeit der Menge mich verletzt; dann die düstere und stille Rue Delambre, die mehr als eine andere Strasse des Viertels einen zur Verzweiflung bringen kann. Ich biege in den Boulevard Montparnasse ein und lasse mich auf der Terrasse der Brasserie de Lilas auf einen Stuhl fallen.
Ein guter Absinth tröstet mich einige Minuten lang. Dann überfällt mich eine Bande Kokotten und Studenten, die mich mit Ruten ins Gesicht schlagen. Wie von Furien gejagt, lasse ich meinen Absinth stehen und beeile mich einen andern zu suchen, im Café François Premier, auf dem Boulevard Saint-Michel.
Von der Asche ins Feuer! Ein zweiter Trupp schreit mich an: Heda, der Einsiedler! Von den Eumeniden gepeitscht, fliehe ich nach Haus, geleitet von den entnervenden Fanfaren der Zwiebelflöten.
Der Gedanke, dass es eine Züchtigung sein könne, die Folge eines Verbrechens, kommt mir nicht. Vor mir selber fühle ich mich unschuldig, halte mich für den Gegenstand einer ungerechten Verfolgung. Die unbekannten Mächte haben mich gehindert, mein grosses Werk fortzusetzen; die Hindernisse mussten durchbrochen werden, ehe ich die Krone des Siegers davontragen konnte.
Ich habe unrecht gehabt, und zugleich habe ich recht und werde recht behalten!
Diese Weihnacht schlief ich schlecht. Ein kalter Luftzug schnitt mehrere Male mein Gesicht, und von Zeit zu Zeit weckte mich der Ton einer Maultrommel.
Eine zunehmende Hinfälligkeit kommt über mich. Meine schwarzen und blutenden Hände hindern mich daran mich anzukleiden und mein Äusseres zu pflegen. Die Furcht vor der Hotelrechnung lässt mir keine Ruhe mehr, und ich gehe in meinem Zimmer hin und her, wie ein wildes Tier in seinem Käfig.
Ich esse nicht mehr, und der Wirt rät mir, ins Krankenhaus zu gehen. Damit ist mir nicht geholfen, denn es ist teuer, auch muss man vorher bezahlen.
Da macht sich eine Anschwellung der Armadern bemerkbar, das ist das Zeichen für eine Blutvergiftung. Das ist der Gnadenstoss.
Die Neuigkeit verbreitet sich unter meinen Landsleuten und eines Abends kommt die barmherzige Frau, von deren Weihnachtsessen ich so brüsk aufgebrochen, die mir antipathisch war, die ich beinahe verachtete, sucht mich auf, erkundigt sich nach meinem Befinden, erfährt mein Elend und bezeichnet mir unter Tränen das Krankenhaus als einzige Rettung.
Man wird begreifen, wie hilflos und zerknirscht ich dastehe, als mein beredtes Schweigen ihr klar macht, dass ich ohne Mittel bin. Als sie mich so gefallen sieht, wird sie von Mitleid erfasst. Selber arm und von der Sorge ums tägliche Leben bedrückt, will sie in der skandinavischen Kolonie Almosen sammeln und zum Geistlichen der Gemeinde gehen.
Die sündige Frau hat Erbarmen mit dem Mann, der eben sein rechtmässiges Weib verlassen hat.
Noch einmal Bettler, durch die Vermittlung einer Frau um Barmherzigkeit bittend, beginne ich zu ahnen, dass es eine unsichtbare Hand gibt, welche die unwiderstehliche Logik der Ereignisse lenkt. Ich beuge mich unter dem Sturm, entschlossen, mich bei der ersten Gelegenheit wieder zu erheben.
Der Wagen bringt mich nach dem Krankenhaus des heiligen Ludwig. Unterwegs, in der Rue de Rennes, steige ich aus, um zwei weisse Hemden zu kaufen.
—Das Totenhemd für die letzte Stunde.
Ich denke wirklich an den nahen Tod, ohne dass ich sagen kann, warum.
Im Krankenhaus wird mir verboten, ohne Erlaubnis auszugehen; dazu sind meine Hände so umwickelt, dass mir jede Beschäftigung unmöglich wird; ich fühle mich daher als Gefangener.
Mein Zimmer ist abstrakt, nackt, enthält nur das Nötigste, zeigt keine Spur von Schönheit; es liegt neben dem Gesellschaftssaal, wo man vom Morgen bis zum Abend raucht und Karten spielt.
Es läutet zum Frühstück. Als ich mich zu Tisch setze, finde ich mich in einer furchtbaren Gesellschaft. Köpfe von Toten und Sterbenden: hier fehlt die Nase, dort ein Auge; dort hängt die Lippe herab, hier ist die Wange angefault. Zwei sehen nicht krank aus, zeigen dafür aber in ihrem Gesicht Gram und Verzweiflung. Das sind grosse Diebe der feinen Gesellschaft, die infolge mächtiger Verbindungen als "Kranke" dem Gefängnis entronnen sind.
Ein widerwärtiger Geruch nach Jodoform nimmt mir den Appetit. Und da meine Hände gebunden sind, muss ich beim Brotschneiden und Einschenken die Hilfe meiner Nachbarn in Anspruch nehmen. Um dieses Gastmahl der Verbrecher und zum Tode Verurteilten geht die grosse Mutter, die Vorsteherin, mit ihrer ernsten Tracht in schwarz und weiss und gibt einem jeden von uns seine giftige Arznei. Mit einem Arsenikbecher trinke ich einem Totenkopf zu, der mir mit Digitalin nachkommt. Das ist grausig, und dabei muss man noch dankbar sein: das macht mich rasend! Für etwas so Geringes und Unangenehmes auch noch dankbar sein zu müssen!
Man kleidet mich an, man kleidet mich aus, man pflegt mich wie ein Kind, die barmherzige Schwester fasst Zuneigung zu mir, behandelt mich wie ein Baby, nennt mich "mein Kind", während ich "meine Mutter" zu ihr sage.
Wie wohl tut es, dieses Wort Mutter aussprechen zu können, das seit dreissig Jahren nicht mehr über meine Lippen gekommen ist! Die Alte, eine Augustinerin, die das Kleid der Toten trägt, weil sie nie das Leben gelebt hat, ist sanft wie die Resignation und lehrt uns, über unsere Leiden wie über ebenso viele Freuden lächeln, denn sie kennt die Wohltaten des Schmerzes. Nicht ein Wort des Vorwurfs, weder Ermahnungen noch Predigten.
Sie kennt die Bestimmungen der weltlich gemachten Krankenhäuser so gut, dass sie den Kranken, nicht sich selber, kleine Freiheiten gewähren kann. So erlaubt sie mir, in meinem Zimmer zu rauchen, und erbietet sich, selber mir Zigaretten zu drehen; das lehne ich jedoch ab. Sie verschafft mir die Erlaubnis, ausser den gewöhnlichen Stunden auszugehen. Als sie entdeckt, dass ich mich mit Chemie beschäftige, führt sie mich bei dem gelehrten Apotheker des Krankenhauses ein. Der leiht mir Bücher und fordert mich, als ich ihm meine Lehre von der Zusammensetzung der einfachen Körper darlege, auf, in seinem Laboratorium zu arbeiten. Diese Nonne hat eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich fange an, mich mit meinem Los wieder auszusöhnen und preise das gute Unglück, das mich unter dieses gesegnete Dach geführt hat.
Das erste Buch, das ich mir aus der Bibliothek des Apothekers hole, öffnet sich von selbst, und mein Blick schiesst wie ein Falke auf eine Zeile des Kapitels: Phosphor.
In zwei Worten erzählt der Autor, der Chemiker Lockyer habe durch die Spektralanalyse gezeigt, dass der Phosphor kein einfacher Körper ist; Lockyers Bericht über seine Versuche sei der Pariser Akademie der Wissenschaften vorgelegt worden, die den Tatbestand nicht habe leugnen können.
Durch diesen unerwarteten Beistand gestärkt, nehme ich meine Tiegel mit den Rückstanden des nicht völlig verbrannten Schwefels und übergebe sie einem Bureau für chemische Analysen, das mir den Schein für den nächsten Morgen verspricht.
Es war mein Geburtstag. Als ich ins Krankenhaus zurückkehre, finde ich einen Brief von meiner Frau. Sie beweint mein Unglück, will sich wieder mit mir vereinigen, mich pflegen, mich lieben.
Das Glück, trotz allem geliebt zu sein, erzeugt in mir das Bedürfnis zu danken. Aber wem! Dem Unbekannten, der sich so viele Jahre verborgen hatte?
Das Herz schlägt mir, ich bekenne die nichtswürdige Lüge über meine angebliche Untreue, ich bitte um Verzeihung, und ehe ich mich dessen versehe, schreibe ich wieder einen Liebesbrief an meine Ehegattin. Doch verschiebe ich unsere Wiedervereinigung auf einen günstigeren Zeitpunkt.
Am nächsten Morgen eile ich zu meinem Chemiker nach dem Boulevard Magenta.
Im geschlossenen Umschlag bringe ich den Schein der Analyse ins Krankenhaus. Als ich auf dem innern Hof am Standbild des heiligen Ludwig vorbeigehe, erinnere ich mich an die drei Werke des Heiligen: die Blindenanstalt, die Universität, die Kapelle; die kann man übersetzen: "Vom Leiden durch Wissen zur Busse."
In meinem Zimmer eingeschlossen, öffne ich den Umschlag, der meine Zukunft entscheiden soll. Ich lese:
"Das uns zur Untersuchung übergebene Pulver zeigt diese Eigenschaften. Farbe: grauschwarz; hinterlässt Spuren auf Papier. Dichtigkeit: sehr gross, grösser als die mittlere Dichtigkeit des Graphit; es scheint ein harter Graphit zu sein. Chemische Untersuchung: dieses Pulver brennt leicht und entwickelt dabei Kohlenoxyd und Kohlensäure; es enthält also Kohle."
Reiner Schwefel enthält Kohle!
Ich bin gerettet. Ich kann in Zukunft meinen Freunden und Verwandten beweisen, dass ich kein Tor bin. Bestätigt sind die Lehren, die ich in meiner Arbeit "Antibarbarus" aussprach. Als ich die vor einem Jahr veröffentlichte, behandelte die Presse sie wie das Werk eines Charlatans oder Toren, und meine Familie jagte mich davon als Taugenichts, als ein Cagliostro.
Jetzt, meine Gegner, seid ihr zu Boden geschlagen! Mein Ich schwillt von gerechtem Stolz, ich will das Krankenhaus verlassen, auf den Strassen schreien, vor dem Institut brüllen, die Universität niederreissen ... aber meine Hände sind mir gebunden, und als ich auf den Hof hinauskomme, rät mir die hohe Einfriedung: Geduld.
Als ich dem Apotheker das Ergebnis der Analyse mitteile, schlägt er mir vor, eine Kommission zusammenzubringen, vor der ich meine Behauptung durch versuche beweise.
Da ich aber nicht warten will und meine Scheu vor öffentlichen Auftritten kenne, schreibe ich einen Aufsatz über den Gegenstand und schicke den an die Temps.
Nach zwei Tagen erscheint der Artikel.
Die Losung ist gegeben. Man antwortet mir von verschiedenen Seiten, ohne die Tatsache zu leugnen. Ich habe Anhänger gefunden, ich bin Mitarbeiter einer chemischen Zeitschrift geworden, beginne einen Briefwechsel, der meine weiteren Untersuchungen fördert.
An einem Sonntag, dem letzten, den ich im Fegefeuer des heiligen Ludwig verbringe, sitze ich am Fenster und beobachte, was auf dem Hof vorgeht. Die beiden Diebe gehen mit ihren Frauen und ihren Kindern spazieren, küssen sie von Zeit zu Zeit und sehen glücklich aus, wie sie sich an der Liebe wärmen, die das Unglück schürt.
Meine Einsamkeit bedrückt mich, und ich verwünsche mein Schicksal, das ich ungerecht finde, indem ich vergesse, dass mein Verbrechen ihre an Nichtswürdigkeit übertrifft.
Der Briefträger bringt einen Brief von meiner Frau. Der Brief ist von eisiger Kälte. Mein Erfolg hat sie verletzt, und sie gibt vor, ihr Zweifel stütze sich auf die Ansicht eines Chemikers von Fach. Dann fügt sie hinzu, Illusionen seien gefährlich und könnten zu Gehirnkrisen führen. Übrigens, was erreichte ich mit all dem? Könnte ich mit der Chemie eine Familie ernähren?...
Noch einmal die Alternative: Liebe oder Wissenschaft! Ohne zu zögern, schlage ich sie mit einem letzten Abschiedsbrief zu Boden, mit mir zufrieden, wie ein Mörder, der seinen Anschlag ausgeführt hat.
Am Abend gehe ich in dem düsteren Viertel spazieren. Ich überschreite den St. Martins-Kanal, der schwarz wie ein Grab ist und eigens dazu gemacht zu sein scheint, damit man sich darin ertränkt. Ich bleibe an der Ecke der Rue Alibert stehen. Warum Alibert? Wer ist das? Hiess nicht der Graphit, den der Chemiker in meinem Schwefel fand, Alibert-Graphit? Was folgt daraus? Es ist eine Grille, aber der Eindruck von etwas unerklärlichem bleibt mir. Dann Rue Dieu. Warum Gott, wenn er von der Republik abgeschafft ist? Hat sie doch das Pantheon seiner ursprünglichen Bestimmung entzogen!—Rue Beaurepaire. Ein "schöner Aufenthalt" für Missetäter ... Rue de Bondy. Führt mich der Dämon? ... Ich lese die Strassennamen nicht mehr, gehe irre, kehre um auf meinen Spuren, ohne jedoch den Weg wiederzufinden. Ich fahre vor einem ungeheuren Schuppen zurück, der nach rohem Fleisch und verfaultem Gemüse, besonders nach Sauerkraut, stinkt.... Verdächtige Gestalten streifen an mir vorbei und lassen grobe Worte fallen.... Ich habe Furcht vor dem Unbekannten; wende mich rechts, dann links und gerate in eine schmutzige Sackgasse, wo Unrat, Laster und Verbrechen zu hausen scheinen. Dirnen versperren mir den Weg, Strassenjungen lachen mich aus.... Die Szene der Weihnacht wiederholt sich: Vae soli!
Wer legt mir diesen Hinterhalt, sobald ich mich von der Welt und Menschen trenne? Irgendjemand hat mich in diese Falle gehen lassen! Wo ist er? Dass ich mit ihm kämpfe!...
Ein mit schmutzigem Schnee gemischter Regen fällt, gerade wie ich zu laufen anfange.... Im Hintergrund einer kleinen Strasse zeichnet sich vom Himmelsgewölbe in Russschwarz ein ungeheures Tor ab, ein Werk von Cyklopen, ein Tor ohne Palast dahinter, das sich auf ein Meer von Licht öffnet....
Ich frage einen Polizisten, wo ich bin.
—Am St. Martins-Tor, mein Herr.
Zwei Schritte führen mich auf die grossen Boulevards, die ich hinuntergehe. Die Uhr des Theaters zeigt sechs ein Viertel. Es ist gerade die Absinthstunde, und meine Freunde erwarten mich aus Gewohnheit im Café Napolitain. Ich gehe eilig weiter und vergesse Krankenhaus, Kummer und Armut. Als ich aber am Café du Cardinal vorbeikomme stosse ich an einen Tisch, hinter dem ein Herr sitzt. Ich kenne ihn nur dem Namen nach, aber er kennt mich, und in einer Sekunde sagen mir seine Augen:
—Sie hier? Sie sind also nicht im Krankenhaus? Schwindel das Liebeswerk!
Ich fühle, dass dieser Mann einer meiner unbekannten Wohltäter ist, dass er mir Almosen gegeben hat, dass ich für ihn ein Bettler bin, der nicht das Recht hat, ins Café zu gehen.
Bettler! Das ist das rechte Wort, das mir in den Ohren klingt und mir die brennende Röte der Scham, der Demütigung, der Wut in die Wangen treibt.
Vor sechs Wochen sass ich hier; mein Theaterdirektor liess sich von mir einladen und nannte mich "lieber Meister", die Journalisten baten mich um Interviews; der Photograph bat mich um die Ehre, meine Bilder verkaufen zu dürfen.... Und jetzt: Bettler, gebrandmarkt, aus der Gesellschaft verbannt!
Gestäupt, gehetzt, zum äussersten getrieben, streife ich den Boulevard hinunter wie ein Nachtschwärmer und ziehe mich zurück in meinen Zufluchtsort bei den Pestkranken. Dort, im meinem Zimmer eingeschlossen, bin ich zu Hause.
Wenn ich über mein Schicksal nachdenke, erkenne ich wieder die unsichtbare Hand, die mich straft und mich auf ein Ziel hintreibt, das ich noch nicht ahne. Sie gibt mir den Ruhm, während sie mir zugleich die Ehren der Welt verweigert; sie demütigt mich, indem sie mich erhöht; sie erniedrigt mich, um mich zu erheben.
Wieder kommt mir der Gedanke, die Vorsehung habe mich zu einer Mission bestimmt, und dies sei der Anfang meiner Erziehung.
Im Februar verlasse ich das Krankenhaus, nicht geheilt, aber genesen von den Versuchungen dieser Welt. Als ich ging, habe ich die Hand der guten Mutter, die mir, ohne zu predigen, den Weg des Kreuzes gezeigt hat, küssen wollen, aber ein Gefühl der Ehrfurcht, wie vor etwas Heiligem hat mich zurückgehalten.
Möge sie nun im Geist diese Danksagung eines verirrten Fremdlings empfangen, der sich jetzt in einem fernen Lande verborgen hat.
In einem bescheidenen möblierten Zimmer, das ich mir gemietet habe, setze ich den ganzen Winter hindurch meine chemischen Arbeiten fort. Bis gegen Abend bleibe ich zu Hause, dann gehe ich aus, um in einer Cremerie, wo Künstler aus verschiedenen Länder einen Kreis gebildet haben, zu Mittag zu essen. Nach dem Essen besuche ich die Familie, die ich in einem Augenblick der Sittenstrenge verlassen hatte. Die ganze Gesellschaft von anarchistischen Künstlern ist dort, und ich bin zu ertragen verurteilt, was ich hatte vermeiden wollen: leichte Sitten, lockere Moral, absichtliche Gottlosigkeit. Aber sie haben viel Talent und sehr viel Geist; ein einziger hat Genie, ein wildes Genie, das sich einen Namen gemacht hat.
Jedenfalls ist es eine Familie, in der man mich liebt, und ich bin ihnen Dank schuldig; daher mache ich mich blind und taub gegen alles, was zu ihren kleinen Angelegenheiten gehört und mich nichts angeht.
Wenn ich diese Leute aus einem nicht gerechtfertigten Stolz geflohen hätte, so wäre die Strafe logisch gewesen; da aber der Grund meiner Flucht die Sehnsucht war, meine Persönlichkeit zu läutern und meine Seele zu bebauen, indem ich mich in der Einsamkeit sammelte, begreife ich in diesem Fall die Methode der Vorsehung nicht; ich bin nämlich von so weichem Charakter, dass ich mich aus reiner Umgänglichkeit und aus Furcht, undankbar zu sein, der Umgebung anpasse.
Durch meine klägliche und anstössige Armut aus der Gesellschaft verbannt, war ich glücklich, für die langen Winterabende eine Zuflucht zu finden, wenn ich auch unter der schlüpfrigen Unterhaltung sehr litt.
Nachdem ich entdeckt habe, dass die unsichtbare Hand meine Schritte auf dem holperigen Wege lenkt, fühle ich mich nicht mehr einsam, und ich beobachte mich streng in Handlungen und Worten, wenn es mir auch nicht immer gelingt. Sobald ich aber gesündigt habe, ertappt mich jemand auf frischer Tat, und die Strafe stellt sich mit einer Pünktlichkeit und einer Spitzfindigkeit ein, die keine Zweifel lassen, dass hier eine Macht eingreift, die verbessern will. Der Unbekannte ist mir eine persönliche Bekanntschaft geworden: ich spreche zu ihm, ich danke ihm, ich frage ihn um Rat. Manchmal stelle ich mir ihn als meinen Diener vor, dem Daimon des Sokrates ähnlich, und das Bewusstsein, durch den Unbekannten unterstützt zu werden, gibt mir eine Energie und eine Sicherheit, dass ich eine Kraft zeige, die ich mir nie zugetraut hätte.
Mit den Menschen zerfallen, werde ich in einer anderen Welt wiedergeboren, in die mir niemand folgen kann. Nichtssagende Geschehnisse ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich; die Träume der Nacht kleiden sich in die Form von Vorahnungen; ich denke, ich bin gestorben und mein Leben verläuft in einer anderen Sphäre.
Nachdem ich nachgewiesen habe, dass Schwefel Kohlenstoff enthält, habe ich noch Wasserstoff und Sauerstoff zu entdecken, auf die aus Analogie geschlossen werden kann.
Zwei Monate vergehen unter Berechnungen und Grübeleien, aber ich habe nicht die nötigen Werkzeuge, um Versuche zu machen. Ein Freund rät mir, in das Laboratorium der Sorbonne zu gehen, das auch Fremden offen steht. Da ich scheu bin und die Menge fürchte, wage ich nicht, mich dazu zu entschliessen. So stehen meine Arbeiten still, und ein Augenblick der Abspannung tritt ein.
An einem schönen Frühlingsmorgen erhebe ich mich bei guter Laune, gehe die Rue de la Grande Chaumière hinunter und komme in die Rue de Fleurus, die sich auf den Luxemburg-Garten öffnet. Die hübsche kleine Strasse ist ruhig, die grosse Kastanienallee ist grün, leuchtend, breit und gerade wie eine Rennbahn, und ganz im Hintergrund erhebt sich wie ein Grenzstein die David-Säule, und in der Ferne, über allem, die Kuppel des Pantheon, dessen goldenes Kreuz sich fast in den Wolken verliert.
Über das symbolische Schauspiel entzückt, bleibe ich stehen. Als ich aber die Augen abwende, bemerke ich zu meiner Rechten in der Fleurusstrasse das Schild eines Färbers. Ah! eine Vision von unleugbarer Wirklichkeit. Auf das Schaufenster des Ladens sind die Anfangsbuchstaben meines Namens gemalt: A. S. Sie schweben auf einer silberweissen Wolke, und über ihnen wölbt sich ein Regenbogen.
Ich nehme das Omen an, indem ich mich an die Genesis erinnere: "Meinen Bogen habe ich in die Wolke gesetzt, und er soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und er Erde."
Ich berühre den Boden nicht mehr, mit beflügeltem Schritt trete ich in den Garen ein, in dem sich niemand aufhält. Zu dieser frühen Stunde gehört der Park mir, gehört mir der Rosengarten, und ich besuche alle meine Blumen auf den langen, schmalen Beeten, die Chrysanthemen, die Verbenen, die Begonien.
Ich komme über die Rennbahn, erreiche den Grenzstein, gehe durch das Gittertor der Rue Soufflot und wende mich nach dem Boulevard Saint-Michel. Vor der Auslage der Buchhandlung von Blanchard bleibe ich stehen, nehme, ohne erst zu überlegen, einen alten Band der Chemie von Orfila in die Hand, öffne ihn auf gut Glück und lese: "Den Schwefel hat man unter die einfachen Körper eingereiht. Die scharfsinnigen Untersuchungen von H. Davy und dem jüngeren Berthollet gehen jedoch darauf aus zu beweisen, dass er Wasserstoff, Sauerstoff und eine besondere Base enthält, deren Ausscheidung bisher nicht möglich gewesen ist."
Man wird sich meine, ich möchte sagen religiöse, Ekstase vorstellen, als mir diese an ein Wunder grenzende Offenbarung wird. Davy und Berthollet hatten Wasserstoff und Sauerstoff nachgewiesen, ich Kohlenstoff. Mir kommt es also zu, die Formel des Schwefels aufzustellen.
Zwei Tage später liess ich mich in die naturwissenschaftliche Fakultät der Sorbonne (des heiligen Ludwig!) einschreiben, mit dem Recht, im Laboratorium Untersuchungen anzustellen.
Der Morgen, an dem ich mich nach der Sorbonne begab, war für mich ein feierliches Fest. Wenn ich mir auch keine Illusion machte, die Professoren, die mich mit der kalten Höflichkeit, die man dem Fremden, dem Eindringling zeigt, empfangen hatten, überzeugen zu können, so gab mir doch eine milde und ruhige Freude den Mut des Märtyrers, der eine Schar von Feinden angreift. Denn für mich ist bei meinem Alter die Jugend der natürliche Feind.
Als ich auf den Platz komme, wo die kleine Kirche der Sorbonne liegt, finde ich die Tür offen und trete ein, ohne eigentlich zu wissen, warum. Die jungfräuliche Mutter und das Kind grüssen mich mit einem milden Lächeln; der Gekreuzigte lässt mich kalt, erscheint mir wie immer unbegreiflich. Der heilige Ludwig, meine neue Bekanntschaft, der Freund der Elenden und Aussätzigen, lässt sich junge Theologen vorstellen. Ist der heilige Ludwig mein Schutzheiliger, mein guter Engel, der mich ins Krankenhaus getrieben, damit ich das Feuer der höchsten Not durchmache, bevor ich den Ruhm wiedererlange, der zu Unehre und Verachtung führt? Hat er mich nach der Buchhandlung von Blanchard geschickt? Hat er mich hierher gezogen?
Vom Atheismus bin ich in den vollständigen Aberglauben gefallen.
Als ich die Votivbilder betrachte, die vom glücklichen Ausgang der Prüfungen Zeugnis ablegen, tue ich das Gelübde, niemals die weltlichen Zeichen des Verdienstes anzunehmen, falls ich Erfolg habe.
Die Stunde hat geschlagen. Ich laufe Spiessruten durch die unbarmherzige Jugend; sie weiss, welche chimärische Aufgabe ich mir gestellt habe, und verhöhnt mich.
Als zwei Wochen vergangen sind, habe ich unbestreitbare Beweise erhalten, dass der Schwefel eine dreistoffige Verbindung von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff ist.
Ich danke dem Leiter des Laboratorium, der sich stellt, als interessiere er sich nicht für meine Angelegenheiten, und verlasse dieses neue Fegefeuer mit einer unsagbaren inneren Freude.
Ich gehe morgens auf dem Friedhof Montparnasse spazieren, wenn ich nicht den Luxemburggarten besuche. Einige Tage nach meinem Auszug aus der Sorbonne entdecke ich bei dem Stern des Friedhofs eine Grabdenkmal von klassischer Schönheit. Ein Medaillon aus weissem Marmor zeigt die edlen Züge eines alten Weisen, den die Inschrift des Sockels mir als den Chemiker und Toxikologen Orfila verstellt. Es ist mein Freund und Beschützer, der mich später so manchesmal durch das Labyrinth chemischer Versuche geführt hat.
Eine Woche später, als ich die Rue d'Assas hinuntergehe, mache ich vor einem Haus von klösterlichem Aussehen Halt. Ein grosses Schild klärt mich über die Bestimmung des Gebäudes auf: Hotel Orfila.
Immer Orfila!
In den folgenden Kapiteln werde ich alles erzählen, was sich in diesem alten Haus zugetragen hat; in das mich die unsichtbare Hand getrieben, damit ich dort gezüchtigt, belehrt und, warum nicht, erleuchtet werde!
Der Scheidungsprozess wickelt sich sehr langsam ab, wurde von Zeit zu Zeit durch einen Liebesbrief, einen Aufschrei der Sehnsucht, Versprechungen der Versöhnung unterbrochen. Und schliesslich ein schroffes Lebewohl auf immer.
Ich liebe sie, sie liebt mich, und wir hassen einander mit dem wilden Hass der Liebe, die sich durch die Trennung steigert.
Um das unglückliche Band zu zerreissen, suche ich nach einer Gelegenheit, diese Leidenschaft durch eine andere zu ersetzen, und bald werden meine unredlichen Wünsche erhört.
Beim Mittagessen der Cremerie erscheint eine englische Dame, die sich der Bildhauerkunst widmet. Sie redet mich zuerst and und gefällt mir auf der Stelle. Sie ist schön, reizend, vornehm, gut gekleidet, und verführt durch eine künstlerische Ungezwungenheit. Mit einem Wort, eine Luxusausgabe meiner Frau, deren Bild sie verfeinert und vergrössert wiedergibt.
Um sich mir angenehm zu machen, ladet der angesehene Künstler, der Doyen der Cremerie, diese Dame zu den Donnerstagabenden ein, die er auf seinem Atelier gibt. Ich gehe hin, halte mich aber abseits, weil ich nur widerwillig einem Publikum, das sich über einen lustig macht, meine Gefühle zeige.
Gegen elf Uhr erhebt sich die Dame und gibt mir ein Zeichen geheimen Einverständnisses. Ziemlich linkisch stehe ich auf, verabschiede mich, biete dem jungen Weibe meine Begleitung an und führe sie hinaus, während die schamlosen jungen Leute lachen.
Vor einander lächerlich gemacht, gehen wir davon, ohne ein Wort sagen zu können; wir verachten uns, als hätten wir uns vor der spottenden Menge nackt ausgezogen.
Nun müssen wir auch noch durch die Rue de la Gaieté, wo Zuhälter und Dirnen uns mit ihren gemeinen Schimpfworten ohrfeigen, als seien wir Eindringlinge in ihr Gewerbe.
Man ist nicht liebeswürdig, wenn man ingrimmig am Pranger steht; und unter Geisselschlägen gebeugt, kann ich mich nicht wieder aufrichten. Als wir den Boulevard de Raspail erreichen, werden wir von einem feinem Regen überfallen, der uns wie mit Ruten peitscht. Da wir keinen Schirm haben, ist es das Verständigste, in einem warmen und erleuchteten Café Schutz zu suchen; mir der Gebärde eines Grandseigneurs zeige ich auf das reichste Restaurant von allen. Leichten Fusses überschreiten wir den Boulevard ... pardauz, pardauz! Der Gedanke, dass ich keinen Sou bei mir habe, trifft mich wie ein Hammerschlag vor den Schädel.
Ich habe vergessen, wie ich mich aus der Verlegenheit gezogen, aber ich werde niemals die Empfindungen vergessen, die mich diese Nacht überfielen, als ich die Dame an ihrer Haustür verliess.
Diese Strafe, obwohl streng und unmittelbar, und erteilt von einer geschickten Hand, die ich nicht verkennen konnte, genügte mir noch nicht. Ein Bettler, der die Verpflichtungen gegen seine Familie nicht erfüllt, hatte eine Verbindung knüpfen wollen, die ein anständiges Mädchen blossstellen musste. Das war ganz einfach ein Verbrechen, und ich legte mir die regelrechte Busse auf. Ich verzichte auf die Gesellschaft der Cremerie, ich faste, ich vermeide alles, was die verhängnisvolle Leidenschaft hervorrufen kann.
Aber der Versucher wacht. An einem Atelierabend finde ich die Schöne wieder, und zwar in einer morgenländischen Tracht, die ihre Schönheit so hebt, dass sie mich betört. Ihr gegenüber aber weiss ich nichts zu sagen, benehme mich linkisch; obwohl ich entdecke, dass dieses Weib nur eine ehrliche und aufrichtige Erklärung verdient: "ich begehre Sie," gehe ich meiner Wege, bis auf die Knochen von einer unreinen Flamme verzehrt.
Am nächsten Tage komme ich wieder in die Cremerie. Sie sitzt da, ist reizend, liebkost mich mit ihrer einschmeichelnden Stimme, kitzelt mich mit ihren Katzenaugen. Das Gespräch kommt in Gang, alles geht aufs beste, als im kritischen Augenblick die junge Minna lärmend eintritt. Das war ein Künstlerkind, halb Modell, halb Geliebte, das sich für die Literatur interessierte, eine gutes Wesen hatte und überall willkommen war. Ich kannte sie auch, und eines Abends waren wir gute Freunde geworden, jedoch ohne die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten. Genug, sie tritt ein, wirft sich mir in die Arme, denn sie war etwas berauscht, küsst mich auf die Wangen, duzt mich.
Die englische Dame erhebt sich, bezahlt und geht.
Damit ist es aus. Sie ist nicht wiedergekommen! Dank sei Minna, die mich übrigens vor dieser Dame gewarnt hatte, aus Gründen, die ich auf sich beruhen lasse.
Keine Liebe mehr! das ist die Losung, welche die Mächte mir gegeben haben, und ich bescheide mich, in der Gewissheit, dass ein höherer Zweck sich auch dahinter verbirgt.
Durch den Erfolg, den ich mit Schwefel gehabt habe, ermutigt, mache ich die Fortsetzung mit Jod. Nachdem ich im Temps einen Aufsatz über eine der Synthesen des Jod habe erscheinen lassen, sucht mich ein unbekannter Herr im Hotel auf. Er stellt sich als Vertreter aller europäischen Jodfabriken vor und sagt mir, er habe soeben meinen Artikel gelesen; in dem Augenblick, in dem die Sache sich bestätige, könnten wir einen Börsenkrach herbeiführen, der uns Millionen einbringen würde, falls wir nur ein Patent in Händen hätten.
Ich antworte ihm, ich hätte keine industrielle Erfindung gemacht, sondern eine wissenschaftliche Entdeckung, die noch nicht einmal reif sei; und die geschäftliche Seite interessiere mich nicht genug, um sie weiter zu verfolgen.
Er ging. Die Wirtin des Hotels, die einmal mit dem unbekannten Herrn in Verbindung gestanden hatte, erfuhr von ihm die grosse Neuigkeit, und zwei Tage lang wurde ich für einen zukünftigen Millionär gehalten.
Der Kaufmann kam wieder, diese Mal noch mehr begeistert. Er hatte Erkundigungen eingezogen und, überzeugt, dass mit der Entdeckung etwas zu verdienen sei, lud er mich ein, unverzüglich mit ihm nach Berlin zu fahren, um die nötigen Schritte zu tun.
Ich dankte ihm und riet ihm, erst die notwendigen Analysen vornehmen zu lassen, ehe er sich weiter engagiere.
Er bot mir hunderttausend Francs, vor Abend zahlbar, wenn ich ihm folgen wolle....
Ich hiess ihn gehen, da ich irgendeinen Schwindler witterte.
Bei der Wirtin unten nannte er mich einen Toren.
Die nächsten Tage waren ruhig, und ich hatte Zeit, um nachzudenken. Drohende Not, unbezahlte Schulden, eine unsichere Zukunft auf der einen Seite; auf der andern Unabhängigkeit, Freiheit, meine Studien fortzusetzen, ein sorgenfreies Leben. Und ausserdem, eine gute Idee ist ihren Preis wert.
Reue ergriff mich, aber ich hatte nicht den Mut, die Verbindung wieder anzuknüpfen. Da teilte mir eine Depesche des Kaufmanns mit, das ein Chemiker, Assistent an der Ecole de médicine, und ein Abgeordneter, der damals schon bekannt war und jetzt nur zu bekannt ist, sich für das Jodproblem interessierten.
Ich beginne also eine Reihe regelmässiger Versuche, die alle dasselbe Ergebnis haben: zu beweisen, dass Jod von Benzin abgeleitet werden kann.
Mittlerweile habe ich eine Unterredung mit dem Chemiker, und ein Tag wird bestimmt für eine Zusammenkunft, bei der die entscheidenden Versuche gemacht werden sollen.
An dem Morgen, der diese Sache entscheiden soll, nehme ich einen Wagen und bringe meine Retorten und Reagentien zu dem Kaufmann, der im Quartier du Marais wohnt. Der gute Mann war da; aber der Chemiker, der entdeckt hatte, dass es ein Feiertag war, hatte sich entschuldigt und die Sitzung auf den folgenden Tag verschoben.
Es war Pfingsten, was ich nicht gewusst hatte. Das schmutzige Kontor, das auf die finstere und unsaubere Strasse sah, bedrückte mir das Herz. Erinnerungen an die Kindheit erwachten: Pfingsten, das selige Fest, an dem die kleine Kirche mit grünen Zweigen, mit Tulpen, Lilien und Maiblumen geschmückt, sich für die Abendmahlskinder auftat; die jungen Mädchen weissgekleidet wie die Engel ... die Orgel ... die Glocken....
Ein Gefühl der Scham bemächtigte sich meiner Seele, und ich kehrte tief bewegt nach Hause zurück, fest entschlossen, jeder Versuchung, aus meiner Wissenschaft ein Geschäft zu machen, zu widerstehen. Ich säuberte mein Zimmer von den herumstehenden Apparaten und Reagentien; ich kehrte es aus; staubte ab, räumte auf; ich liess Blumen holen, besonders Narzissen. Nachdem ich dann ein Bad genommen und das Hemd gewechselt hatte, glaubte ich von dem Schmutz gereinigt zu sein. Darauf ging ich aus, um auf dem Kirchhof Montparnasse spazieren zu gehen; dort führte eine Heiterkeit der Seele mich zu milden Gedanken und einer ungewöhnlichen Zerknirschung.
O crux ave spes unica: so weissagten die Grabhügel mir mein Schicksal. Nichts mehr von Liebe! Nichts mehr von Geld! Nichts mehr von Ehre! Der Weg des Kreuzes, der einzige, der zur Weisheit führt.
Den Sommer und den Herbst des Jahres 1895 zähle ich, trotz allem, zu den glücklichsten Etappen meines so bewegten Lebens. Alles, was ich angreife, gelingt mir; unbekannte Freunde bringen mir die Nahrung wie die Raben dem Elias; Geld fliegt mir zu: ich kann Bücher kaufen, naturwissenschaftliche Gegenstände, darunter ein Mikroskop, das mir die Geheimnisse des Lebens entschleiert.
Tot für die Welt, da ich auf die eitlen Freuden von Paris verzichte, bleibe ich in meinem Viertel, wo ich jeden Morgen die Toten des Kirchhofs Montparnasse besuche, um dann in den Luxemburggarten hinabzusteigen und meine Blumen zu begrüssen. Zuweilen besucht mich ein durchreitender Landsmann, um mich einzuladen, auf der andern Seite des Wassers zu frühstücken und ins Theater zu gehen. Ich versage es mir, weil das rechte Ufer mir verboten ist: das ist die sogenannte "Welt", die Welt der Lebenden und der Eitelkeit.
Obwohl ich sie nicht formulieren kann, hat sich eine Art Religion in mir gebildet. Eher ein Zustand der Seele als eine auf Lehren gegründete Ansicht; ein Wirrwarr von Empfindungen, die sich mehr oder weniger zu Gedanken verdichten.
Ich habe mir ein römisches Gebetbuch gekauft und lese es mit Sammlung; das Alte Testament tröstet und züchtigt mich in einer etwas dunklen Weise, während das Neue mich kalt lässt. Das hindert mich nicht, dass ein buddhistisches Buch auf mich einen stärkeren Einfluss als alle andern heiligen Bücher übt, weil es das positive Leiden über die Enthaltsamkeit stellt. Buddha zeigt den Mut, im vollen Besitz seiner Lebenskraft und im Genuss seines ehelichen Glücks auf Weib und Kind zu verzichten, während Christus jede Gemeinschaft mit den erlaubten Freunde dieser Welt vermeidet.
Übrigens grüble ich nicht über die Empfindungen, die in mir auftauchen; ich halte mich indifferent, lasse sie gewähren, indem ich mir dieselbe Freiheit bewillige, die ich andern schulde.
Das grosse Ereignis der Pariser Saison war Brunetières Feldgeschrei über den Bankerott der Wissenschaft. Seit meiner Kindheit in die Naturwissenschaften eingeweiht, später Anhänger Darwins, hatte ich entdeckt, wie ungenügend diese wissenschaftliche Methode ist, die den Mechanismus des Weltalls bekennt, ohne einen Mechanismus anzunehmen. Die Schwäche des Systems zeigte sich in einer allgemeinen Entartung der Wissenschaft: die hatte eine Grenze abgesteckt, über die man nicht hinausgehen sollte. Wir haben alle Probleme gelöst: die Welt hat keine Rätsel mehr. Diese dünkelhafte Lüge hatte mich schon um 1880 gereizt, und während der folgenden fünfzehn Jahre hatte ich eine Revision der Naturwissenschaften vorgenommen. So hatte ich 1884 die Zusammensetzung der Atmosphäre in Zweifel gezogen: der Stickstoff der Luft ist nicht identisch mit dem Stickstoff, der durch Zerlegung eines stickstoffhaltigen Salzes gewonnen wird. 1891 besuchte ich das physikalische Institut in Lund, um die Spektren dieser beiden Stickstoffarten, deren Verschiedenheit ich entdeckt hatte, zu vergleichen. Brauche ich den Empfang zu schildern, den mir die gelehrten Mechanisten bereiteten?
Nun, in diesem Jahr 1895 hat die Entdeckung des Argon frühere Vermutungen bestätigt und meinen durch eine unbesonnene Heirat unterbrochenen Untersuchungen einen neuen Aufschwung gegeben.
Nicht die Wissenschaft hat Bankerott gemacht, sondern nur die veraltete, entartete Wissenschaft, und Brunetière hatte recht, obwohl er unrecht hatte.
Während alle die Einheit der Materie anerkannten und sich Monisten nannten, ohne es zu sein, ging ich weiter und zog die letzten Konsequenzen der Lehre, indem ich die Grenzen aufhob, die Materie und sogenannten Geist zu trennen. So hatte ich 1894 im "Antibarbarus" die Psychologie des Schwefels behandelt, indem ich sie durch die Ontologie, das heisst die embryonale Entwicklung des Schwefels, erklärte.
Wer sich dafür interessiert, sei auf meine im Sommer und Herbst 1895 niedergeschriebene Arbeit "Sylva Sylvarum" verwiesen, in der ich im stolzen Gefühl hellseherischer Kraft die Geheimnisse der Schöpfung besonders im Pflanzen- und Tierreich durchschaut zu haben glaubte; ferner auf meine "Kirchhofstudien", die zeigen, wie ich in Einsamkeit und Leiden zu einem schwankenden Begriff von Gott und Unsterblichkeit zurückgeführt wurde.
In diese neue Welt eingeführt, in die niemand mir folgen kann, fasse ich einen Widerwillen gegen die andern und habe einen unbesiegbaren Wunsch, mich von meiner Umgebung freizumachen. Ich benachrichtige also meine Freunde, dass ich nach Meudon gehen wolle, um ein Buch zu schreiben, das Einsamkeit und Stille verlange.
Zur selben Zeit führten unbedeutende Zwistigkeiten zu einem Bruch mit dem Kreis der Cremerie, so dass ich mich eines Tages recht rauh vereinsamt fand. Die erste Folge war eine unerhörte Ausdehnung meiner inneren Sinne: eine seelische Kraft, die sich zu betätigen verlangte. Ich glaubte mich im Besitz grenzenloser Kräfte, und der Hochmut flösste mir die tolle Idee ein, zu versuchen, ob ich ein Wunder tun könne.
In einer früheren Epoche, in der grossen Krisis meines Lebens, hatte ich bemerkt, dass ich eine Fernwirkung auf abwesende Freunde auszuüben vermochte. In den Volkssagen hat man sich mit der Frage der Telepathie und der Behexung beschäftigt. Ich möchte mir nun weder unrecht tun, noch mich von einer verbrecherischen Handlung ganz weiss waschen, aber ich glaube zu wissen, dass mein böser Wille nicht so böse war wie der Rückschlag, den ich davon empfing. Eine ungesunde Neugier, ein Ausbruch verkehrter Liebe, veranlasst durch die furchtbare Einsamkeit, flösst mir eine übermässige Sehnsucht ein, wieder mit meiner Frau und meinem Kind anzuknüpfen, da ich sie alle beide liebte. Aber wie, da der Scheidungsprozess schon im Gang war? Ein ausserordentliches Ereignis, ein gemeinsames Unglück, ein Blitzschlag, eine Feuersbrunst, eine Überschwemmung ... kurz eine Katastrophe, die zwei Herzen wieder vereinigt, wie sich in den Romanen feindliche Hände am Bette eines Kranken treffen. Da habe ich es! Eines Kranken! Die Kinder sind immer etwas krank; die Empfindlichkeit einer Mutter übertreibt die Gefahr; ein Telegramm, und alles ist gesagt.
Ich kannte nicht die einfachsten Begriffe der Magie, aber ein unheilvoller Instinkt flüsterte mir ins Ohr, was ich mit dem Porträt meines geliebten Töchterchens vornehmen müsse, meines geliebten Töchterchens, das später mein einziger Trost in einem verfluchten Dasein werden sollte.
Ich werde die Folgen einer Handlung erzählen; wie die böse Absicht durch die Vermittlung des symbolischen Verfahrens zu wirken schien.
Indessen liessen die Konsequenzen auf sie warten, und ich setzte meine Arbeiten fort, hatte aber das Gefühl eines unerklärlichen Unbehagens, das von der Ahnung neuen Unglücks begleitet war.
Als ich abends allein vor dem Mikroskop sass, begegnete mir ein Zwischenfall, den ich damals nicht verstand, der aber doch einen starken Eindruck auf mich machte.
Ich hatte seit vier Tagen eine Walnuss keimen lassen und löste jetzt den Keim der, herzförmig und nicht grösser als ein Birnenkern, zwischen zwei Samenblättchen eingepflanzt ist, deren Aussehen an das menschliche Gehirn erinnert. Man stelle sich meine Erregung vor, als ich auf der Platte des Mikroskops zwei Händchen erblickte, weiss wie Alabaster, erhoben und gefaltet wie zum Gebet. Ist es eine Vision? eine Halluzination? Oh nein! Eine niederschmetternde Wirklichkeit, die mir Schrecken einflösst! Unbeweglich sind sie gegen mich wie in Beschwörung ausgestreckt, ich kann ihr fünf Finger zählen, der Daumen ist kürzer, richtige Frauen- oder Kinderhände.
Ein Freund, der mich vor diesem mich bestürzenden Schauspiel überraschte, wurde aufgefordert, die Erscheinung zu bestätigen; und er brauchte kein Hellseher zu sein, um zwei gefaltete Hände zu sehen, die den Beobachter um Barmherzigkeit anrufen.
Was war das? Die beiden ersten unausgebildeten Blätter eines Walnussbaumes, der Juglans regia, der Eichel des Jupiter. Weiter nichts! Und dennoch die unleugbare Tatsache, dass sich zehn Finger von menschlicher Form zu einer Gebärde des Flehens falteten: de profundis clamavi ad te!
Noch zu kleingläubig und durch eine empirische Erziehung verdummt, gehe ich darüber hinweg.
Der Fall ist getan! Ich fühle die Ungnade der unbekannten Mächte schwer auf mir ruhen. Die Hand des Unsichtbaren ist erhoben, und die Schläge fallen dicht auf mein Haupt.
Zuerst zieht sich mein anonymer Freund, der mich bisher unterstützt hat, zurück, von einem anmassenden Brief verletzt; und ich stehe ohne Hilfsmittel da.
Und als ich die Korrekturbogen von "Sylva Sylvarum" erhalte, entdecke ich, dass der Text wie ein gut gemischtes Spiel Karten umgebrochen ist. Nicht nur die Seiten sind umgestellt und falsch numeriert, auch die verschiedenen Abteilungen sind so durcheinandergeworfen, dass sie auf ironische Weise die Lehre von der "grossen Unordnung", die in der Natur herrscht, symbolisieren.
Nach endlosen Verzögerungen und Verschiebungen ist die Broschüre gedruckt; da aber präsentiert mir der Drucker eine Rechnung, deren Belauf die vereinbarte Summe ums Doppelte übersteigt. Mit Bedauern trage ich mein Mikroskop, den schwarzen Anzug und die wenigen Kostbarkeiten, die mir geblieben sind, zum Leihamt, aber ich bin schliesslich gedruckt, und zum erstenmal in meinem Leben bin ich sicher, etwas Neues, Grosses und Schönes gesagt zu haben.
Der Übermut, mit dem ich die Exemplare zur Post trage, ist leicht zu verstehen. Mit einer höhnisch-stolzen Gebärde werfe ich die Drucksachen in den Kasten, und trotzig gegen die feindlichen Mächte denke ich:
—Hörst du, Sphinx, ich habe dein Rätsel gelöst, und ich fordere dich heraus!
Als ich ins Hotel zurückkehre, wurde ich von der Rechnung überfallen, die von einem Brief begleitet war.
Gereizt von diesem Schlag, der mir unerwartet kam, weil ich seit einem Jahr der Gast des Hauses war, achte ich von jetzt an auf Kleinigkeiten, die ich bisher übersehen habe. So werden in den benachbarten Zimmern drei Klaviere auf einmal gespielt.
Ich sage mir, das ist ein Komplott dieser skandinavischen Damen, von deren Verkehr ich mich zurückgezogen habe.
Drei Klaviere! Und ich kann das Hotel nicht wechseln, weil ich kein Geld habe.
Ich schlafe ein, zornig auf diese Damen und das Schicksal, den Himmel verwünschend.
Am nächsten Morgen werde ich durch einen unerwarteten Lärm geweckt. Man hämmert im Nebenzimmer einen Nagel ein, gerade dort, wo mein Bett steht. Dann hämmert es auf der andern Seite.
Eine Kabale, ebenso dumm wie diese Künstlerinnen; ich lasse sie vorübergehen, ohne mich daran zu kehren.
Als ich mir aber nach dem Essen wie gewöhnlich ein Schläfchen auf meinem Bett leisten will, ist ein solcher Lärm über meinem Alkoven zu hören, dass mir der Gips der Decke auf den Kopf fällt.
Ich gehe zur Wirtin hinunter und beklage mich über das Betragen der Gäste. Sie behauptet, übrigens sehr höflich, nichts gehört zu haben, und verspricht mir, jeden, der es wagen würde, mich zu beunruhigen, fortzujagen. Es lag ihr nämlich viel daran, mich in ihrem Hotel, das nicht besonders ging, zu behalten.
Ohne den Worten einer Frau ganz zu glauben, verliess ich mich doch auf ihr Interesse, das sie zwang, mich gut zu behandeln.
Doch hört der Lärm nicht auf, und ich verstehe, dass diese Damen mich glauben machen wollen, es seien Klopfgeister. Wie einfältig!
Gleichzeitig ändern auch die Kameraden der Cremerie ihr Benehmen gegen mich, und eine geheime Feindseligkeit äussert sich in versteckten Blicken und tückischen Worten.
Des Haders müde, verlasse ich Hotel und Cremerie, ausgeplündert, Bücher und Bibelots zurücklassend, nackt wie ein kleiner Johannes. Und ziehe am 21. Februar 1896 ins Hotel Orfila ein.
Hotel Orfila, das wie ein Kloster aussieht, ist ein Pensionat für die Studierenden der katholischen Gesellschaft. Ein liebenswürdiger und milder Abbe hat die Aufsicht. Ruhe, Ordnung und gute Sitten herrschen hier. Was mich aber besonders nach so vielen Verdriesslichkeiten tröstet, ist, dass Frauen hier nicht zugelassen werden.
Das Haus ist alt; die Zimmer niedrig, die Korridore dunkel, und die hölzernen Treppen schlängeln sich wie in einem Labyrinth. In diesem Gebäude ist eine Atmosphäre von Mystik, die mich lange angezogen hat. Mein Zimmer geht auf eine Sackgasse hinaus; von der Mitte aus sieht man nur eine moosbewachsene Mauer mit zwei runden Fensterchen; sitze ich aber an meinem Tisch vorm Fenster, so blicke ich auf eine entzückende Landschaft, die ich nicht erwartet hätte.
Hinter einer Ringmauer, die mit Efeu bedeckt ist, liegt der Hof eines Klosters für junge Mädchen unter Platanen, Paulownien, Robinien. Eine köstliche Kapelle im Spitzbogenstil. Etwas weiter sind hohe Mauern mit unzähligen vergitterten Fensterchen zu sehen, die mich an ein Kloster denken lassen; dahinter im Tal ein Wald von Schornsteinen, die halbverborgene alte Häuser krönen; und in der Ferne der Turm der Kirche Notre-Dame-des-Champs, mit dem Kreuz und, ganz oben, dem Hahn.
In meinem Zimmer hängt ein Kupferstich mit dem heiligen Vincenz de Paul, ein zweiter, mit Sankt Peter, hängt im Alkoven über dem Bett. Der Pförtner des Himmels! Welche beissende Ironie für mich, der vor einigen Jahren den Apostel in einem phantastischen Drama lächerlich gemacht hat.
Mit meinem Zimmer sehr zufrieden, schlafe ich die erste Nacht gut.
Am nächsten Morgen entdecke ich, dass der Abtritt in dem Gässchen unter meinem Fenster liegt, und zwar so nahe, dass man das Auf- und Zuklappen des eisernen Deckels hört. Weiter erfahre ich, dass die beiden runden Fensterchen gegenüber ebenfalls zu Abtritten gehören. Schliesslich vergewissere ich mich, dass die hundert Fensterchen im Hintergrund des Tals zu ebenso viel Abtritten gehören, die auf der Hofseite einer Reihe Häuser liegen.
Ich wüte zuerst, da ich aber nicht die Mittel habe, mich zu rühren, beruhige ich mich, indem ich das Schicksal verwünsche.
Gegen ein Uhr bringt mir der Diener das Frühstück, und da ich meinen Arbeitstisch nicht in Unordnung bringen will, stellt er das Tablett auf den Nachttisch, in dem das Nachtgeschirr steht.
Ich machte ihn darauf aufmerksam, und der Diener entschuldigte sich damit, dass er keinen andern Tisch zur Verfügung habe. Er sah ehrlich und nicht boshaft aus, so dass ich ihm verzieh; und das Nachtgeschirr wurde fortgenommen.
Wenn ich zu dieser Zeit schon Swedenborg gekannt hätte, würde ich begriffen haben, dass ich von den Mächten zur Kothölle verurteilt sei. Jetzt aber tobte ich gegen das fortwährende Unglück, das mich seit so vielen Jahren verfolgte; dann beruhigte ich mich mit düsterer Resignation, die sich vor dem Schicksal beugt. Ich erbaute mich, indem ich das Buch Hiob las, überzeugt, der Ewige habe mich dem Satan überliefert, um mich zu prüfen. Dieser Gedanke tröstete mich, und das Leiden erfreute mich als Zeichen des Vertrauens von seiten des Allmächtigen.
Nun beginnt eine Reihe von Offenbarungen, die ich nicht erklären kann, ohne die Mitwirkung der unbekannten Mächte anzunehmen; und von diesem Augenblick an mache ich Aufzeichnungen, die sich allmählich anhäufen und ein Tagebuch bilden, aus dem ich hier Auszüge gebe.
Eine unangenehme Stille hat sich um meine chemische Untersuchungen gelegt. Um mich wieder aufzurichten und einen entscheidenden Schlag zu führen, nehme ich das Problem Gold zu machen, vor. Ich ging von der Frage aus: warum fällt schwefelsaures Eisen in einer Lösung von Goldsalz metallisches Gold? Antwort: weil Eisen und Schwefel in der Konstitution des Goldes auftreten. In der Tat enthalten alle Schwefeleisen der Natur mehr oder weniger Gold. Ich begann also mit Lösungen von schwefelsaurem Eisen zu bearbeiten.
Eines Morgens erwachte ich mit der unbestimmten Lust, einen Ausflug aufs Land zu machen, obwohl das gegen meinen Geschmack und meine Gewohnheiten war. Ohne dahin zu wollen, kam ich nach dem Bahnhof Montparnasse und bestieg den Zug nach Meudon. Ich gehe ins Dorf hinunter, das ich zum ersten Mal besuche. Gehe die grosse Strasse hinauf und biege rechts ab in eine Gasse, die zwischen zwei Mauern läuft. Zwanzig Schritte vor mir, zur Hälfte in der Erde vergraben, erhebt sich ein römischer Ritter in eisengrauer Rüstung aus dem Boden. Obwohl recht sauber modelliert, wenn auch im kleinen, täuscht mich die Figur nicht darüber, dass sie nur aus rohem Stein ist. Tritt man näher, sieht man, dass es eine Augentäuschung ist, und ich bleibe stehen, mir geflissentlich die Illusion erhaltend, die mir Vergnügen macht. Der Ritter betrachtet die nahe Mauer, ich folge seinen Augen und bemerke auf dem Kalk eine Kohlenschrift. Die verschlungenen Buchstaben F und S lassen mich an die Initialen des Namens meiner Frau denken. Sie liebt mich noch immer!—In der nächsten Sekunde erscheinen mir, die chemischen Zeichen des Eisens und Schwefels, Fe und S, die sich trennen und meinen Augen das Geheimnis des Goldes zeigen.
Ich untersuche den Boden und finde zwei Bleistempel, die durch Bindfaden vereinigt sind. Der eine trägt die Buchstaben V. P., der andere eine Königskrone.
Ohne dieses Abenteuer näher deuten zu wollen, kehre ich nach Paris zurück, unter dem lebhaften Eindruck, etwas Wunderbares erlebt zu haben.
In meinem Kamin brenne ich Kohlen, die man wegen ihrer runden und gleichartigen Form Spatzenköpfe nennt. Als eines Tages das Feuer erlosch, ehe es ausgebrannt war, nehme ich ein Kohlenkonglomerat heraus, das die Züge einer phantastischen Gestalt zeigt. Ein Hahnenkopf mit prächtigem Kamm, der Rumpf eher menschlich und die Glieder gewunden. Man hätte sagen können, es sei ein Teufel, wie man sie auf den Hexensabbathen des Mittelalters darstellte.
Am andern Tage nehme ich wieder eine prächtige Gruppe zweier berauchter Gnomen oder Kobolde heraus, die sich umarmen, während die Kleider flattern. Es ist ein Meisterwerk primitiver Skulptur.
Am dritten Tag ist es eine Madonna mit dem Kinde, in byzantinischem Stil, von einer unvergleichlichen Linie.
Ich lasse alle drei auf meinem Tisch liegen, nachdem ich sie mit schwarzer Kreide abgezeichnet habe.
Ein befreundeter Maler besucht mich; er betrachtet die drei Statuetten mit wachsender Neugier und fragt mich:
—Wer hat das gemacht?
—Gemacht?
Um ihn auf die Probe zu stellen, nenne ich den Namen eines norwegischen Bildhauers.
—Wirklich? Ich hätte sie Kittelsen, dem berühmten Illustrator der skandinavischen Sagen, zugeschrieben.
Ich glaube nicht an die Existenz von Teufeln, aber ich bin begierig, zu sehen, welchen Eindruck meine Statuetten auf die Spatzen machen, die gewohnt sind, vor meinem Fenster Brot zu bekommen; ich stelle die Figuren also aufs Dach.
Die Spatzen erschrecken und halten sich fern. Es ist also eine Ähnlichkeit vorhanden, welche selbst die Tiere wahrnehmen können; es liegt eine Wirklichkeit hinter diesem Spiel der trägen Materie und des Feuers.
Die Sonne wärmt meine Figuren so, dass der Teufel mit dem Hahnenkamm platzt; das erinnert mich an die Volkssage, dass die Kobolde sterben, wenn sie warten, bis die Sonne aufgeht.
Es geschehen Dinge im Hotel, die mich beunruhigen.
Am Tage nach meiner Ankunft finde ich an der Tafel im Flur, an der die Zimmerschlüssel hängen, einen Brief, der an einen Herrn X., einen Studenten adressiert ist, der denselben Namen wie die Familie meiner Frau trägt. Der Poststempel ist Dornach, der Name des österreichischen Dorfes, wo meine Frau und mein Kind wohnen. Da ich aber sicher bin, dass es kein Postamt in Dornach gibt, bleibt die Sache rätselhaft.
Diesem Brief, der in so herausfordernder Art dahin gelegt ist, als habe man die Absicht, ihn zu zeigen, folgen andere.
Der zweite ist an Herrn Dr. Bitter adressiert und Wien abgestempelt; ein dritter trägt das polnische Pseudonym Schmulachowsky.
Jetzt mischt sich der Teufel ein. Denn dieser Name ist verstellt, und ich verstehe, an wen er erinnern will: es ist ein Todfeind von mir, der in Berlin wohnt.
Ein anderes Mal ist es ein schwedischer Name, der mich an einen Feind in meiner Heimat erinnert.
Schliesslich trägt ein in Wien abgestempelter Brief den Aufdruck: Bureau für Chemische Analyse von Dr. Eder. Das heisst, man spioniert nach meiner Goldsynthese.
Kein Zweifel mehr, hier wird eine Intrige gesponnen; aber der Teufel hat diesen Falschspielern die Karten gemischt. Meinen Argwohn nach vier Richtungen der Welt irren zu lassen, das ist zu erfinderisch für die einfältigen Sterblichen.
Als ich mich beim Diener nach diesem Herrn X. erkundige, gibt er mir die dumme Antwort, es sei ein Elsässer. Das ist alles.
Als ich eines Morgens von meinem Spaziergang zurückkehre, finde ich eine Postkarte in dem Fach neben meinem Schlüssel. Einen Augenblick ergreift mich die Versuchung, das Rätsel durch einen Blick auf die Karte zu lösen, aber mein Schutzengel lähmte meine Hand gerade in der Sekunde, in welcher der junge Mann aus seinem Versteck hinter der Tür hervortritt.
Ich sehe ihm ins Gesicht: er gleicht meiner Frau. Schweigend grüssen wir uns, und jeder geht seines Weges.
Ich habe die Intrige niemals erklären können, deren Personen ich noch nicht kenne, da meine Frau weder einen Bruder noch einen Vetter hat.
Die Ungewissheit, die beständige Drohung einer Rache waren mir sechs Monate lang genügende Tortur. Ich ertrug sie wie das andere als eine Strafe für bekannte und unbekannte Sünden.
Mit dem neuen Jahr gesellte sich ein neuer Mann dem Kreis der Cremerie. Maler und Amerikaner, kam er zur rechten Zeit, um unsere schläfrige Gesellschaft zu beleben. Ein lebhafter Geist, ein Kosmopolit, ein kühner Mensch, guter Kamerad, flösste er mir doch ein unbestimmtes Misstrauen ein. Trotz seinem sichern Auftreten witterte ich, dass seine Lage durchaus nicht gesichert sei.
Der Krach brach schneller aus, als man erwartet hätte. Eines Abends trat der Unglückliche in mein Zimmer und bat um die Erlaubnis, einen Augenblick bleiben zu dürfen. Er sah aus wie ein verlorener Mann, und er war es.
Der Hauswirt hatte ihn aus seinem Atelier gejagt, seine Geliebte hatte ihn verlassen, seine Gläubiger bedrängten ihn; auf der Strasse beschimpften ihn die Zuhälter seiner nicht bezahlten Modelle; was ihn aber vollständig vernichtete, war die Grausamkeit des Hauswirts, sein für die Ausstellung bestimmtes Gemälde mit Beschlag zu belegen; er hatte nämlich auf einen Erfolg gerechnet, weil er das Sujet für originell und stark hielt. Es war eine schwangere Emanzipierte, die von der Menge ans Kreuz geschlagen und ausgepfiffen wird.
Da er auch in der Cremerie überschuldet war, stand er mit leerem Magen auf der Strasse.
Nach der ersten Beichte vervollständigte er seine Aussage, indem er eingestand, er habe eine doppelte Dosis Morphium genommen, aber der Tod wolle ihn noch nicht.
Nachdem wir ernst und reiflich überlegt hatten, kamen wir schliesslich dahin, dass er das Viertel verlassen müsse. Ich wollte mit ihm in einer andern unbekannten Garküche zu Mittag essen, damit nicht der Mangel an Freunden ihm den Mut nähme, ein anderes Bild für den Salon der Unabhängigen fertig zu machen.
Das Unglück dieses Mannes, der mein einziger Kamerad geworden ist, vergrössert mein Leiden, weil ich auch noch seine Pein auf mich nehme. Es ist eine Herausforderung von mir, die mir eine Erfahrung von grossem Wert einbringt. Er enthüllt mir seine ganze Vergangenheit: Deutscher von Geburt, hat er sieben Jahre in Amerika gelebt, infolge eines Unglücks, das über seine Familie hereinbrach, und wegen eines Jugendstreiches: er hatte eine gottlose Schmähschrift herausgegeben, die von der Polizei beschlagnahme wurde.
Ich entdecke eine ungewöhnliche Intelligenz, ein melancholisches Temperament, eine zügellose Sinnlichkeit. Aber hinter dieser menschlichen Maske, die durch eine kosmopolitische Erziehung erweitert ist, ahne ich ein Geheimnis, das mich neugierig macht und das ich eines Tages aufdecken werde.
Ich warte zwei Monate, während deren ich mein Dasein mit dem dieses Freundes vereinige. All das Elend eines Künstlers, der nicht durchgedrungen ist, mache ich durch, indem ich vergesse, dass ich meine Laufbahn schon hinter mir habe, dass mein Name etwas im Tout-Paris und in der Gesellschaft der Dramatiker zu bedeuten hat, wenn das mich als Chemiker auch nicht mehr interessiert. Übrigens liebt mich mein Kamerad nur, solange ich meine wirklichen Erfolge verberge; muss ich sie aber im Vorübergehen erwähnen, ist er verletzt, macht sich so unglücklich, so unbedeutend, dass ich aus Barmherzigkeit mich selber wie einen alten Lumpen behandele. Dadurch erniedrige ich mich allmählich, während er, der seine Zukunft noch vor sich hat, sich auf meine Kosten erhebt. Ich mache mich zu einem Leichnam, der an den Wurzeln eines Baumes begraben ist, während der Baum, der seine Nahrung aus dem in Zersetzung begriffenen Leben zieht, hoch in die Luft wächst.
Da ich zu dieser Zeit buddhistische Bücher studiere, bewundere ich die Verleugnung, mit der ich mich für einen andern opfere. Einer guten Tat wird ihr Lohn, und dies gewann ich dabei.
Eines Tages liefert mir die Revue des Revues ein Bildnis des amerikanischen Propheten und Arztes Francis Schlatter, der 1895 fünftausend Kranke heilte und dann für immer von dieser Erde verschwand.
Nun, die Züge dieses Mannes glichen in wunderbarer Weise denen meines Kameraden. Um die Probe zu machen, nehme ich die Zeitschrift ins Café de Versailles, wo mich ein schwedischer Bildhauer erwartete. Er bemerkt die Ähnlichkeit und erinnert mich an ein seltsames Zusammentreffen: dass alle beide von deutscher Herkunft waren und in Amerika wirkten. Noch mehr, Schlatter verschwand zur selben Zeit, als unser Freund in Paris auftauchte. Da ich jetzt schon etwas in den Ausdrücken des Okkultismus bewandert bin, äussere ich die Ansicht, dieser Francis Schlatter sei der "Doppelgänger" unseres Mannes, der, ohne es zu wissen, ein unabhängiges Dasein führe.
Als ich das Wort Doppelgänger aussprach, machte mein Bildhauer grosse Augen und lenkte meine Aufmerksamkeit darauf, dass unser Mann immer zwei Wohnungen habe, die eine auf dem rechten Ufer, die andere auf dem linken. Ausserdem erfahre ich, dass mein geheimnisvoller Freund ein doppeltes Dasein in dem Sinn führt, dass er den Abend mit mir in philosophischen und religiösen Betrachtungen verbringt, während man ihn in der Nacht immer noch auf dem Ball Bullier trifft.
Es gab ein sicheres Mittel, die Identität dieser beiden Doppelgänger zu bewiesen, da Francis Schlatter letzter Brief im Faksimile von der Revue gedruckt war.
—Kommen Sie heute abend zum Essen, schlug ich vor; ich werde ihm Schlatters Brief diktieren. Wenn sich die beiden Handschriften, und besonders die Unterschriften, gleichen, ist das ein Beweis.
Des Abends beim Essen bestätigt sich alles: die Handschrift ist dieselbe, die Unterschrift, der Schnörkel, alles ist da. Etwas überrascht, unterwirft sich der Maler unserm Examen; schliesslich fragt er:
—Und was wollen Sie damit?
—Kennen Sie Francis Schlatter?
—Ich habe nie von ihm sprechen hören.
—Erinnern Sie sich nicht an jenen Arzt in Amerika, voriges Jahr?
—Ach ja, der Scharlatan!
Er erinnert sich: ich zeige ihm Bildnis und Faksimile.
Er lächelt skeptisch, ruhig, gleichgültig.
Einige Tage darauf sitzen mein geheimnisvoller Freund und ich auf der Terrasse des Café de Versailles vor einem Absinth, als ein Mann, der wie ein Arbeiter gekleidet ist und bösartig aussieht, vor dem Tisch stehen bleibt und, ohne "Achtung" zu rufen, sich mitten unter den Gästen wie ein Wahnsinniger gebärdet. Gegen meinen Kameraden gewandt, schreit er aus vollem Hals:
—Da hab ich Sie doch gefasst, Sie Gauner, der Sie mich geprellt haben! Was soll denn das bedeuten? Sie bestellen bei mir ein Kreuz für dreissig Francs, ich bringe es Ihnen, und dann kneifen Sie aus! Potztausend, glauben Sie etwa, so ein Kreuz macht sich von allein?...
Er fuhr fort, ohne aufzuhören, und als die Kellner ihn entfernen wollten, drohte er, die Polizei zu holen. Währenddessen sass der arme Verschuldete stumm und unbeweglich da, vernichtet wie ein Verurteilter, vor einem Publikum von Künstlern, die ihn mehr oder weniger kannten.
Als der Auftritt vorüber war, frage ich ihn, verwirrt wie von einer Szene aus der Hölle:
—Das Kreuz? Welches Kreuz für dreissig Francs? Ich begreife diese Geschichte nicht....
—Es war das Modell des Kreuzes der Jeanne d'Arc, wissen Sie, diese Maschine für mein Gemälde "Das gekreuzigte Weib".
—Aber das war ja der Teufel selbst, dieser Arbeiter! Und nach einer Pause des Schweigens fuhr ich fort:
—Seltsam ist es, aber man spielt nicht mit dem Kreuz noch mit der Jeanne d'Arc.
—Glauben Sie daran?
—Ich weiss nicht! Ich weiss nichts mehr! Aber die dreissig Silberlinge!
—Genug! genug! rief er gekränkt.
Als ich am Stillfreitag in die Garküche kam, fand ich meinen Leidensgenossen am Tisch eingeschlafen.
In einer Anwandlung von Heiterkeit weckte ich ihn mit dem Anruf:
—Sie hier?
—Wieso?
-Ich glaubte, am Stillfreitag blieben Sie wenigstens bis sechs Uhr am Kreuz.
—Bis sechs Uhr? Ich habe wirklich den ganzen Tag bis sechs Uhr abends geschlafen, ohne sagen zu können warum.
—Ich könnte es.
—Natürlich: der Astralleib geht spazieren, nicht wahr, in Amerika ... und so weiter.
Seit diesem Abend legt sich eine gewisse Kälte zwischen uns. Unser Verkehr hat jetzt vier schreckliche Monate gedauert. Mein Kamerad hat seine Erziehung noch einmal durchgemacht und Zeit gehabt, die Methode der Malerei zu wechseln, so dass er jetzt sein gekreuzigtes Weib als altes Spiel verwirft. Er hat das Leiden als die einzige Lebensfreude, die einem frommt, auf sich genommen, und die Resignation ergab sich daraus. Ein Held im Elend! Ich bewunderte ihn, wenn er an einem Tage den Weg von Montrouge nach den Hallen hin und zurück ging, mit abgetretenen Stiefeln, ohne etwas zu sich genommen zu haben. Nachdem er den Redaktionen illustrierter Blätter siebzehn Besuche gemacht, hatte er drei Zeichnungen untergebracht, ohne jedoch gleich bar bezahlt worden zu sein; dann ass er abends für zwei Sous Brot und ging dann zu Bullier.
Schliesslich lösten wir in stillschweigender Übereinstimmung diese zu gegenseitiger Hilfe eingegangene Verbindung. Ein eigentümliches Gefühl sagte uns beiden, es sei genug, unsere Schicksale müssten sich getrennt erfüllen. Als die Lebewohls gewechselt waren, wusste ich, dass es die letzten waren.
Ich habe diesen Mann nicht wieder gesehen, auch nichts von seinem Schicksal erfahren.
Im Frühling, als ich von meinem eigenen widrigen Geschick und dem meines Kameraden bedrückt wurde, empfing ich von meinen Kindern aus erster Ehe einen Brief, in dem sie mir erzählten, sie seien so krank gewesen, dass man sie ins Krankenhaus habe bringen müssen. Als ich den Zeitpunkt dieses Ereignisses mit dem meines verhängnisvollen Versuchs verglich, erschrak ich. Leichtfertig hatte ich mit den geheimen Kräften gespielt, und der schlimme Wille hatte seinen Weg gemacht, um aber, von der unsichtbaren Hand geleitet, mich selber in die Brust zu treffen.
Ich entschuldige mich nicht, ich bitte nur den Leser, diese Tatsache zu behalten, falls es ihm einfallen, sollte, Magie auszuüben, besonders die Wirkung, die Bezauberung oder Behexung in eigentlichem Sinn heisst und deren Existenz de Rochas in seiner "Extériorisation de la sensibilité" festgestellt hat.
Ich erwachte an einem Sonntag vor Ostern, gehe in den Luxemburggarten, durchwandere ihn und überschreite die Strasse. Als ich unter die Arkaden des Odeon komme, bleibe ich unbeweglich vor den blauen Balzacbänden stehen, und durch einen Zufall greife ich "Seraphita" heraus. Warum gerade diesen Band?
Vielleicht eine halbbewusste Erinnerung, welche die Lektüre, der Zeitschrift "l'Initiation" hinterlassen hat, der Besprechung von "Sylva Sylvarum" mich einen Landmann Swedenborgs nannte.
Sobald ich nach Hause kam öffnete ich das Buch, das mir beinahe unbekannt war, so viele Jahre lagen zwischen der ersten Lektüre und dieser zweiten.
Es war völlig neu für mich, und jetzt, da mein Geist bereitet war, verschlang ich den Inhalt dieses ausserordentlichen Buches. Ich hatte noch nie etwas von Swedenborg gelesen, der in seinem und meinem Lande für einen Scharlatan, einen Narren, für unzüchtig galt, und wurde von Bewunderung und Entzücken ergriffen, als ich diesen himmlischen Riesen des vorigen Jahrhunderts durch den Mund des tiefsten der französischen Geister sprechen hörte.
Indem ich mit religiöser Andacht lese, komme ich zu Seite 16, wo der 29. März als Swedenborgs Todestag angegeben ist. Ich halte inne, denke nach und schlage den Kalender auf. Heute ist gerade der 29. März, und ausserdem ist es Palmsonntag.
So offenbarte sich Swedenborg als Zuchtgeist in meinem Leben, in dem er eine grosse Rolle spielen sollte, und brachte mir am Jahrestage seines Todes die Palmen des Siegers oder des Märtyrers!
"Seraphita" wird mein Evangelium und bringt mich wieder in so nahe Verbindung mit dem Jenseits, dass das Leben mich anekelt und ein unwiderstehliches Heimweh mich zum Himmel zieht. Kein Zweifel, ich werde für ein höheres Dasein vorbereitet! Ich verachte die Erde, diese weltliche Welt, diese Menschen und ihre Werke. Ich sehe in mir den Gerechten ohne Schuld, den der Ewige auf die Probe gestellt hat, und den das Fegefeuer dieser Welt einer baldigen Erlösung würdig machen wird.
Dieser Hochmut, den die vertrauliche Stellung zu den Mächten hervorruft, wächst immer dann, wenn meine wissenschaftlichen Untersuchungen gut fortschreiten. So gelingt es mir, Gold zu machen, nach meinen Berechnungen und den Beobachtungen der Metallurgen, und ich glaube es beweisen zu können. Ich sende Proben an einen befreundeten Chemiker nach Rouen.
Er beweist mir das Gegenteil meiner Versicherungen, und ich kann eine Woche nichts darauf antworten. Da blättere ich in der Chemie meines Schutzpatrons Orfila und finde das Geheimnis der Frage.
Diese alte vergessene und verachtete Chemie von 1830 ist das Orakel geworden, das mir im kritischen Augenblick Hilfe bringt. Meine Freunde Orfila und Swedenborg beschützen mich, ermutigen mich, bestrafen mich. Ich sehe sie nicht, aber ich fühle ihre Gegenwart; sie zeigen sich nicht meinem Geist, weder durch Visionen noch durch Halluzinationen, aber die kleinen Ereignisse des Tages, die ich sammle, zeigen, dass sie in die Wechselfälle meines Daseins eingreifen.
Die Geister sind positivistisch geworden wie die gegenwärtige Epoche und begnügen sich nicht mit Visionen. Als Beispiel führe ich dieses Zusammentreffen an, das durch das Wort Koinzidenz nicht zu erklären ist.
Nachdem es mir gelungen war, Goldflecke auf Papier hervorzubringen, suchte ich das Ergebnis im grossen auf trockenem Wege und durch das Feuer zu erzielen. Zweihundert Versuche führten zu nichts, und verzweifelt lege ich das Lötrohr nieder.
Mein Morgenspaziergang führte mich in die Strasse der Sternwarte, wo ich oft die vier Weltteile bewundere, aus dem heimlichen Grunde, weil die lieblichste der Carpeauxschen Frauen meiner Frau gleicht. Sie steht auf der Höhe des Zeichens der Fische unter der Ringkugel, und Sperlinge haben hinter ihrem Rücken ihr Nest gebaut.
Zu Füssen des Denkmals finde ich zwei oval geschnittene Pappstücke: das eine trägt die gedruckte Zahl 207, das andere die Nummer 28. Das bedeutet Blei (Atomgewicht 207) und Silizium (Atomgewicht 28). Ich hebe den glücklichen Fund auf, um ihn für meine chemischen Aufzeichnungen zu bewahren.
Zu Hause beginne ich eine Reihe Versuche mit Blei, indem ich Silizium vorläufig lasse. Da ich aus der Metallurige weiss, dass Blei, in einem mit Knochenasche gefütterten Tiegel, immer etwas Silber gibt, und dieses Silber beständig etwas Gold enthält, sage ich mir, dass der phosphorsaure Kalk, der Hauptbestandteil der Knochenasche, in der Gewinnung des Goldes aus Blei den wesentlichen Faktor ausmachen müsse.
In der Tat färbte sich das Blei, auf einem Bett von phosphorsaurem Kalk geschmolzen, immer goldgelb auf seiner unteren Fläche. Aber der böse Wille der Mächte unterbrach die Vollendung des Versuchs.
Ein Jahr später, als ich zu Lund in Schweden weilte, gab mir ein Bildhauer, der in feineren Töpferwaren arbeitete, eine aus Blei und Silizium zusammengesetzte Glasur, mit deren Hilfe ich zum ersten Mal ein vererztes Gold von vollkommener Schönheit erhalte.
Als ich ihm dankte, zeige ich ihm die beiden Pappstücke mit den Zahlen 207 und 28.
Zufall oder Zusammentreffen in dieser Begebenheit, die sich durch eine unerschütterliche Logik auszeichnet?
Ich wiederhole, von Visionen wurde ich niemals heimgesucht, wohl aber erschienen mir wirkliche Gegenstände unter menschlichen Formen und hatten eine Wirkung, die oft grossartig war.
So fand ich mein Kopfkissen, das durch den Mittagschlaf aus der Form gekommen war, wie ein Marmorkopf im Stil des Michaelangelo modelliert.
Eines Abends, als ich mit dem Doppelgänger des amerikanischen Arztes nach Hause komme, entdecke ich im Halbschatten des Alkoven einen riesenhaften Zeus, der auf meinem Bett ruht. Vor diesem unerwarteten Schauspiel bleibt mein Kamerad stehen, von einem fast religiösen Schrecken erfasst. Als Künstler begreift er sofort die Schönheit der Linien:
—Da ist ja die grosse verschwundene Kunst wiedergeboren! Das ist eine plastische Darstellung zum Zeichen.
Je mehr man sie betrachtet, desto mehr verkörpert sich die lebendige und furchtbare Erscheinung.
Es ist entschieden kein Zufall, da an gewissen Tagen das Kopfkissen hässliche Ungeheuer, gotische Drachen zeigt; eines Nachts, als ich von einem Gelage heimkehre, begrüsst mich der Dämon, der wahrhafte Teufel im Stil des Mittelalters, mit dem Bockskopf. Nie ergriff mich Furcht, es war zu natürlich, aber der Eindruck von etwas Regelwidrigem, gleichsam Übernatürlichem blieb in meiner Seele haften.
Mein Freund, der Bildhauer, den ich als Zeuge herbeirief, zeigte keine Überraschung, sondern lud mich ein, in sein Atelier zu kommen. Dort setzte mich eine Bleistiftzeichnung, die an der Wand hing, durch die Schönheit ihrer Linien in Erstaunen.
—Wo haben Sie das gefunden? Eine Madonna, nicht wahr?
—Eine Madonna von Versailles, nach den Gewächsen gezeichnet, die dort im See der Schweizer schwimmen.
Die Offenbarung einer neuen Kunst nach der Natur! Natürliche Hellsicht! Warum den Naturalismus anspeien, wenn er eine neue Kunst einweiht, die reich an Jugend und Hoffnung ist? Die Götter kehren zurück, und der Alarmruf "Zum Pan!", den Schriftsteller und Künstler ausgestossen haben, hat ein so starkes Echo gefunden, dass die Natur nach einem Schlaf von mehreren Jahrhunderten erwacht ist! Nichts geschieht hier auf Erden, ohne dass die Mächte zustimmen: wenn der Naturalismus war, so sei der Naturalismus und gebäre wieder die Harmonie von Stoff und Geist.
Mein Bildhauer ist ein Seher. Er erzählt mir, dass er Orpheus und Christus in einem Felsen der Bretagne zusammen modelliert gesehen habe, und er fügt hinzu, er beabsichtige dorthin zurückzukehren, um sie als Modelle zu einer Gruppe für den Salon zu benutzen.
Als ich eines Abends die Rue de Rennes hinunterging, mit demselben Seher, blieb er vor dem Schaufenster einer Buchhandlung stehen, in dem kolorierte Lithographien ausgestellt waren. Es waren eine Reihe von Szenen, in denen menschliche Figuren eine Rolle spielten, deren Köpfe durch Stiefmütterchen ersetzt waren. Obwohl Beobachter der Pflanzenwelt, hatte ich noch nie bemerkt, dass das Stiefmütterchen dem Gesicht des Menschen ähnlich ist. Mein Kamerad kann sich von seinem doppelten Erstaunen kaum erholen.
—Stellen Sie sich vor; als ich gestern abend nach Hause komme, blickten mich die Stiefmütterchen in meinem Fenster auf eine Art an, die mich entnervte, und plötzlich sah ich ebenso viel menschliche Gesichter. Ich hielt es für eine Illusion, die von meiner Nervosität kam. Und heute finde ich dasselbe im Druck auf einem alten Stich wieder: es ist also keine Illusion, sondern eine Wirklichkeit, da ein unbekannter Künstler dieselbe Entdeckung vor mir gemacht hat.
Wir machen Fortschritte in unserm Sehen, und nun sehe ich Napoleon und seine Marschälle auf der Kuppel des Invalidendoms.
Wenn man von Montparnasse in den Boulevard des Invalides kommt, erscheint über der Rue Oudinot die Kuppel, beim Untergang der Sonne in ihrem ganzen Glanz, und die Konsolen und andern Ausladungen des Treppenhauses, der den Dom trägt, nehmen die Form menschlicher Figuren an, die wechseln, je nachdem der Gesichtspunkt näher oder entfernter ist. Napoleon ist dort, Bernadotte, Berthier, und mein Freund zeichnet sie "nach der Natur".
—Wie wollen Sie diese Erscheinung erklären?
—Erklären? Hat man jemals etwas anders erklärt, als indem man eine Menge Worte durch eine andere Menge Worte umschreibt?
—Sie glauben als nicht, dass der Baumeister nach einer halbbewussten Leitung seines Geistes gearbeitet hat?
—Hören Sie, lieber Freund: Jules Mansard, der den Dom 1706 baute, konnte doch unmöglich die Silhouette des Napoleon voraussehen, der 1769 geboren wurde.... Genügt das?
Zuweilen habe ich in der Nacht Träume, die mir die Zukunft voraussagen, mich gegen Gefahren sichern, mir Geheimnisse enthüllen. So erscheint mir ein längst verstorbener Freund im Traum und bringt ein Geldstück von ungewöhnlicher Grösse. Ich frage ihn nach dem Ursprung dieses ausserordentlichen Geldstücks; er antwortet: Amerika, und verschwindet mit dem Schatz.
Am nächsten Tage erhalte ich einen Brief mit amerikanischer Marke; er ist von einem Freund, den ich seit zwanzig Jahren nicht gesehen habe, und teilt mir mit, der Auftrag, eine Schrift für die Ausstellung von Chikago zu verfassen, habe mich vergeblich in ganz Europa gesucht. Es handelt sich um ein Honorar von 12 000 Francs, eine ungeheure Summe für meine damalige verzweifelte Lage, das mir entgangen war. Dies 12 000 Francs hätten meine Zukunft gesichert! Aber kein anderer als ich hat gewusst, dass der Verlust dieses Geldes mir als Züchtigung auferlegt war für eine schlechte Handlung, die ich im Zorn über die Treulosigkeit eines literarischen Mitbewerbers begangen hatte.
Ein anderer Traum von weiterer Tragweite liess mich Jonas Lie sehen, wie er eine Pendeluhr aus vergoldeter Bronze mit ungewöhnlichen Verziehrungen trägt.
Als ich einige Tage später den Boulevard Saint-Michel hinunterging, zog das Schaufenster eines Uhrmachers meine Aufmerksamkeit auf sich.
—Da ist die Uhr des Jonas Lie, rief ich aus. Wahrhaftig, es war dieselbe. Von einer Himmelskugel, an die sich zwei Frauen lehnen, gekrönt, ruht das Räderwerk auf vier Säulen. In der Kugel war ein Datumzeiger angebracht, der den dreizehnten August anzeigte.
In einem nächsten Kapitel werde ich erzählen, wie verhängnisvoll dieses Datum des dreizehnten August für mich wurde.
Diese kleinen Vorfälle und viele andere ereigneten sich während meines Aufenthaltes im Hotel Orfila zwischen dem 6. Februar und dem 19. Juli 1896.
Parallel mit diesen Vorfällen und mitten in ihnen rollte sich in Abständen das folgende Abenteuer ab, das auf meine Austreibung aus dem Hotel hinauslief und eine neue Epoche meines Lebens einleitete.
Der Frühling ist gekommen; das Tal der Tränen, das sich unter meinem Fenster ausbreitet, grünt und blüht. Der grüne Rasen bedeckt den Boden und verbirgt den Schmutz: die Gehenna hat sich in das Tal von Saron verwandelt, wo ausser den Lilien, Flieder, Robinien, Paulownien blühen.
Ich bin betrübt, bis zum Tode, aber das heitere Lachen der jungen Mädchen, die dort unten unsichtbar unter den Bäumen spielen, trifft mich ins Herz und erweckt mich wieder zum Leben. Das Leben verrinnt und das Alter naht: Weib, Kinder, Häuslichkeit, alles verheert; Herbst innen, Frühling draussen.
Das Buch Hiob und die Klagelieder Jeremiae trösten mich, weil eine Übereinstimmung zwischen dem Lose Hiobs und meinem vorhanden ist. Bin ich nicht mit bösen Schwären geschlagen; drückt mich die Armut nicht zu Boden; haben meine Freunde mich nicht verlassen?
"Ich gehe schwarz einher, und brennet mich doch keine Sonne nicht, ich bin ein Bruder der Schakale und ein Geselle der Strausse. Meine Haut über mir ist schwarz geworden, und meine Gebeine sind verdorret vor Hitze. Meine Harfe ist eine Klage geworden, und meine Flöte ein Weinen."
So Hiob. Und Jeremias drückt in zwei Worten den Abgrund meiner Traurigkeit aus: "Ich habe fast vergessen, was Glück ist."
In dieser Gemütsverfassung sitze ich an einem drückenden Nachmittag bei meiner Arbeit, als ich unter meinem Fenster hinter den Laubbäumen des Tales die Töne eines Klaviers höre. Ich spitze die Ohren, wie das Streitross beim Klang der Trompete; ich richte mich auf und sammle mich; ich atme tief. Das ist der "Aufschwung" von Schumann. Und noch mehr, er spielt! Es ist mein Freund, der Russe, mein Schüler, der mich "Vater" nannte, weil er alles von mir gelernt hatte; mein Famulus, der mich Meister nannte und mir die Hände küsste, weil sein Leben begann, wo das meine endete. Er ist von Berlin nach Paris gekommen, um mich zu töten, wie er mich in Berlin getötet hat. Und warum?... Weil das Schicksal gewollt hat, dass seine jetzige Gattin, bevor er sie kennen lernte, meine Geliebte gewesen ist. War es meine Schuld, dass es sich so gefügt hatte? Sicher nicht, und dennoch fasste er einen tödlichen Hass auf mich, verleumdete mich, verhinderte die Annahme meiner Dramen, zettelte Intrigen an, die mir die für meine Existenz notwendigen Einkünfte raubten. In einem Anfall von Wut traf ich ihn damals mitten in die Brust, freilich auf eine so rohe und feige Art, dass ich darunter litt, als hätte ich einen Meuchelmord begangen. Dass er jetzt gekommen ist, um mich zu töten, tröstet mich, denn der Tod allein kann mich von der Gewissenqual befreien.
Es war wohl auch er, der mich durch die falsch adressierten Briefe beunruhigte, die ich dort unten beim Portier sah. Er schlage zu! Ich wird mich nicht verteidigen, wie er recht hat und mir das Leben nichts mehr gilt.
Er spielt immer den "Aufschwung", wie nur er ihn zu spielen versteht, unsichtbar hinter der Mauer aus Grün. Er sendet die magischen Harmonien über blühende Firste empor, dass ich sie zu sehen glaube wie Schmetterlinge, die in der Sonne flattern.
Warum spielt er? Um mir seine Ankunft zu melden, um ich zu erschrecken und mich in die Flucht zu jagen!
Vielleicht erfahre ich es in der Cremerie, wo die andern Russen schon lange die Ankunft ihres Landsmannes angekündigt haben. Ich begebe mich am Abend dorthin, um zu essen, und schon in der Tür zerkratzen mir feindliche Blicke das Gesicht. Von meinem Streit mit dem Russen unterrichtet, haben alle Tischgenossen sich gegen mich verbunden. Um sie zu entwaffnen eröffne ich selbst das Feuer:
—Popoffsky ist in Paris? sage ich fragend.
—Nein, noch nicht! Antwortet mir einer.
—Doch, bestätigt ein andrer, man hat ihn beim Mercure de France gesehen.
Einer widerspricht dem Andern, und ich bin schliesslich ebenso klug wie vorher, stelle mich jedoch so, als glaube ich alles, was man mir erzählt. Die allzu deutliche Feindseligkeit liess mich den Schwur tun, die Cremerie zu meiden; zu meinem Bedauern, denn einige Menschen waren mir wirklich sympathisch geworden. Von neuem durch diesen verwünschten Feind in die Einsamkeit getrieben, werde ich gegen ihn eingenommen und der Hass setzt mir zu und macht mich böse. Ich verzichte auf den Tod! Ich will nicht von der Hand des Mannes fallen, der meiner nicht wert ist: die Demütigung wäre zu tief für mich, die Ehre zu gross für ihn. Ich will kämpfen, mich verteidigen.
Um mir die Sache vom Herzen zu schaffen, begebe ich mich in die Rue de la Santé hinter Val-de-Grâce, um einen dänischen Maler, einen intimen Freund Popoffskys, zu besuchen. Dieser Mann, einst mein Freund, war vor sechs Wochen nach Paris gekommen und hatte mich, als ich ihn auf der Strasse traf, wie einen Fremden, fast wie einen Feind begrüsst. Am nächsten Tage dagegen machte er mir einen Besuch, lud mich in sein Atelier ein und sagte mir zu viele Artigkeiten, um nicht den Eindruck eines falschen Freundes auf mich zu machen. Als ich ihn fragte, ob er etwas Neues von Popoffsky gehört habe, verschanzte er sich hinter Ausflüchten, bestätigte aber die Neuigkeit, dass er bald nach Paris kommen werde.
—Um mich zu ermorden! ergänzte ich.
—Gewiss! Nehmen Sie sich in acht!
Als ich eines Morgens die Tür zu dem Hause meines Dänen öffnete, um seinen Besuch zu erwidern, lag—welcher Zufall!—eine dänische Dogge von riesiger Grösse und ungeheuerlichem Aussehen auf dem Pflaster des Hofes und versperrte mir den Weg. Mit einer instinktiven, aber entschiedenen Bewegung ging ich augenblicklich wieder auf die Strasse hinaus und kehrte auf meinen Spuren um, den Mächten dankend, dass sie mich gewarnt hatte; so überzeugt war ich, dass ich einer unbekannten Gefahr entronnen sei.
Als ich einige Tage später meinen Besuch wiederholen wollte, sass auf der Schwelle der offenen Tür ein Kind, das eine Spielkarte in der Hand hatte. Mit hellseherischem Aberglauben warf ich einen Blick auf die Karte. Es war die Pik zehn!
—Man treib ein hässliches Spiel in diesem Hause. Und ich zog mich zurück, ohne einzutreten.
Aber heute abend nach der Szene in der Cremerie war ich fest entschlossen, Cerberus und Pik zu trotzen; doch das Schicksal widersetzte sich dem: ich traf meinen Mann in der Brasserie des Lilas. Er war entzückt mich zu sehen, und wir setzten uns auf der Terrasse an einen Tisch.
Indem er unsere gemeinsame Berliner Erinnerungen durchging, fiel er in seine alte Rolle des guten Kameraden zurück, begeisterte sich an seinen eigenen Erzählungen, vergass die kleinen Uneinigkeiten und gestand Tatsachen ein, die er öffentlich geleugnet hätte.
Plötzlich schien er sich an seine Pflicht oder an gegebene Versprechungen zu erinnern: er wird stumm, kalt, feindlich, als ärgere er sich, dass er sich habe aushorchen lassen.
Als ich direkt frage, ob Popoffsky in Paris sei, antwortete er ein so schroffes Nein, dass die Lüge mir offenbar erschien, und wir trennten uns.
Hier ist zu beachten, dass dieser Däne vor mir der Geliebte der Frau Popoffsky gewesen war und mir noch immer grollte, dass seine Geliebte ihn für mich verlassen hatte. Jetzt spiele er die Rolle eines Hausfreundes, obwohl Popoffsky genau wusste, in welchen Beziehungen seine Frau zu dem schönen Heinrich gestanden hatte.
Der "Aufschwung" von Schumann klingt über die dicht belaubten Bäume, aber der Musiker bleibt unsichtbar, und ich weiss nicht, wo er sich befindet. Einen ganzen Monat dauert die Musik, jeden Abend von vier bis fünf Uhr.
Als ich eines Morgens die Rue de Fleurus hinuntergehe, um mich am Anblick meines Regenbogens beim Färber zu stärken, trete ich in den Luxemburggarten ein, der jetzt in voller Blüte steht und schön wie ein Feenmärchen ist, und finde auf der Erde zwei trockene Zweige, die der Wind abgebrochen hat. Sie bilden zwei griechische Buchstaben P und y. Ich hob sie auf und die Verbindung P—y, die Abkürzung von Popoffsky, entstand in meinem Hirn. Er verfolgte mich also, und die Mächte wollten mich gegen die Gefahr sichern. Unruhe erfasste mich, trotzdem der Unsichtbar mir dieses günstige Zeichen gab. Ich rufe den Schutz der Vorsehung an, ich lese die Psalmen Davids gegen seine Feinde; ich hasse meinen Feind mit dem religiösen Hass des Alten Testaments, habe aber zugleich nicht mehr den Mut, mich der Mittel der schwarzen Magie zu bedienen, die ich eben studiert habe.
"Ewiger, mach dich auf, mir zu helfen! Sprich zu meiner Seele: ich bin deine Hilfe. Es müssen sich schämen und gehöhnet werden, die nach meiner Seele stehen; es müssen zurückkehren und zu Schanden werden, die mir übel wollen.... Sie müssen sich schämen und zu Schanden werden alle, die sich meines Übels freuen."
Dieses Gebet schien mir damals gerecht zu sein, und die Barmherzigkeit des Neuen Testaments kam mir wie eine Feigheit vor.
Zu welchem Unbekannten nahm meine ruchlose Anrufung ihren Flug? Ich wüsste es nicht zu sagen; aber der Verlauf dieses Abenteuers wird wenigstens zeigen, dass der Wunsch erfüllt wurde.
13. Mai.—Ein Brief von meiner Frau. Durch die Zeitungen hat sie erfahren, dass ein Herr S. im Ballon zum Nordpol fahren will: sie stösst einen Schrei der Angst aus, gesteht mir ihre unveränderliche Liebe und fleht mich an, auf einen Plan zu verzichten, der Selbstmord bedeute.
Ich kläre sie über ihren Irrtum auf: es ist der Sohn eines Vetters von mir, der sein Leben für eine grosse wissenschaftliche Entdeckung wagt.
14. Mai.—In der letzten Nacht habe ich einen Traum gehabt. Ein abgehauener Kopf war dem Rumpf eines Menschen angepasst, der wie ein durch Trunksucht heruntergekommener Schauspieler aussah. Der Kopf fing an zu sprechen: ich hatte Furcht und stiess meinen Bettschirm um, einen Russen vor mir herschiebend, um mich gegen den Angriff des rasenden Mannes zu schützen.
In dieser selben Nacht sticht eine Mücke mich, und ich töte sie. Am Morgen ist die Fläche der rechten Hand mit Blut bespritzt.
Als ich auf dem Boulevard Port-Royal spazieren gehe, sehe ich eine Blutlache auf dem Trottoir.
Sperlinge haben ihr Nest im Rauchfang gebaut. Sie zwitschern artig, als bewohnten sie mein Zimmer.
17. Mai und folgende Tage.—Der Absinth um sechs Uhr auf der Terrasse der Brasserie des Lilas, hinter dem Marschall Ney, ist mein einziges Laster, meine letzte Freude geworden. Wenn die Arbeit des Tages beendet ist, wenn Seele und Körper erschöpft sind, erhole ich mich am Busen des grünen Getränks, mit einer Zigarette, dem Temps und den Debats.
Wie lieblich ist das Leben, wenn der Nebel eines gelinden Rausches seinen Schleier über das Elend des Daseins zieht. Wahrscheinlich neiden mir die Mächte diese Stunde eingebildeter Seligkeit zwischen sechs und sieben Uhr, denn von diesem Abend an wird das Glück von einer Reihe Verdriesslichkeiten gestört, die ich nicht dem Zufall zuschreiben kann.
Am 17. Mai also ist mein Platz, den ich seit zwei Jahren einnehme, besetzt; und alle andern ebenfalls. Ich muss in ein anderes Café gehen, was mich mehr betrübt, als ich sagen kann.
18. Mai.—Meine schöne Ecke in den Lilas ist frei; ich bin zufrieden, selbst glücklich, unter meiner Kastanie hinter dem Marschall Ney. Der Absinth ist da, richtig mit Wasser gemischt, die Zigarette ist angesteckt, der Temps entfaltet....
Da geht ein Betrunkener vorbei, dessen widriges und hässliches Aussehen mich quält, da er mich mit einem tückischen und verächtlichen Blick ausforscht. Das Gesicht ist weinrot, die Nase preussischblau, die Augen boshaft. Ich will meinen Absinth kosten, glücklich, dass ich nicht so aussehe wie dieser Trinker ... aber, ich weiss noch heute nicht wie, mein Glas ist umgekehrt und leer. Da ich wenig Geld habe, kann ich keinen andern bestellen; ich zahle, stehe auf und verlasse das Café, überzeugt, dass der böse Geist mich behext hat.
19. Mai.—Ich wage es nicht ins Café zu gehen.
20. Mai.—Wie ich das Café umschleiche, finde ich meine Ecke frei. Man muss gegen den bösen Geist kämpfen, und ich nehme den Kampf auf. Der Absinth ist bereitet, die Zigarette hat Zug, der Temps berichtet grosse Neuigkeiten. In diesem Augenblick—glaube mir, Leser, es ist wahr—bricht im Hause des Cafés, über mir ein Schornsteinbrand aus. Allgemeine Panik. Ich bleibe sitzen, aber ein Wille, der stärker ist als ich, lässt eine Wolke Russ fallen und lenkt sie so gut, dass zwei Flocken sich in mein Glas legen. Aus der Fassung gebracht, gehe ich, immer aber noch ungläubig und zweifelnd.
1. Juni.—Nach einer langen Enthaltsamkeit werde ich von neuem durch den Wunsch erfasst, mich unter der Kastanie zu trösten. Mein Tisch ist besetzt, und ich nehme einen andern, der allein steht und ruhig ist. Man muss gegen den bösen Geist kämpfen.... Da kommt eine Familie Kleinbürger und setzt sich an den Nebentisch; die Mitglieder dieser Familie sind nicht zu zählen, und immer neue Verstärkungen langen an. Frauen stossen an meinen Stuhl, Kinder verrichten ihre kleinen Geschäfte vor meinen Augen, junge Leute nehmen mir die Streichhölzchen, ohne um Entschuldigung zu bitten. Umringt von dieser lärmenden, unverschämten Menge, will ich doch nicht vom Platze weichen. Da folgt ein Auftritt, der ohne Zweifel durch geschickte und unsichtbare Hände in Szene gesetzt ist, denn er gelang zu gut, als dass ich ihn einer Intrige dieser Leute zuschreiben könnte, die mich gar nicht kennen.
Ein junger Mann legt mit einer Gebärde, die ich nicht begreife, einen Sou auf meinen Tisch, Fremd und allein unter so vielen Leuten, wage ich mich nicht zu sträuben. Aber von Zorn geblendet, suche ich mir klar zu machen, was sich zugetragen hat.
—Er gibt mir einen Sou wie einem Bettler. Bettler! Das ist der Dolch, den ich mir in die Brust stosse. Bettler! Ja, denn du verdienst nichts und du....
Der Kellner kommt und bietet mir einen bequemeren Platz an. Den Sou lasse ich auf dem Tisch liegen. Der Kellner bringt ihn mir nach—welche Beschimpfung!—und sagt mir höflich, der junge Mann habe ihn unter meinem Tisch gefunden und glaube, er gehört mir.
Ich schämte mich und um meinen Zorn zu dämpfen, bestelle ich einen zweiten Absinth.
Der Absinth ist serviert, und alles ist gut, als ein ekelhafter Geruch nach Schwefelammonium mich erstickt.
Was war das wieder? Etwas ganz Natürliches, durchaus kein Wunder, nicht die Spur einer bösen Absicht ... die Öffnung einer Kloake klafft am Rande des Trottoirs, wo mein Stuhl steht.
Jetzt erst fange ich an zu begreifen, dass gute Geister mich von einem Laster befreien wollen, das mich ins Irrenhaus bringen kann! Gesegnet sei die Vorsehung, dass sie mich gerettet hat.
25. Mai.—Trotz der Hausordnung des Hotels, die Frauen ausschliesst, ist eine Familie auf der Seite meines Zimmers eingezogen. Ein Säugling, der Tag und Nacht schreit, macht mir wirklich Vergnügen, denn er erinnert mich an die gute alte Zeit, an das blühende Leben zwischen dreissig und vierzig.
26. Mai.—Die Familie zankt sich! Das Kind heult! Wie sich doch alles gleich ist! Und wie süss dies—jetzt—für mich ist.
Heute abend habe ich die englische Dame wieder gesehen. Sie war reizend und lächelte mich mit einem guten mütterlichen Lächeln an. Sie hat eine Serpentinentänzerin gemalt, die einer Nuss oder einem Gehirn gleicht. Das Bild hängt, ziemlich versteckt, hinter dem Büffet der Madame Charlotte in der Cremerie.
29. Mai.—Ein Brief meiner Kinder aus erster Ehe meldet mir, eine Depesche habe sie eingeladen, nach Stockholm zu kommen, um dort dem Abschiedsfest beizuwohnen, das mir gegeben werde, bevor ich im Ballon zum Nordpol aufsteige. Sie können das nicht begreifen, und ich auch nicht. Welch unseliger Irrtum!
Die Zeitungen berichten das Unglück von Saint-Louis (Saint-Louis!) in Amerika, wo ein Zyklon tausend Menschen getötet hat.
2. Juni.—In der Strasse der Sternwarte fand ich zwei Kieselsteine, die genau die Form von Herzen haben. Abends fand ich im Garten eines russischen Malers den dritten, von derselben Grösse wie die andern und ihnen ganz gleich.
Der "Aufschwung" von Schumann hat aufgehört, und ich bin wieder ruhig.
7. Juni.—Ich besuche den dänischen Maler in der Rue de la Santé. Der grosse Hund ist verschwunden, der Eintritt ist frei. Wir speisen auf einer Terrasse des Boulevard Port-Royal. Mein Freund friert und fühlt sich nicht wohl; da er seinen Überzieher vergessen hat, lege ich ihm meinen über die Schultern. Zuerst beruhigt ihn das: er fügt sich mir und ich beherrsche ihn. Er wagt sich nicht mehr zu empören: wir sind in allen Punkten einig; er gesteht mir, dass Popoffsky ein Übeltäter sei, und das ich ihm mein Unglück zu verdanken habe. Auf einmal wird er nervös, zittert wie ein Medium unter dem Einfluss des Hypnotiseurs: wird aufgeregt, schüttelt den Überzieher ab; hört auf zu essen, wirft seine Gabel hin, erhebt sich gibt mir meinen Überzieher wieder und sagt mir adieu.
Was war das? Das Nessusgewand! Hat sich mein Nervenfluidum in dem Mantel aufgespeichert und durch seine fremdartige Polarität ihn unterjocht? Das muss es sein, was Hesekiel Kapitel 13 Vers 18 sagen will:
"So spricht der Herr, HErr: Weh euch, die ihr Kissen machet den Leuten unter die Arme und Pfühle zu den Häuptern, beide, Jungen und Alten, die Seelen zu fahen ... ich will die Kissen von euern Armen wegreissen, und die Seelen, so ihr fahet und vertröstet, losmachen."
Bin ich ein Zauberer geworden, ohne dass ich es weiss?
9. Juni.—Ich besuchte meinen dänischen Freund, um mir seine Bilder anzusehen. Als ich kam, war er gesund und munter, nach einer halben Stunde aber bekam er einen solchen Nervenanfall, dass er sich ausziehen und zu Bett legen musste.
Was hatte er? War es das schlechte Gewissen?
14. Juni. Sonntag.—Ich finde einen vierten Kiesel in Herzform, dieses Mal im Luxemburggarten, aber von derselben Art wie die früheren. Am Stein klebt etwas goldgelber Flitter. Ich begreife das Rätsel nicht, ahne aber eine Voraussage. Ich vergleiche die vier Kiesel vor dem offenen Fenster, als die Glocken von Saint-Sulpice zu läuten beginnen; dann kommt der grobe Brummbass von Notre-Dame, und durch dieses gewöhnliche Läuten dringt ein dumpfes feierliches Rollen, als komme es aus den Eingeweiden der Erde.
Den Diener, der mir die Post bringt, frage ich, was das bedeutet.
—Das ist die grosse Savoyade von Sacre Coeur de Montmartre.
—Es ist also das Fest des heiligen Herzens?
Und ich betrachte meine vier Herzen aus hartem Stein, ein wenig gepackt von diesem auffallenden Zusammentreffen.
Ich höre dem Kuckuck aus der Richtung der Kirche Notre-Dame-des-Champs, und das ist doch unmöglich; meine Ohren müssten denn so überempfindlich geworden sein, dass sie Töne aus dem Wald von Medon wahrnehmen.
15. Juni.—Ich steige nach Paris hinab, um einen Scheck in Papier und Gold zu verwandeln. Der Quai Voltaire schwankt unter meinen Füssen; das setzt mich in Erstaunen, obwohl ich sehr wohl weiss, dass die Brücke du Caroussel unter dem Gewicht der Wagen erzittert. Aber heute morgen setzt sich die Bewegung bis in den Hof der Tuilerien und in die Opernstrasse fort. Eine Stadt zittert wohl immer, um es aber zu fühlen, muss man geschärfte Nerven haben.
Die andere Seite des Flusses ist für uns andere vom Montparnasse ein fremdes Land. Ein Jahr fast ist vergangen, seit ich dem Credit Lyonnais oder dem Café de la Régence meinen letzten Besuch machte. Auf dem Boulevard des Italiens erfasst mich Heimweh, und ich eile zum andern Ufer zurück, wo der Anblick der Rue des Saint-Pères mich tröstet.
In der Nähe der Kirche Saint-Germain-des-Pres treffe ich einen Leichenwagen, dann zwei kolossale Madonnen, die auf einem Wagen fortgeschafft werden. Die eine von ihnen, die auf den Knien liegt, die Hände faltet und die Blicke zum Himmel erhebt, macht einen starken Eindruck auf mich.
16. Juni.—Auf dem Boulevard Saint-Michel kaufe ich einen Briefbeschwerer aus Marmor; er ist mit einer Glaskugel geschmückt, welche die Madonna von Lourdes enthält, im Rahmen ihrer berühmten Grotte; vor ihr liegt eine verschleierte Dame auf den Knien. Ich stelle das Bild in die Sonne, und die wirft wunderbare Schatten auf die Wand. Auf der Rückseite der Grotte hat der Gips durch einen Zufall, den der Künstler nicht vorausgesehen hat, einen Christuskopf geformt.
18. Juni.—Der dänische Freund tritt bestürzt und am ganzen Körper zitternd in mein Zimmer. Popoffsky ist unter dem Verdacht, eine Frau und zwei Kinder, seine Geliebte und seine beiden ehelichen Kinder, ermordet zu haben, in Berlin verhaftet worden. Als die erste Überraschung vergangen ist und das aufrichtige Mitleid mit einem Freund, der mir, trotz allem, soviel Eifer erwiesen hat, sich legt, breitet sich eine tiefe Ruhe über meinen Geist, den seit mehreren Monaten bevorstehende Drohungen gefoltert haben.
Unfähig, meinen gerechten Egoismus zu verheimlichen, lasse ich meinen Gefühlen freien Lauf:
—Es ist schrecklich, und doch erleichtert es mich, wenn ich an die Gefahr denke, der ich eben entgangen bin.
—Was hat ihn zu dem Verbrechen getrieben?
—Vielleicht war die legitime Gattin auf die illegitime Geliebte eifersüchtig; auch die Kosten, die diese verursachte, können mitgewirkt haben. Vielleicht auch....
—Was?
—Vielleicht haben seine blutdürstigen Triebe, die neulich hier in Paris keine Befriedigung fanden, einen andern Ausweg gesucht, gleichviel welchen.
In mir selber frage ich: ist es möglich, dass meine glühenden Gebete den Dolch abgelenkt haben, der nun durch meinen Gegenstoss den Mörder mitten ins Herz getroffen hat?
Ich forsche nicht weiter, sondern schlage, edelmütig wie ein Sieger vor:
—Retten wir unsern Freund wenigstens literarisch. Ich werde einen Aufsatz über seine schriftstellerischen Verdienste schreiben: Sie zeichnen ein sympathisches Porträt, und beides bieten wir der "Revue blanche" an.
Im Atelier des Dänen—der Hund bewacht es nicht mehr!—betrachten wir ein Porträt Popoffskys, das vor mehr als zwei Jahren gemalt ist. Es ist nur der Kopf, durch eine Wolke abgeschnitten, und darunter Totenknochen, wie man sie auf Grabtafeln sieht. Der abgeschnittene Kopf macht uns schaudern, und mein Traum vom dreizehnten Mai bedrückt mich wie ein Gespenst.
—Wie sind sie auf den Gedanken dieser Enthauptung gekommen?
—Schwer zu sagen, aber es ruhte ein Verhängnis auf diesem feinen Geist: er besass Spuren von entschiedenem Genie und trachtete nach dem höchsten Ruhm, ohne aber den Preis dafür zahlen zu wollen. Das Leben lässt uns nur die Wahl: entweder der Lorbeer oder die Sinnenlust.
—Sie haben das endlich auch entdeckt?
23. Juni.—Ich habe eine Nadel aus unechtem Gold mit einer falschen Perle gefunden. Aus dem Bad der Goldsynthese habe ich ein Herz aus Gold gefischt.
Als ich am Abend durch die Rue du Luxembourg gehe, sehe ich im Hintergrund der ersten Allee rechts, über den Bäumen, eine Hirschkuh am Himmel gezeichnet. Ich bewundere sie, so schön ist sie in der Form wie in der Farbe, und sie gibt mir ein Zeichen mit dem Kopf, in der Richtung nach Südost (Donau)!
Diese letzten Tage nach der Katastrophe des Russen hat mich eine neue Unruhe ergriffen. Es kommt mir vor, als beschäftige man sich irgendwo mit mir, und ich vertraue dem dänischen Maler an, dass der Hass des gefangenen Russen mich wie unter dem Fluidum einer Elektrisiermaschine leiden lässt.
Es gibt Augenblicke, in denen ich ahne, dass mein Aufenthalt in Paris bald ein Ende nehmen wird und eine neue Peripetie mich erwartet.
Der Hahn auf dem Kreuz von Notre-Dame-des-Champs scheint mir mit den Flügeln zu schlagen, als wolle er in nördlicher Richtung davonfliegen.
Im Vorgefühl meiner bevorstehenden Abreise beeile ich mich meine Studien im Jardin des Plantes zu vollenden.
Eine Zinkwanne, in der ich Goldsynthesen auf feuchtem Wege vornehme, zeigt an den innern Seiten eine Landschaft, die durch die verdunsteten Eisensalze gebildet ist. Ich deute sie als ein Vorzeichen, aber ich bemühe mich vergeblich zu ahnen wo diese ausserordentliche Landschaft liegen wird. Mit Nadelbäumen, vor allem mit Fichten, bewaldete Hügel; zwischen den Höhen Ebenen mit Obstbäumen, Kornfeldern; alles weist auf die Nachbarschaft eines Flusses. Ein Hügel, mit Abgründen von schlichtenförmiger Formation, ist mit den Ruinen einer starken Burg gekrönt.
Ich finde mich noch nicht zurecht, aber ich werde es über ein Kleines tun.
25. Juni.—Bei dem Haupt des wissenschaftlichen Okkultismus, dem Herausgeber der "Initiation", eingeladen. Als wir, der Doktor und ich, in Marcolles en Brie ankommen, werden wir von drei schlechten Neuigkeiten empfangen. Ein Wiesel hat die Enten getötet, ein Kindermädchen ist erkrankt, die dritte ist mir entfallen.
Als ich am Abend nach Paris zurückkehre, lese ich in einer Zeitung die so berühmt gewordene Geschichte von dem Gespensterhaus in Valence en Brie.
Brie? Sehr argwöhnisch fürchte ich, dass bei den Bewohnern des Hotels mein Ausflug nach Brie Verdacht erregt; dass man mich beschuldigt, diesen Schwindel oder besser diese Hexerei durch meine alchemistischen Kenntnisse vorbereitet zu haben.
Ich habe mir einen Rosenkranz gekauft. Warum? Er ist schön und der böse Geist fürchtet das Kreuz. Übrigens erkläre ich mir nicht mehr die Gründe meiner Handlungen. Ich handle, wie es kommt: das Leben ist lustiger auf diese Weise!
In der Sache Popoffsky zeigt sich ein Umschwung. Sein Freund, der Däne, beginnt die Wahrscheinlichkeit des Verbrechens zu widerlegen, unter dem Vorwand, die Untersuchung habe den Verdacht als falsch erwiesen. Auch unser Artikel ist aufgeschoben, und die alte Kälte tritt wieder ein. Gleichzeitig erscheint auch das Untier von Hund wieder: ein Wink für mich, auf meiner Hut zu sein.
Als ich am Nachmittag an meinem Tisch, der vor dem Fenster steht, schreibe, bricht ein Gewitter aus. Die ersten Regentropfen fallen auf mein Manuskript und besudeln es so, dass die Buchstaben, die das Wort "Alp" bilden, auslaufen und einen Tintenklecks zeichnen, der dem Gesicht eines Riesen gleicht. Ich hebe diese Zeichnung auf; sie ist dem Donnergott der Japaner ähnlich, wie er in Flammarions "Athmosphäre" abgebildet ist.
28. Juni.—Ich habe meine Frau im Traum gesehen; es fehlten ihr die Vorderzähne; sie gab mir eine Guitarre, die den Donaubooten glich.
Derselbe Traum drohte mir mit Gefängnis.
Heute morgen fand ich in der Rue d'Assas ein Stück Papier in den Farben des Regenbogens.
Heute nachmittag zerrieb ich Quecksilber, Zinn, Schwefel, Chlorammonium auf einer Pappe. Als ich die Masse ablöste, behielt die Pappe den Abdruck eines Gesichts, das dem meiner Frau gleich war, wie ich es in der vergangenen Nacht im Traum gesehen hatte.
1. Juli.—Ich erwarte einen Ausbruch, ein Erdbeben, einen Blitzschlag, ohne zu wissen, von welcher Seite. Nervös wie ein Pferd beim Nahen der Wölfe, wittere ich die Gefahr, packe meine Koffer für die Flucht, ohne mich indessen rühren zu können.
Der Russe ist aus Mangel an Beweisen aus dem Gefängnis entlassen: sein Freund, der Däne, ist mein Feind geworden. Die Gesellschaft der Cremerie plagt mich. Das letzte Mittagessen wurde wegen der Hitze im Hof aufgetragen: der Tisch war zwischen dem Müllkasten und den Abtritten aufgestellt. Über dem Müllkasten ist das Bild meines alten Freundes, des Amerikaners, aufgehängt, aus Rache, weil der Künstler auf und davon gegangen ist, ohne zu bezahlen, was er schuldig war. Neben dem Tisch haben die Russen eine Statuette aufgestellt: einen Krieger, der mit der traditionellen Sense bewaffnet ist. Um mir Furcht zu machen! Ein junger Bursche des Hauses geht hinter meinem Rücken in der deutlichen Absicht mich zu ärgern, auf den Abtritt. Der Hof, eng wie ein Schacht, erlaubt der Sonne nicht, die hohen Wände zu überschreiten. Die fast in allen Etagen wohnenden Kokotten haben ihre Fenster geöffnet und lassen einen Hagel von Zoten auf unsere Köpfe niederprasseln; die Hausmädchen kommen mit den Mülleimern und leeren sie in den Müllkasten.—Das ist die Hölle! Und meine beiden Nachbarn, notorische Päderasten, unterhalten ein widerwärtiges Gespräch, um mit mir Händel zu suchen.
Warum bin ich hier? Die Einsamkeit zwingt mich, menschliche Wesen aufzusuchen, menschliche Stimmen zu hören.
Da, als meine seelischen Qualen den höchsten Grad erreichen, entdecke ich einige Stiefmütterchen, die auf einer schmalen Rabatte blühen. Sie schütteln die Köpfchen, als wollten sie mir eine Gefahr anzeigen, und eins von ihnen, mit einem Kindergesicht mit grossen, tiefen, leuchtenden Augen, gibt mir ein Zeichen:
—Geh fort!
Ich erhebe mich und zahle; als ich hinausgehe, grüsst mich der Bursche mit versteckten Beschimpfungen, die mein Herz in Wallung bringen, ohne meinen Zorn zu erregen.
Ich empfinde Mitleid mit mir selber und schäme mich für die andern.
Ich verzeihe den Schuldigen, indem ich sie als Dämonen betrachte, die nur ihre Pflicht erfüllen.
Doch ist die Ungnade der Vorsehung gar zu deutlich, und, sobald ich ins Hotel zurückgekehrt bin, beginne ich mein Kredit und Debet aufzustellen. Bisher, und das war meine Stärke, habe ich mich nicht beugen können, den andern recht zu geben, jetzt aber, durch die Hand des Unsichtbaren zu Boden geschlagen, versuche ich, mir unrecht zu geben, und wie ich mein Betragen während der letzten Wochen gründlich untersuche, ergreift mich Furcht. Mein Gewissen sagt mir die Wahrheit, rückhaltlos und unerbittlich.
Ich habe aus Hochmut, Hybris, gesündigt, dem einzigen Laster, das die Götter nicht verzeihen. Durch die Freundschaft des Doktor Papus, der meine Forschungen gelobt hatte, ermutigt, bildete ich mir ein, das Rätsel der Sphinx gelöst zu haben. Ein Nacheiferer des Orpheus, hielt ich es für meine Aufgabe, die Natur, die unter den Händen der Gelehrten gestorben war, wieder zu beleben.
In dem Bewusstsein, dass die Mächte mich beschützen, schmeichelte ich mir, durch meine Feinde nicht besiegt werden zu können; das ging so weit, dass ich die einfachsten Begriffe der Bescheidenheit verachtete.
Hier ist der rechte Augenblick, die Geschichte meines geheimnisvollen Freundes einzuschalten, der eine entscheidende Rolle in meinem Leben spielte: als Führer, Ratgeber, Tröster, Strafer und ausserdem als Helfer, der mich in zuweilen eintretenden Zeiten der Not mit neuen Mitteln versorgte. Schon 1890 schrieb er mir einen Brief auf ein Buch das ich damals erscheinen liess. Er hatte zwischen meinen Gedanken und denen der Theosophen Berührungspunkte gefunden und wollte meine Ansichten über den Okkultismus und über die Priesterin der Isis, Frau Blawatsky, wissen. Der anmassende Ton seiner Epistel missfiel mir, und ich verhehlte ihm das in meiner Antwort nicht. Vier Jahre später veröffentliche ich den "Antibarbarus" und empfange im kritischesten Augenblick meines Lebens von diesem Unbekannten einen zweiten Brief, in dem er mir in gehobenem, fast prophetischen Ton, eine schmerzensreiche und glorreiche Zukunft vorhersagt. In gleicher Weise legt er dar, aus welchen Gründen er den Briefwechsel wieder aufgenommen habe; ihm habe dazu eine Ahnung bestimmt, dass ich augenblicklich eine seelische Krise durchmache und vielleicht ein Wort des Trostes nötig habe. Schliesslich bietet er mir seine Unterstützung an, die ich jedoch ablehne, da ich auf meine elende Unabhängigkeit eifersüchtig bin.
Im Herbst 1895 bin ich es, der den Briefwechsel wieder eröffnet, indem ich ihn bitte, mir bei der Herausgabe meiner naturwissenschaftlichen Schriften behilflich zu sein. Von diesem Tage an unterhalten wir durch die Post sehr freundschaftliche, selbst vertrauliche Beziehungen, wenn ich einen kurzen Bruch ausnehme, den er durch seine verletzende Sprache verursacht, als er mich über alltägliche Dinge unterrichten will und mir in hochmütigen Ausdrücken meinen Mangel an Bescheidenheit vorwirft.
Nachdem wir uns jedoch wieder versöhnt hatten, teilte ich ihm alle meine Beobachtungen mit, lieferte ihm meine Geheimnisse aus; was vielleicht nicht ganz klug war. Ich beichtete diesem Mann, den ich nie gesehen hatte, und ich ertrug von seiner Seite die strengsten Ermahnungen, weil ich ihn eher als eine Idee, denn als eine Person betrachtete: er war für mich ein Bote der Vorsehung, ein Paraklet.
In zwei Dingen aber waren wir so grundverschiedener Ansicht, dass wir zu lebhaften Auseinandersetzungen kamen, ohne jedoch in beleidigende Streitigkeiten zu geraten. Als Theosoph predigte er Karma, das heisst die abstrakte Summe der menschlichen Schicksale, die einander ausgleichen, um eine Art Nemesis zu ergeben. Er war also Mechanist und ein Epigone der sogenannten materialistischen Schule. Ich dagegen sah in den Mächten eine oder mehrere konkrete, lebendige, individualistische Personen, die den Lauf der Welt und die Bahnen der Menschen bewusst lenken; hypostatisch, wie die Theosophen sagen.
Die zweite Meinungsverschiedenheit bezog sich auf die Verleugnung und Abtötung des Ichs, die mir als eine Torheit erschien und noch erscheint. Alles, was ich weiss, wenn es auch noch so wenig ist, kommt vom Ich als dem Mittelpunkt her. Die Kultur, nicht der Kultus, dieses Ichs erweist sich also als der höchste und letzte Zweck des Daseins. Meine bestimmte und beständige Antwort auf seine Einwendungen lautete also: die Abtötung des Ichs ist Selbstmord.
Übrigens, vor wem soll ich mich beugen? Vor den Theosophen? Niemals! Vor dem Ewigen, den Mächten, der Vorsehung unterdrücke ich meine bösen Instinkte, stets und ständig, so weit es möglich ist. Kämpfen für die Erhaltung meines Ichs gegen alle Einflüsse, die der Ehrgeiz einer Sekte oder einer Partei auf mich ausüben will, das ist meine Pflicht; wie sie mir das Bewusstsein diktiert, das mir die Gnade meiner göttlichen Beschützer gegeben hat.
Wenn ich jedoch an die Eigenschaften dieses unsichtbaren Mannes denke, den ich liebe und bewundere, so dulde ich seine Anmassung, wenn er mich als inferior behandelt. Ich antworte ihm immer und verhehle ihm nicht, dass die Theosphie mir widerstrebt.
Schliesslich aber, mitten in dem Abenteuer Popoffsky, spricht er eine so hochmütige Sprache, wird seine Tyrannei so unerträglich, dass ich fürchten muss, er hält mich für verrückt. Er nennt mich Simon Magus, Schwarzmagier und empfiehlt mir Frau Blawatski. Ich antworte sofort, ich habe Frau B. durchaus nicht nötig und niemand habe mir etwas zu lehren. Und womit droht er mir darauf? Er sagt, erwerde mich mit Hilfe von Mächten, die stärker als meine seien, auf den rechten Weg zurückzuführen wissen. Da bitte ich ihn, nicht an mein Schicksal zu rühren; das sei gut behütet von der Hand der Vorsehung, die mich immer geleitet habe. Und, um meinen Gedanken durch ein Beispiel zu erläutern, erzähle ich ihm folgende Geschichte, eine Einzelheit aus meinem an providentiellen Zwischenfällen so reichen Leben, indem ich jedoch vorausschicke, dass ich fürchte, durch Auslieferung meines Geheimnisses mir die Rache der Nemesis selber zuzuziehen.
Es war vor zehn Jahren, mitten in meiner geräuschvollsten literarischen Epoche, als ich gegen die Frauenbewegung auftrat, die ausser mir jeder in Skandinavien unterstützte. In der Hitze des Kampfes liess ich mich hinreissen und überschritt die Grenzen der Schicklichkeit so weit, dass meine Landsleute mich für verrückt erklärten.
Ich wohnte in Bayern, mit meiner ersten Frau und meinen Kindern, als ein Jugendfreund mich brieflich einlud, mit meinen Kindern ein Jahr bei ihm zu verbringen; von meiner Frau war nicht die Rede.
Der Charakter dieses Briefes machte mich misstrauisch: der Stil war geschraubt, Streichungen und Änderungen zeigten, dass der Schreiber gezögert hatte, was für Gründe er anführen solle. Ich witterte eine Falle und lehnte das Anerbieten in unbestimmten und freundlichen Ausdrücken ab.
Zwei Jahre später, als meine erste Scheidung vollzogen ist, lade ich mich allein bei meinem Freund ein, der im Stockholmer Inselmeer als Zollinspektor lebt.
Der Empfang ist herzlich, aber die Luft ist voll von Unwahrheiten und Doppelsinnigkeiten, die Unterhaltung gleicht einem polizeilichen Verhör. Nachdem ich eine Nacht über die Sache nachgedacht habe, wird sie mir klar. Dieser Mann, dessen Eigenliebe ich in einem meiner Romane verletzt habe, grollt mir, obwohl er Sympathie für mich hat. Ein Despot ohnegleichen, will er mein Schicksal beeinflussen, meinen Geist zähmen und seine Überlegenheit zeigen, indem er mich unterwirft.
Nicht sehr gewissenhaft in der Wahl seiner Mittel, peinigt er mich eine Woche, vergiftet mich mit Verleumdungen, mit eigens erfundenen Fabeln, benimmt sich aber so ungeschickt, dass ich in meiner Überzeugung bestärkt werde, die Falle, die er mir früher gestellt hatte, habe keinen andern Zweck gehabt, als mich als Geisteskranken einzusperren.
Ich lasse ihn gewähren, ohne Widerstand zu leisten, indem ich auf meinen guten Stern vertraute, um mich zu befreien, wenn die Zeit gekommen ist.
Meine scheinbare Unterwerfung verschafft mir das Wohlwollen meines Henkers: mitten im Meer allein hausend, von seinen Nachbarn und Untergebenen verwünscht, gibt er dem Bedürfnis, sich anzuvertrauen, nach. Mit einer Naivität, die bei einem Mann von fünfzig Jahren unbegreiflich ist, erzählt er mir, seine Schwester sei im letzten Winter verrückt geworden und habe in einen Anfall von Wahnsinn ihre Ersparnisse verbrannt.
Am nächsten Tag neue vertrauliche Mitteilungen: ich erfahre, dass sein Bruder als geisteskrank auf dem Lande interniert ist.
Ich frage mich: ist es aus diesem Grunde, um sich am Schicksal zu rächen, dass er mich einzusperren wünscht?
Ich beklage sein Unglück und gewinne mir seine Zuneigung so vollständig, dass ich die Insel verlassen kann um mir auf einer benachbarten Insel, wo ich meine Familie wiederfinde, eine Wohnung zu mieten.
Einen Monat später ruft mich ein Brief zu meinem "Freund": er ist vor Schmerz gebrochen, weil sein Bruder sich in einem Anfall von Tobsucht den Schädel zerschmettert hat. Ich tröste ihn, meinen Henker, und um das Unglück voll zu machen, vertraut mir seine Frau unter Tränen, sie befürchte schon lange, dass ihr Gatte das Schicksal der andern teilen werde.
Ein Jahr vergeht, da berichten die Zeitungen, dass der ältere Bruder meines Freundes sich unter Umständen, die auf geistige Störung deuten, getötet hat.
Drei Blitzschläge auf das Haupt dieses Mannes, der mit dem Donner hatte spielen wollen.
"Welches Zusammentreffen," wird man sagen. Und was noch mehr ist: welches unglückliche Zusammentreffen, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzählt habe, bin ich dafür bestraft worden.
Die grosse Julihitze ist gekommen; das Leben ist unerträglich: alles stinkt, und die hundert Aborte nicht am wenigsten. Ich erwarte eine Katastrophe, ohne sagen zu können, was für eine.
Auf einer Strasse finde ich ein Stück Papier auf dem das Wort "Marder" steht. Auf einer andern Strasse ein ähnliches Stück Papier, das, von derselben Hand geschrieben, das Wort "Geier" trägt. Popoffsky gleicht vollkommen einem Marder und seine Frau einem Geier. Sollten sie nach Paris gekommen sein, um mich zu töten? Er, der Mörder ohne Scham, ist zu allem fähig, nachdem er Weib und Kind ermordet hat.
Ich lese eine köstliche Arbeit, "Die Freude zu sterben", und der Wunsch wird in mir wach, diese Welt zu verlassen. Um die Grenze zwischen Leben und Tod kennen zu lernen, lege ich mich aufs Bett, entkorke das Fläschchen mit Zyankalium und es verbreitet seinen tödlichen Duft. Er nähert sich, der Mann mit der Sense: ein mildes Gefühl, eine Wollust überkommt mich; aber, im letzten Augenblick, tritt immer jemand oder etwas unvermutet dazwischen: der Diener kommt unter irgendeinem Vorwand, eine Wespe fliegt zum Fenster herein.
Die Mächte weigern mir die einzige Freude, und ich beuge mich ihrem Willen.
Anfang Juli gehen die Studenten in die Ferien und lassen das Hotel leer.
Darum erregt ein Fremder, der in das Zimmer neben meinem Arbeitstisch einzieht, meine Neugier. Der Unbekannte spricht niemals; erscheint sich hinter der Wand, die uns trennt, mit schreiben zu beschäftigen. Seltsam ist jedenfalls, dass er seinen Stuhl zurückschiebt, wenn ich meinen bewege; dass er meine Bewegungen wiederholt, als wolle er mich durch seine Nachahmung necken.
Das dauert drei Tage. Am vierten mache ich diese Beobachtung: wenn ich schlafen gehe, legt sich der andere in dem Zimmer neben meinem Zimmer nieder; bin ich im Bett, so höre ich, wie er sich in das andere Zimmer begibt und das Bett neben meinem Bett einnimmt. Ich höre ihn, wie er sich parallel mit mir ausstreckt: er blättert in einem Buch, löscht dann die Lampe, holt tief Atem, dreht sich auf die Seite und schläft ein.
Eine vollständige Stille herrscht in dem Zimmer neben meinem Tisch. Er bewohnt also beide Zimmer. Es ist unangenehm, von zwei Seiten belagert zu werden.
Allein, ganz allein nehme ich das Mittagessen auf einem Tablett auf meinem Zimmer ein, und ich esse so wenig, dass der teilnehmende Diener Mitleid mit mir hat. Seit einer Woche habe ich meine Stimme nicht mehr gehört, und aus Mangel an Übung beginnt der Laut zu verschwinden. Ich habe keinen Sou mehr: Tabak und Briefmarken fehlen mir.
Da mache ich eine letzte Anstrengung und sammle meinen Willen. Ich will Gold machen, auf trocknem Wege durch Feuer. Das Geld findet sich, Öfen, Tiegel, Löschkohlen, Blasebalg, Zangen.
Die Hitze ist übermässig; nackt bis zum Gürtel wie ein Grobschmied, schwitze ich vor dem offenen Feuer. Aber die Sperlinge haben ihr Nest in den Schornstein gebaut, und der Kohlendunst schlägt ins Zimmer. Nach dem ersten Versuch möchte ich aus der Haut fahren, weil ich Kopfschmerzen habe und meine Experimente eitel sind, da alles verkehrt geht. Nachdem ich die Masse drei Male im Schmiedefeuer geschmolzen habe, betrachte ich das Innere des Tiegels. Der Borax hat einen Totenkopf gebildet, dessen leuchtende Augen meine Seele wie eine übernatürliche Ironie durchbohren.
Wieder kein Metallkorn! Und ich verzichte auf einen neuen Versuch.
Im Lehnstuhl sitzend, lese ich in der Bibel, wie der Zufall sie mir aufschlägt: "Niemand geht in sich und hat weder die Kenntnis noch den Witz, zu sagen: ich habe die Hälfte hiervon im Feuer verbrannt, und doch habe ich Brot gebacken auf den Kohlen; ich habe Fleisch geröstet und davon gegessen; und übrigens sollte ich daraus ein Greuel machen? sollte ich einen Baumzweig anbeten? Er nährt sich von Asche, und sein getäuschtes Herz leitet ihn irre; und er wird seine Seele nicht befreien, und wird nicht sagen, was in meiner rechten Hand ist, ist das keine Falschheit?... So hat der Ewige, dein Erlöser, gesprochen, der dich vom Mutterleib bereitet hat, ich bin der Ewige, der alle Dinge geschaffen hat, der allein die Himmel entworfen, der allein die Erde geebnet hat; der die Versicherungen der Lügner zerstreut, der die Wahrsager zum Unsinn macht, der den Geist der Weisen verkehrt, der ihr Wissen eine Torheit werden lässt."
Zum ersten Male zweifle ich an meinen wissenschaftlichen Untersuchungen! Wenn es eine Torheit ist, ach! dann habe ich das Glück meines Lebens und das meiner Frau und meiner Kinder für ein Hirngespinst geopfert!
Wehe mir Toren! Der Abgrund öffnet sich zwischen meiner Familie und diesem Augenblick! Ein und ein halbes Jahr, so viele Tage und so viele Nächte, so viele Schmerzen für nichts!
Nein, das kann nicht sein! Das ist nicht so!
Habe ich mich in einem dunklen Walde verirrt? Nein, der Lichtbringer hat mich auf den rechten Weg geführt, nach der Insel der Seligen, und es ist der Teufel, der mich versucht! oder mich straft!
Ich sinke auf den Lehnstuhl nieder; eine ungewohnte Schwere bedrückt meinen Geist, ein magnetisches Fluidum scheint von der Wand auszuströmen, der Schlaf übermannt meine Glieder. Ich sammle meine Kräfte und stehe auf, um auszugehen. Als ich durch den Korridor komme, höre ich Stimmen, die in dem Zimmer neben meinem Tisch flüstern.
Warum flüstern sie? In der Absicht, sich vor mir versteckt zu halten.
Ich gehe die Rue d'Assas hinunter und trete in den Luxemburggarten. Ich schleppe meine Beine, ich bin von den Hüften bis zu den Füssen gelähmt, ich sinke hinter dem Adam mit seiner Familie auf eine Bank.
Ich bin vergiftet! Das ist der erste Gedanke, der mir kommt! Und Popoffsky, der Weib und Kind mit giftigen Gasen getötet hat, ist hierhergekommen. Er ist es, der nach dem berühmten Experiment von Pettenkofer einen Gasstrom durch die Wand geleitet hat.
Was ist zu machen? Zur Polizei gehen? Nein! Wenn ich keine Beweise habe, wird man mich als einen Narren einsperren.
Vae soli! Wehe dem einsamen Menschen, dem Sperling auf dem Dache! Niemals war das Elend meines Daseins grösser, und ich weine wie ein verlassenes Kind, das sich im Dunkeln fürchtet.
Abends wage ich aus Furcht vor einem neuen Attentat nicht mehr an meinem Tisch zu bleiben. Ich lege mich zu Bett, ohne dass ich mich getraue einzuschlafen. Es ist Nacht, und die Lampe ist angesteckt. Auf der Mauer, meinem Fenster gegenüber, sehe ich den Schatten einer menschlichen Gestalt sich abzeichnen. Ob Mann oder Weib, ich wüsste es nicht zu sagen, aber der Eindruck, der mir geblieben ist, war der eines Weibes.
Als ich aufstehe, um nachzusehen, wird die Gardine mit einem kurzen Geräusch herabgelassen. Dann höre ich den Unbekannten in das Zimmer eintreten, das neben meinem Alkoven liegt, und Stille tritt ein.
Drei Stunden liege ich wach da, ohne den Schlaf zu finden, der sonst nicht auf sich warten lässt.
Da schleicht sich ein beunruhigendes Gefühl durch meinen Körper: ich bin das Opfer eines elektrischen Stroms, der zwischen den beiden benachbarten Zimmern läuft. Die Spannung wächst, und trotzdem ich Widerstand leiste, verlasse ich das Bett, von diesem Gedanken besessen:
—Man tötet mich! Ich will mich nicht töten lassen!
Ich gehe hinaus, um den Diener in seiner Zelle am Ende des Korridors zu suchen. Aber, ach, er ist nicht da. Also entfernt, fortgeschickt, geheimer Mitschuldiger, gekauft.
Ich steige die Treppe hinab und durchschreite den Korridor, um den Pensionsvorsteher zu wecken.
Mit einer Geistesgegenwart, deren ich mich nicht für fähig gehalten, schütze ich ein Unwohlsein vor, das von den Ausdünstungen der Chemikalien komme, und bitte um ein anderes Zimmer für die Nacht.
Infolge eines Zufalls, den die zornige Vorsehung herbeigeführt hat, liegt das einzige verfügbare Zimmer unter dem meines Feindes.
Sobald ich allein bin, öffne ich das Fenster und atme die frische Luft einer sternklaren Nacht ein. Über den Dächern der Rue d'Assas und der Rue Madame leuchten der grosse Bär und der Polarstern.
—Gegen Norden also! Omen accipio!
Als ich die Vorhänge des Alkovens zurückziehe, höre ich über mir meinen Feind, wie er aus dem Bett steigt und einen schweren Gegenstand in einen Koffer fallen lässt, dessen Deckel er mit einem Schlüssel abschliesst.
Er verbirgt also etwas; vielleicht die Elektrisiermaschine.
Am nächsten Tage, es ist ein Sonntag, packe ich meine Sachen unter dem Vorwand, ich wolle einen Ausflug an die Küste des Meeres machen.
Dem Kutscher rufe ich Bahnhof Saint-Lazare zu. Als ich aber am Odeon vorbeikomme, lasse ich mich von ihm nach der Rue de la Clef führen, in die Nähe des Jardin des Plantes. Dort will ich bleiben, inkognito, um meine Studien zu vollenden, bevor ich nach Schweden reise.
Endlich tritt eine Pause in meinen Strafen ein. Auf dem Treppenabsatz des Gartenhauses in einem Sessel sitzend, verbringe ich Stunden damit, die Blumen des Gartens zu betrachten und über die Vergangenheit nachzudenken. Die Ruhe, die nach meiner Flucht eingetreten ist, beweist mir, dass mich keine Krankheit befallen, sondern dass mich Feinde verfolgt haben. Am Tage arbeite ich, und in der Nacht schlafe ich ruhig.
Von der Unsauberkeit befreit, fühle ich mich wieder jung werden, wenn ich die Stockrosen, die Blumen meiner Jugend, betrachte.
Der Jardin des Plantes, dieses den Parisern unbekannte Wunder von Paris, ist mein Park geworden. Die ganze Schöpfung, in einer Ringmauer gesammelt, die Arche Noahs, das wiedergefundene Paradies, in dem ich ohne Gefahr zwischen wilden Tieren lustwandle, es ist zu viel Glück. Von den Gesteinen ausgehend, komme ich durch das Reich der Pflanzen und Tiere, um zum Menschen zu gelangen, hinter dem ich den Schöpfer entdecke. Der Schöpfer, dieser grosse Künstler, der sich entwickelt, indem er schafft, Skizzen macht, die er wieder verwirft, unreife Gedanken wieder aufnimmt, einfache Formen vollendet und vervielfacht. Alles ist das Werk seiner Hand. Oft macht er ungeheuere Fortschritte, indem er die Arten erfindet, und dann kommt die Wissenschaft, stellt Lücken, fehlende Glieder fest und bildet sich ein, die Zwischenarten seien verschwunden.
Da ich nun vor meinen Verfolgern in Sicherheit zu sein glaube, sende ich meine Adresse ans Hotel Orfila, um wieder in Verbindung mit der Aussenwelt zu treten, indem ich meine durch die Flucht unterbrochene Korrespondenz wieder aufnehme.
Kaum aber habe ich mein Inkognito gelüftet, ist der Friede aus. Es geschehen wieder Dinge, die mich beunruhigen, und das frühere Unbehagen bedrückt mich. Zunächst werden in dem Zimmer des Erdgeschosses, das neben meinem liegt und bisher frei war, auch keine Möbel hatte, Gegenstände aufgestapelt, deren Gebrauch mir unerklärlich bleibt. Ein alter Herr mit grauen und boshaften Bärenaugen trägt leere Warenbüchsen, Blechplatten und andere Gegenstände hinein, aus denen man nicht klug wird.
Zur selben Zeit beginnen wieder die Geräusche von der Rue de la Grande-Chaumière über meinem Kopfe: man zieht Stricke, schlägt mit Hämmern, ganz als montiere und aufstelle man eine Höllenmaschine, wie die Nihilisten sie anwenden.
Dann ändert die Wirtin, die zu Anfang meines Aufenthaltes freundlich war, ihr Benehmen gegen mich, sucht mich auszukundschaften, grüsst mich auf herausfordernde Art.
Ferner wechselt die erste Etage über mir den Mieter. Der alte stille Herr, dessen schwere Schritte mir bekannt waren, ist nicht mehr da. Ein zurückgezogen lebender Rentier, bewohnt er das Haus seit Jahren, und er ist nicht verreist sondern hat nur das Zimmer gewechselt. Warum?
Das Mädchen, das mein Zimmer aufräumt und mir die Mahlzeiten bringt, ist ernst geworden und wirft mir verstohlen mitleidige Blicke zu.
Jetzt ist über mir ein Rad, das sich den ganzen Tag dreht und dreht.
Zum Tode verurteilt! Das ist mein bestimmter Eindruck. Durch wen? Durch die Russen, die Pietisten, die Katholiken, die Jesuiten, die Theosophen! Weshalb? Als Zauberer oder Schwarzmagier?
Oder von der Polizei! Als Anarchist? Das ist ja eine sehr gebräuchliche Anklage, um persönliche Feinde zu beseitigen.
In dem Augenblick, wo ich dieses schreibe, weiss ich nicht, was sich in jener Julinacht, als sich der Tod auf mich stürzte, ereignet hat, aber ich weiss wohl und werde nie vergessen, welche Lektion ich für mein Leben bekam.
Selbst wenn die, welche das Geheimnis kennen, zugeben und eingestehen, dass es eine Intrige war, die Menschenhände eingefädelt hatten, grolle ich ihnen nicht, da ich jetzt überzeugt bin, dass eine andere stärkere Hand ihre in Bewegung setzte, ohne dass sie es wussten, ohne dass sie es wollten.
Nimmt man andererseits an, es sei keine Intrige gewesen, so hätte ich selber durch meine Einbildung diese Zuchtgeister geschaffen, um mich zu strafen. Wir werden im folgenden sehen, wieweit diese Annahme wahrscheinlich sein mag.
Am Morgen des letzten Tages stehe ich mit einer Resignation auf, die ich religiös nennen möchte; nichts bindet mich mehr ans Leben. Ich habe meine Papiere geordnet, die notwendigsten Briefe geschrieben, verbrannt, was zu vernichten war.
Dann gehe ich in den Jardin des Plantes, um der Schöpfung Lebewohl zu sagen.
Die schwedischen Magneteisenblöcke, die vor dem mineralogischen Museum aufgestellt sind, grüssen mich von meinem Vaterland. Die Akazie des Robin, die Zeder des Libanon, die Denkmäler der grossen Epochen der noch lebenden Wissenschaft, ich grüsse sie.
Ich kaufe Brot und Kirschen. Mein alter Freund Martin kennt mich persönlich, weil ich der einzige bin, der ihm beim Aufstehen und Schlafengehen Kirschen gibt. Das Brot bringe ich dem jungen Elefanten, der mir ins Gesicht spuckt, nachdem er alles gefressen hat, die undankbare und treulose Jugend.
Lebt wohl, Geier, Himmelsbewohner, nun in einem schmutzigen Käfig eingeschlossen; leb wohl, Bison, Behemoth, gefesselter Dämon; leb wohl, Robbenpärchen, das die eheliche Liebe über den Verlust des Ozeans und der grossen Horizonte tröstet. Lebt wohl, Steine, Pflanzen, Blumen, Bäume, Schmetterlinge, Vögel, Schlangen, ihr alle geschaffen von der Hand eines guten Gottes! Und ihr, grosse Männer, Bernardin de Saint-Pierre, Linne, Geoffroy, Saint-Hilaire, Haüy, deren Namen in goldenen Buchstaben am Giebel des Tempels stehen—lebt wohl! oder vielmehr: auf Wiedersehen!
Ich verlasse das irdische Paradies in dem ich an Seraphites erhabene Worte denke: "Leb wohl, arme Erde! Leb wohl!"
Als ich den Garten des Hotels wieder betrete, wittere ich die Gegenwart eines Menschen, der, während ich fort war, gekommen ist. Ich sehe ihn nicht, aber ich fühle ihn.
Was meine Unruhe noch vermehrt, ist die augenscheinliche Veränderung, die mit dem benachbarten Zimmer vorgegangen ist. Zunächst ist eine Decke über einen Strick gehängt, augenscheinlich um etwas zu verbergen. Auf dem Mantels des Kamins sind in Stapeln Metallplatten aufgehäuft, die durch Querhölzer voneinander getrennt sind. Auf jedem Stapel liegt ein Photographiealbum oder irgendein Buch, offenbar, um diesen Höllenmaschinen, die ich für Akkumulatoren halten möchte, ein unschuldiges Aussehen zu geben.
Dazu kommt, dass ich auf einem Dach der Rue Censier, gerade dem Pavillon, in dem ich wohne gegenüber, zwei Arbeiter bemerke. Was sie dort oben machen, kann ich nicht unterscheiden, aber sie zielen nach meiner Glastür, während sie mit Gegenständen hantieren, die ich nicht erkennen kann.
Warum entschliesse ich mich nicht zum Fliehen? Weil ich zu stolz bin und das Unvermeidbare ertragen muss.
Ich bereite mich also auf die Nacht vor. Ich nehme ein Bad und achte sorgfältig darauf, dass meine Füsse weiss werden, denn meine Mutter hatte mir als Kind eingeprägt, dass schwarze Füsse ein Zeichen der Schande sind. Ich rasiere mich und parfümiere mein Hochzeitshemd, das ich vor drei Jahren in Wein kaufte.... Die Toilette des zum Tode Verurteilten.
Ich lese in der Bibel die Psalmen, in denen David die Rache des Ewigen auf seine Feinde herabruft.
Aber die Busspsalmen? Nein, ich habe nicht das Recht, zu bereuen, denn nicht ich habe mein Schicksal gelenkt; ich habe niemals das Böse um des Bösen willen getan, ich habe es nur getan, um meine Person zu verteidigen. Bereuen, das heisst, die Vorsehung kritisieren, die uns die Sünde als ein Leiden auferlegt, um uns durch den Ekel, den die schlechte Handlung einflösst, zu läutern.
Meine Rechnung mit dem Leben schliesst so ab: die Posten heben sich auf! Wenn ich gesündigt habe, auf mein Wort, ich habe genug Strafe dafür gelitten; ganz sicher! Die Hölle fürchten? Ich habe, ohne zu straucheln, hier auf Erden tausend Höllen durchwandert, und das hat den brennenden Wunsch in mir entfacht, die Eitelkeiten und falschen Freuden dieser Welt, die ich immer verabscheut habe, zu verlassen. Mit Heimweh nach dem Himmel geboren, weinte ich schon als Kind über den Schmutz des Daseins, fühlte mich fremd und heimatlos unter meinen Verwandten und in der Gesellschaft.
Seit meiner Kindheit habe ich Gott gesucht, und ich habe den Teufel gefunden. In meiner Kindheit habe ich das Kreuz Christi getragen, und ich habe einen Gott verleugnet, der sich begnügt, über Sklaven, die ihren Peinigern dienen, zu herrschen.
Als ich die Vorhänge meiner Glastür niederlasse, bemerkt ich im Privatsalon eine Gesellschaft von Damen und Herren, die Champagner trinken. Offenbar Fremde, die heute abend angekommen sind. Aber es ist keine Lustpartie, denn sie sehen alle ernst aus, diskutieren, machen Pläne, sprechen mit leiser Stimme wie Verschwörer. Um meine Marter vollständig zu machen, drehen sie sich auf ihren Stühlen um und zeigen mit den Fingern nach meinem Zimmer.
Um zehn Uhr ist meine Lampe gelöscht, und ich schlafe ruhig ein, resigniert wie ein Sterbender.
Ich erwache; eine Uhr schlägt zwei, eine Tür wird zugemacht, und ... ich bin aus dem Bett wie gehoben durch eine Saugpumpe, die mir das Herz aussaugt. Als ich auf den Füssen bin, trifft eine elektrische Dusche meinen Nacken und drückt mich zu Boden.
Ich erhebe mich wieder, fasse meine Kleider und stürze in den Garten hinaus, ein Raub des furchtbarsten Herzklopfens.
Als ich mich angekleidet habe, ist mein erster klarer Gedanke, die Polizei zu rufen, um eine Haussuchung vornehmen zu lassen.
Aber die Haustür ist verschlossen, ebenso die Portierloge; ich tappe mich im Finstern vorwärts, öffne eine Tür rechts und trete in die Küche, wo ein Nachtlicht brennt. Ich stosse es um und stehe in tiefster Dunkelheit.
Die Furcht bringt mich wieder zur Besinnung, und von dem Gedanken, wenn ich mich täusche, bin ich verloren, geleitet, kehre ich in mein Zimmer zurück.
Ich schleppe einen Sessel in den Garten und, unter dem Sterngewölbe sitzend, denke ich an das, was sich zugetragen hat.
Eine Krankheit? Unmöglich, da es mir gut ging, bis ich mein Inkognito lüftete. Ein Attentat! Offenbar, da ich selber die Vorbereitungen gesehen habe. Übrigens, hier in diesem Garten, ausser Bereich meiner Feinde, bin ich wieder hergestellt, und mein Herz funktioniert vollkommen normal.
Während ich diese Überlegungen anstelle, höre ich in dem Zimmer, das an meines stösst, jemand husten. Kurz darauf antwortet ein leises Husten im Zimmer, das darüber liegt.
Wahrscheinlich sind es Zeichen, und sie gleichen genau denen, die ich der letzten Nacht im Hotel Orfila gehört hatte.
Ich mache mich an die Glastür des Zimmers im Erdgeschoss, um das Schloss aufzubrechen, aber es ist vergebens.
Vom nutzlosen Kampf gegen die Unsichtbaren ermüdet, sinke ich in den Sessel nieder; der Schlaf erbarmt sich meiner, ich schlummere ein, unter den Sternen einer schönen Sommernacht, während die Stockrosen sich im lauen Juliwind wiegen.
Die Sonne weckt mich. Ich danke der Vorsehung, dass sie mich vom Tode errettet hat, und packe meine wenigen Sachen, um nach Dieppe zu fahren. Dort werde ich Schutz bei Freunden finden, die ich zwar wie alle andern vernachlässigt habe, die aber nachsichtig und grossmütig gegen Unglückliche und Schiffbrüchige sind.
Als ich das Hotel verlasse, schleudere ich einen Fluch auf das Haupt der Übeltäter und rufe das Feuer des Himmels auf diese Räuberhöhle herab; ob mit Recht oder Unrecht, wer kann es wissen?
Meine guten Freunde in Dieppe erschrecken als sie mich mit meiner von Manuskripten beschwerten Reisetasche den kleinen Hügel der Orchideenstadt hinaufsteigen sehen.
—Woher kommen Sie, Unglücklicher?
—Ich komme vom Tode.
—Ich ahnte es, denn Sie sehen aus wie eine Leiche.
Die gute und reizende Dame des Hauses fasst mich bei der Hand und führt mich vor einen Spiegel, in dem ich mich betrachten kann. Das Gesicht von Rauch des Zuges geschwärzt, die Backen hohl, die Haare voll Schweiss und angegraut, die Augen verstört, die Wäsche schmutzig: es war ein Anblick zum Erbarmen.
Als die liebenswürdige Dame, die mich wie ein krankes und verlassenes Kind behandelte, mich vor der Toilette allein liess, musterte ich mein Gesicht genauer. Es war ein Ausdruck in den Zügen, der mich erschreckte. Das war weder der Tod, noch das Laster, das war etwas anderes. Und wenn ich Swedenborg gekannt hätte, hätte ich die vom bösen Geist hinterlassene Spur mich über den Zustand meiner Seele und die Begebenheiten der letzten Wochen aufgeklärt.
Jetzt dagegen schämte ich mich und entsetzte ich mich vor mir selber, und ich bereute es, gegen diese Familie undankbar gewesen zu sein, die mir einst diesen rettenden Hafen angeboten hatte, mir und so vielen andern Schiffbrüchigen.
Zur Busse bin ich von den Furien hierher gejagt worden. Es ist ein schönes Künstlerheim, ein guter Haushalt, eheliches Glück, reizende Kinder, Luxus und Sauberkeit, eine Gastfreundschaft ohne Grenzen, Hochherzigkeit im Urteil, eine Atmosphäre der Schönheit und Güte, die mir in die Seele brennt. Und unter all diesem fühle ich mich nicht glücklich, wie im Paradies ein Verdammter. Hier beginne ich zu entdecken, dass ich verdammt bin.
Vor meinen Augen breitete sich alles aus, was das Leben an Glück bieten kann, alles, was ich verloren habe.
Ich bewohne eine Dachstube, von der ich den Gipfel des Hügels sehe, wo ein Hospiz für alte Leute liegt. Am Abend entdecke ich zwei Männer, die sich gegen die Ringmauer lehnen, nach unserer Villa spähen und mit Gebärden die Stelle meines Fensters bezeichnen. Die Idee, durch Feinde, die Elektriker sind, verfolgt zu sein, nimmt mich von neuem in Besitz.
Es ist die Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1896. Meine Freunde habe ihr Möglichstes getan, um mich zu beruhigen; wir haben zusammen alle Dachkammern, die neben meinem Zimmer liegen, sogar den Boden untersucht, damit ich sicher sei, dass sich niemand in strafbarer Absicht dort versteckt habe. Als man aber die Tür einer Rumpelkammer öffnet, macht ein an sich gleichgültiger Gegenstand einen entmutigenden Eindruck auf mich. Es ist ein Eisbär, der als Teppich dient; aber der gähnende Rachen, die drohenden Eckzähne, die funkelnden Augen reizen mich. Warum muss dieses Tier gerade in diesem Augenblick dort liegen?
Ohne mich auszuziehen, lege ich mich aufs Bett, entschlossen, den verhängnisvollen Glockenschlag der zweiten Stunde abzuwarten.
Ich warte bis Mitternacht, mit Lesen beschäftigt.
Ein Uhr ist vorbei, und das ganze Haus schläft ruhig.
Endlich schlägt es zwei Uhr! Nichts geschieht! Da, in einem Anfall von Anmassung, und um die Unsichtbaren herauszufordern, vielleicht auch in der Absicht, ein physikalisches Experiment zu machen, stehe ich auf, öffne die beiden Fenster, stecke zwei Kerzen an. Ich setze mich an den Tisch hinter die Leuchter und biete mich mit unbedeckter Brust als Zielscheibe dar und fordere die Unbekannten heraus.
—Hier bin ich, ihr Einfältigen!
Da macht sich ein Fluidum, wie ein elektrisches, fühlbar, zuerst schwach. Ich blicke auf meine Magnetnadel, die ich als Zeuge aufgestellt habe; aber keine Spur der Abweichung: also keine Elektrizität.
Aber die Spannung nimmt zu, mein Herz schlägt kräftig; ich wiederstehe, aber schnell wie ein Blitz erfüllt ein Fluidum meinen Körper, erstickt mich und saugt an meinem Herzen....
Ich stürze die Treppe hinunter, um den Salon im Erdgeschoss zu erreichen, wo man mir, für den Fall der Not ein provisorisches Bett bereitet hat. Da liege ich fünf Minuten und denke nach. Ist es strahlende Elektrizität? Nein, da die Magnetnadel nichts angezeigt hat. Eine Krankheit, veranlasst durch die Furcht vor der zweiten Stunde? Auch nicht, da mir nicht der Mut fehlt, den Angriffen zu trotzen. Warum musste ich denn die Kerzen anstecken, die das unbekannte Fluidum, dessen Opfer ich war, anzogen?
Ohne Antwort zu erhalten, in einem endlosen Labyrinth verirrt, zwinge ich mich, einzuschlafen; da aber greift mich eine neue Entladung an, die Jagd beginnt wieder. Ich ducke mich hinter der Wand, ich lege mich unter das Gesims der Türen, vor die Kamine. Überall, überall finden mich die Furien. Die Seelenangst nimmt überhand, der panische Schrecken vor allem und nichts ergreift mich so, dass ich von Zimmer zu Zimmer fliehe; schliesslich flüchte ich mich auf den Balkon, wo ich mich zusammenkauere.
Der Morgen ist graugelb, und die sepiafarbigen Wolken zeigen seltsame, ungeheuerliche Formen, die meine Verzweiflung vermehren. Ich suche das Atelier meines Freundes, des Malers, auf, lege mich auf den Teppich und schliesse die Augen. Fünf Minuten später werde ich von einem störenden Geräusch geweckt. Eine Maus äugt nach mir, mit der deutlichen Absicht, sich zu nähern. Ich verjage sie: sie kommt mit einer zweiten zurück. Mein Gott, habe ich das Delirium? Ich habe doch diese letzten drei Jahre den Wein nicht missbraucht! (Am nächsten Tag überzeugte ich mich, dass es wirklich Mäuse im Atelier gab, aber durch wen vorbereitet, und zu welchem Zweck?)
Ich wechsle den Platz und lege mich auf den Teppich des Flurs. Der barmherzige Schlaf senkt sich auf meinen gefolterten Geist, und ich verliere das Bewusstsein des Schmerzes, vielleicht eine halbe Stunde lang.
Ein deutlich artikulierter Schrei "Alp!" lässt mich plötzlich auffahren.
Alp! das ist der deutsche Name für einen quälenden, bedrückenden Traum. Alp! das ist das Wort, das die Tropfen des Gewitterregens im Hotel Orfila auf mein Papier zeichneten.
Wer hat es ausgerufen? Niemand, da alle Bewohner des Hauses schlafen. Ein Spiel von Dämonen. Ein poetisches Bild, das vielleicht die ganze Wahrheit enthält.
Ich steige die Treppe hinauf und trete in meine Dachstube: die Lichter sind niedergebrannt, tiefes Schweigen herrscht.
Da läutet das Angelus: es ist der Tag des Herrn.
Ich nehme das römische Gebetbuch und ich lese: De profundis clamavi ad te, Domine! Getröstet, sinke ich auf das Bett wie ein Toter.
Sonntag, den 26. Juli 1896. Ein Zyklon verwüstet den Jardin des Plantes. Die Zeitungen bringen die Einzelheiten, die mich seltsam interessieren; warum, kann ich nicht sagen. Heute soll Andrées Ballon zu seiner Nordpolfahrt aufsteigen; aber die Vorzeichen verkünden Unheil. Der Zyklon hat mehrere Ballons, die an verschiedenen Stellen aufgestiegen sind, zu Boden geschleudert, und mehrere Luftschiffer sind dabei umgekommen. Elisée Reclus hat sich das Bein gebrochen. Gleichzeitig hat sich in Berlin ein Mann namens Pieska auf ungewöhnliche Weise getötet; er schlitzte sich nach Art der Japaner den Bauch auf. Ein blutiges Drama.
Am nächsten Morgen verlasse ich Dieppe. Dieses Mal segne ich das Haus, dessen berechtigte Freuden ich durch meine Qualen verdüstert habe.
Da ich den Gedanken, dass übersinnliche Mächte in mein Schicksal eingreifen, noch immer zurückweise, bilde ich mir ein, eine Nervenkrankheit zu haben. Darum will ich nach Schweden fahren, um einen befreundeten Arzt aufzusuchen.
Als Andenken an Dieppe nehme ich einen Stein mit, der eine Art Eisenerz ist, die Form eines Dreiblatts hat, einem Spitzbogenfenster gleich, und das Zeichen des Malteserkreuzes trägt. Ich habe den Stein von einem Kind erhalten, das ihn am Strande gefunden hat. Es erzählte mir auch, diese Art Steine fielen vom Himmel, und würden dann von den Wellen ans Land geworfen.
Ich möchte gern an seine Deutung glauben und behalte das Geschenk als einen Talisman, dessen Bedeutung mir noch verborgen ist.
(An der Küste der Bretagne sammeln die Strandbewohner nach einem Sturme Steine in der Form eines Kreuzes, die wie Gold aussehen. Das ist ein Erz, das Staurolith heisst.)
Ganz im Süden Schwedens, an der Küste des Meeres, liegt die kleine Stadt: ein altes Seeräuber- und Schmugglernest, in dem Weltumsegler exotische Spuren aus vier Weltteilen hinterlassen haben.
So sieht die Wohnung meines Arztes wie ein buddhistisches Kloster aus. Die vier Flügel des einstöckigen Gebäudes schliessen einen viereckigen Hof ein, in dessen Mitte ein kuppelförmiger Bau an das Grabmal des Tamerlan zu Samarkand erinnert. Die Struktur und die Bekleidung des Dachstuhls mit chinesischen Ziegeln erinnern an den äussersten Orient. Eine apathische Schildkröte kriecht über das Pflaster und versinkt mitten im Gras in ein Nirvana der Betrachtung, das sich bis in Unendlichkeit ausdehnt.
Ein dichtes Gesträuch bengalischer Rosen schmückt die äussere Mauer des westlichen Flügels, wo ich allein wohne. Zwischen diesem Hof und den beiden Gärten liegt ein Wirtschaftshof, auf dem eine Kastanie steht und schwarze Hühner zanken; es ist eine Art Gang, dunkel und feucht.
Im Lustgarten steht ein Pavillon im Stil der Pagode, von Pfeifenstrauch überwachsen.
Dieses Kloster, das unzählige Zimmer hat, wird von einem einzigen Menschen bewohnt, dem Leiter des Kreiskrankenhauses. Witwer, Einsiedler, unabhängig, hat er die harte Schule des Lebens und der Menschen durchgemacht und verachtet die Menschen mit dieser starken und edlen Verachtung, die zur tiefen Erkenntnis der relativen Nichtigkeit aller Dinge führt, das eigene Ich einbegriffen.
Dieser Mann trat so unerwartet auf die Bühne meines Lebens, dass ich sein Auftreten zu den Theatercoups ex machina zählen möchte.
Als ich jetzt, von Dieppe kommend, im gegenüberstehe, sieht er mich fest und prüfend an und ruft aus:
—Was fehlt dir? Nervenkrank! Gut! Aber da ist auch noch etwas anderes. Du hast böse Augen, und das habe ich noch nicht bei dir gesehen. Was hast du gemacht? Ausschweifungen, Laser, verlorenen Illusionen, Religion? Erzähle mir, alter Junge!
Aber ich erzähle nichts, da der erste Gedanke, der meinem argwöhnischen Geist kommt, der ist, dass er gegen mich voreingenommen sei, dass er Erkundigungen eingezogen habe, dass ich interniert bin.
Ich schütze Nervosität, Schlaflosigkeit, Alpdrücken vor, und dann sprechen wir von anderen Dingen.
Als ich mich in meiner kleinen Wohnung einrichte, bemerke ich alsbald das amerikanische eiserne Bett, dessen vier in Messingkugeln endende Pfeiler den Leitern einer Elektrisiermaschine gleichen. Fügt man dazu die elastische Matratze, deren kupferne Sprungfedern wie die Spiralen der Rühmkorffschen Induktionsrolle aussehen, so kann man sich denken, wie wütend ich über diesen teuflischen Zufall bin. Unmöglich kann ich bitten, das Bett zu wechseln, weil dann der Verdacht aufkommen könnte, ich sei wahnsinnig.
Ich will mich vergewissern, dass nichts über meinem Bett verborgen ist, und steige auf den Boden hinauf. Um das Unglück voll zu machen, liegt dort oben nur ein einziger Gegenstand, und zwar ein ungeheures, zusammengerolltes Netz aus Eisendraht, gerade über meinem Bett. Das ist ein Akkumulator, sage ich mir. Wenn ein Gewitter, das hier sehr häufig ist, ausbricht, wird das Eisennetz den Blitz anziehen, und ich werde auf dem Konduktor liegen. Aber ich wage nichts zu sagen.
Zugleich beunruhigt mich der Lärm, den eine Maschine macht. Ein Ohrensausen verfolgt mich, seit ich das Hotel Orfila verlassen habe, wie das Stampfen eines Wasserrades. Da ich zweifle, ob dieses Geräusch tatsächlich vorhanden ist, frage ich, was es ist.
—Die Presse der Druckerei nebenan.
Alles erklärt sich wunderschön und doch macht mich diese Einfachheit der Mittel verrückt, erschreckt mich.
Die gefürchtete Nacht kommt. Der Himmel ist bedeckt, die Luft ist schwer; man erwartet ein Gewitter. Ich wage nicht, zu Bett zu gehen, und bringe zwei Stunden damit zu, dass ich Briefe schreibe. Von Müdigkeit überwältigt, entkleide ich mich und schlüpfe zwischen die Laken. Ein furchtbares Schweigen herrscht im Haus, als ich die Lampe lösche. Ich fühle, dass jemand im Dunkeln auf mich lauert, mich berührt, nach meinem Herzen tastet, saugt.
Ohne zu warten, springe ich aus dem Bett, öffne das Fenster uns stürze mich auf den Hof; aber die Rosensträucher stehen dort, und mein Hemd schützt mich nicht im geringsten gegen das Geisseln der Dornen. Zerrissen, blutend überschreite ich den Hof. Meine nackten Füsse werden von Kieselsteinen geschunden, von Disteln zerstochen, von Nesseln verbrannt; über unbekannt Gegenstände strauchelnd, erreiche ich die Küchentür, die zur Wohnung des Arztes führt. Ich klopfe. Keine Antwort!—Da erst entdecke ich, dass es regnet. Oh, Elend über Elend! Was habe ich getan, um diese Qualen zu verdienen? Sicher ist das die Hölle! Miserere! Miserere!
Ich klopfe immerzu!
Es ist seltsam, dass nie jemand da ist, wenn man mich angreift. Immer diese Alibis: es ist also ein Komplott, an dem alle teilnehmen! Endlich die Stimme des Arztes:
—Wer da?
—Ich bin es! Ich bin krank! Öffne, oder ich sterbe! Er öffnet.
—Was ist dir geschehen?
Ich beginne meine Erzählung mit dem Attentat in der Rue de la Clef, das ich feindlichen Elektrikern zuschreibe....
—Schweig, Unglücklicher! Du leidest an einer Geisteskrankheit.
—Verflucht! Untersuche doch meinen Verstand; lies, was ich täglich schreibe und was man druckt....
—Schweig! Kein Wort zu irgendwem! Die Bücher der Irrenhäuser kennen diese elektrischen Geschichten aus dem Grunde.
—Das wäre noch schöner! Ich kehre mich so wenig an eure Irrenhausbücher, dass ich, um mir Klarheit zu verschaffen, morgen nach Lund fahren werde, um mich im dortigen Irrenhaus untersuchen zu lassen!
—Dann bist du verloren! Kein Wort mehr davon, und leg dich hier im Nebenzimmer schlafen!
Ich gebe nicht nach und verlange, dass er mich anhört. Er lehnt es ab und will nichts hören.
Wieder allein, frage ich mich: ist es möglich, dass ein Freund, ein Ehrenmann, der sich von schmutzigen Händeln rein erhalten hat, seine ehrenwerte Laufbahn damit beschliesst, dass er der Versuchung unterliegt? Wessen Versuchung? Die Antwort fehlt mir; aber die Vermutungen fliessen über.
Every man his price, jeder Mann hat seinen Preis! Hier war allerdings eine bedeutende Summe notwendig, im Verhältnis zu seiner Tugend.—Aber zu welchem Zweck? Eine gewöhnliche Rache bezahlt man nicht übermässig! Es muss sich um ein ausserordentliches Interesse handeln! Halt, ich habe es! Ich habe Gold gemacht, der Doktor hat es halb erkannt, aber heute hat er es abgeleugnet, dass er meine Versuche, die ich ihm brieflich mitgeteilt hatte, wiederholt habe. Er hat es abgeleugnet, und doch habe ich heute abend Proben von seiner Hand gefunden; sie lagen auf dem Pflaster des Hofes. Also hat er gelogen!
Übrigens hat er sich am selben Abend darüber ausgesprochen, was für traurige Folgen es für die Menschheit haben würde, wenn die Herstellung des Goldes sich bestätigte. Allgemeiner Zusammenbruch, überall Verwirrung, Anarchie, Ende der Welt.
Man müsste den Erfinder töten! das war sein letztes Wort.
Ferner, als wir über die wirtschaftliche Lage meines Freundes sprechen, die recht bescheiden ist, war ich erstaunt, ihn sagen zu hören, dass er den Hof, den er bewohnt, demnächst kaufen werde. Er hat Schulden, ist beinahe in Verlegenheit, und träumt davon Grundbesitzer zu werden.
Alles vereinigt sich, um mir meinen guten Freund verdächtig zu machen.
Verfolgungswahn! Mag sein; aber der Künstler, der die Glieder dieser höllischen Syllogismen schmiedet, wo ist er?
—Man müsste ihn töten! Das ist der letzte Gedanke, den ich in meiner Qual festhalten kann, bevor ich gegen Sonnenaufgang einschlafe.
Wir haben eine Kaltwasserkur begonnen, und ich habe das Zimmer für die Nächte gewechselt, die jetzt ziemlich ruhig sind, wenn auch einige Rückfälle eintreten.
Eines Abends bemerkt der Doktor das Gebetbuch auf meinem Nachttisch und gebärdet sich wie ein Rasender.
—Immer noch diese Religion! Das ist ein Symptom begreifst du das?
—Oder ein Bedürfnis wie andere!
—Ich bin kein Atheist; aber ich denke, dass der Allmächtige die frühere Vertraulichkeit nicht mehr will. Man macht dem Ewigen nicht mehr den Hof, damit ist es aus! Ich halte mich an den Grundsatz des Mohammedaners, der um nichts als Gelassenheit bittet, damit er die Last des Daseins ertragen kann.
Grosse Worte, aus denen ich mir eigene Goldkörner heraushole. Er nimmt mir Gebetbuch und Bibel fort.
—Lies gleichgültige Sachen, von sekundärem Interesse, Weltgeschichte, Mythologie, und lass die Grübeleien. Vor allem: hüte dich vor dem Okkultismus, dieser Pseudowissenschaft. Es ist uns verboten, die Geheimnisse des Schöpfers zu erspähen, und wehe denen, die sie sich erlisten.
Als ich einwende, dass sich in Paris eine ganze Schule von Okkultisten gebildet habe, heult er:
—Wehe ihnen!
Am Abend bringt er mir Viktor Rydbergs "Germanische Mythologie", und zwar ohne Hintergedanken; ich bin wenigstens davon überzeugt.
—Hier sind Geschichten, bei denen man im Stehen einschlafen kann. Das wirkt besser als Sulfonal.
Wenn mein guter Freund gewusst hätte, welchen Zündfaden er da anzündete, er hätte lieber....
Die Mythologie in zwei Bänden, von zusammen tausend Seiten, öffnet sich unter meinen Händen wie von selber und meine Blicke heften sich alsbald auf diese Reihen, die sich meinem Gedächtnis in Feuerschrift einprägen:
"Nach der Legende blähte sich der durch seinen Vater unterrichtete Bhrigu vor Hochmut und bildete sich ein, seinen Meister zu übertreffen. Der sandte ihn in die Unterwelt, wo er zu seiner Demütigung tausend Schrecken beiwohnen muss, von denen er nie etwas geahnt hatte."
Das hiess also: der Hochmut, die Anmassung, die Hybris, bestraft durch meinen Vater und Meister. Und ich befand mich in der Hölle, von den Mächten dahingejagt. Wer war denn mein Meister? Swedenborg?
Ich blätterte in dem wunderbaren Buch weiter.
?Man vergleiche mit dieser Fabel die germanische Mythe von den Dornenfeldern, welche die Füsse der Ungerechten geisseln....
Genug! Genug! Die Dornen auch! Das ist zu viel!
Kein Zweifel, ich bin in der Hölle! Und wirklich bestätigt die Wirklichkeit diese Phantasie in einer so plausiblen Weise, dass ich ihr schliesslich glauben muss.
Der Docktor scheint zwischen den verschiedensten Gefühlen zu schwanken. Bald ist er gegen mich eingenommen, sieht mich über die Achsel an, behandelt mich mit einer demütigenden Brutalität; bald ist er selbst ganz unglücklich und pflegt und tröstet mich wie ein krankes Kind. Ein anderes Mal freut er sich, einen Mann von Verdienst, den er früher geschätzt hat, unter die Füsse treten zu können. Dann macht er den Henker und predigt mir vor.
—Man muss arbeiten, man muss einen übertriebenen Ehrgeiz unterdrücken, man muss seine Pflicht gegen Vaterland und Familie erfüllen. Lass die Chemie; es ist eine Chimäre, es gibt so viel Spezialisten, die Autoritäten sind, Gelehrte von Beruf, die ihre Sache verstehen....
Eines Tages schlägt er mir vor, für die letzte Stockholmer Zeitung zu schreiben.
—Die zahlt!
Ich antworte ihm, ich habe es nicht nötig, Artikel für die letzte Stockholmer Zeitung zu schreiben, da das erste Blatt von Paris und der Welt mein Manuskript angenommen habe.
Da stellt er sich zweifelnd und behandelt mich als Aufschneider, obwohl er meine Artikel im Figaro gelesen und meinen Leitartikel im Gil Blas selbst übersetzt hat.
Ich bin ihm nicht böse: er spielt nur die Rolle, die ihm die Vorsehung auferlegt hat.
Ich tue mir Gewalt an, den Hass, der gegen diesen unvermuteten Dämon wächst, zu unterdrücken, und ich verwünsche das Schicksal, das meine Gefühle der Dankbarkeit gegen einen hochherzigen Freund in Undankbarkeit zu kehren sucht.
Kleinigkeiten erneuern unaufhörlich den Argwohn, den ich über die böswilligen Absichten des Doktors hege.
Heute hat er auf der Veranda, die auf den Garten hinaus geht, Äxte, Sägen, Hämmer gelegt, ganz neue, die zu nichts dienen. Zwei Gewehre und ein Revolver in seinem Schlafzimmer, und in einem Korridor noch eine Sammlung Äxte, die zu gross sind, um im Haushalt verwendet zu werden. Welcher teuflische Zufall, dass dieser Folterapparat meinen Blicken ausgesetzt ist! Der beunruhigt mich, weil er keinen Zweck hat und ungewöhnlich ist.
Die Nächte sind ziemlich ruhig für mich geworden, während der Doktor beunruhigende Wanderungen zu machen beginnt. So werde ich mitten in der dunkelsten Nacht durch einen Flintenschuss geweckt. Taktvoll, tue ich, als habe ich nichts gehört. Am Morgen erklärt er mir die Sache: ein Volk Elstern sei in den Garten gekommen und habe seinen Schlaf gestört.
In einer anderen Nacht stösst die Haushälterin um zwei Uhr morgens heisere Schreie aus.
In einer dritten Nacht seufzt der Doktor, indem er den "Herrn Zebaoth" anruft.
Bin ich in einem Spukhaus, und wer hat mich hierher geschickt?
Ich kann ein Lächeln nicht unterdrücken, wenn ich beobachte, wie der Alp, der mich besessen hat, sich meiner Gefangenenwächter bemächtigt. Aber die ruchlose Freude wird bald bestraft. Ein furchtbarer Anfall überrascht mich; ich erwache davon, dass mein Herzschlag stockt, und höre Worte, die ich in meinem Tagebuch notiert habe. Eine unbekannte Stimme ruft: "Drogist Luthardt"!
Drogist! Vergiftet man mich langsam mit Alkaloiden, die Wahnsinn hervorrufen, wie Bilsenkraut, Haschisch, Digitalin, Stechapfel?
Ich weiss es nicht; aber seitdem verdoppelt sich mein Argwohn.
Man wagt mich nicht zu töten, man will mich nur verrückt machen, durch List, um mich dann in einem Irrenhaus verschwinden zu lassen. Der Schein spricht mehr und mehr gegen den Doktor. Ich entdecke, dass er meine Goldsynthese entwickelt hat, so entwickelt hat, dass er weiter gekommen ist als ich. Übrigens alles, was er sagt, widerspricht sich im nächsten Augenblick, und seine Lügen gegenüber nimmt meine Phantasie den Zaum zwischen die Zähne und fliegt über die Grenzen der Vernunft.
Am 8. August mache ich meinen Morgenspaziergang vor der Stadt. An der Chaussée singt eine Telegraphenstange; ich trete näher, lege mein Ohr daran und lausche wie bezaubert. Am Fuss der Stange liegt zufällig ein Hufeisen. Ich hebe es auf als ein gutes Zeichen und nehme es mit nach Haus.
10 August.—Am Abend wünsche ich dem Doktor, dessen Benehmen mich in den letzten Tagen mehr als je beunruhigt hat, eine gute Nacht. In geheimnisvoller Weise hat er mit sich selbst gekämpft; sein Gesicht ist fahl geworden, seine Augen sind erloschen. Den ganzen Tag über singt oder pfeift er; ein Brief, den er empfing, hat einen starken Eindruck auf ihn gemacht.
Am Nachmittag kommt er von einer Operation nach Haus, seine Hände sind mit Blut befleckt, er bringt einen zwei Monate alten Fötus mit. Er sah wie ein Schlächter aus und sprach in einer unangenehmen Weise über die Befreiung der Mutter.
—Die Schwachen töten und die Starken beschützen! Fort mit dem Mitleid, es bringt die Menschheit herunter!
Ein Schrecken hat mich vor ihm erfasst. Nachdem wir uns an der Tür, die unsere beiden Zimmer trennt, gute Nacht gesagt haben, spähe ich nach ihm. Zuerst geht er in den Garten, ohne dass ich hören kann, was er dort macht. Dann tritt er in die Veranda, die neben meinem Schlafzimmer liegt, und bleibt dort. Er hantiert mit einem ziemlich schweren Gegenstand und zieht eine Feder auf, die nicht zu einer Uhr gehört. Alles geht leise vor sich, was auf Geheimniskrämerei oder verdächtige Arbeit deutet.
Halb entkleidet, erwarte ich stehend und unbeweglich, meinen Atem anhaltend, die Wirkung dieser geheimnisvollen Vorbereitungen.
Da, durch die Wand, die mein Bett berührt, strahlt das gewöhnliche und wohlbekannte Fluidum, betastet meine Brust und sucht das Herz. Die Spannung wächst ... ich nehme meine Kleider, schlüpfe durchs Fenster und kleide mich erst an, als ich die Pforte hinter mir habe.
Wiederum auf der Strasse, auf dem Pflaster, die letzte Zuflucht, den einzigen Freund verlassend. Ich gehe und gehe, ohne ein Ziel zu haben. Als ich zu mir komme, gehe ich geradeswegs zum Arzt der Stadt. Ich muss läuten, ich muss warten, und ich bereite mich auf meine Aussage vor, da ich meinen Freund nicht anklagen will.
Endlich erscheint der Doktor. Ich entschuldige mich wegen meines nächtlichen Besuches: aber Schlaflosigkeit und Herzklopfen bei einem Kranken, der das Vertrauen zu seinem Arzt verloren hat usw.... Mein guter Freund, dessen Gastfreundschaft ich angenommen habe, behandle mich als eingebildet Kranken und wolle mich nicht anhören.
Als habe er meinen Besuch erwartet, ladet der Doktor mich ein, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, und bietet mir eine Zigarette und ein Glas Wein an.
Es ist eine Befreiung für mich, wie ein wohlerzogener Mensch empfangen zu werden, nachdem man mich wie einen elenden Idioten behandelt hat. Wir plaudern zwei Stunden, und der Arzt enthüllt sich als Theosoph, dem ich alles mitteilen kann, ohne mich blosszustellen.
Schliesslich, etwas nach Mitternacht, erhebe ich mich, um ein Hotel aufzusuchen. Der Doktor rät mir, nach Haus zurückzukehren.
—Niemals! Er wäre fähig, mich zu töten!
—Wenn ich Sie begleite?
—Dann haben wir zusammen das Feuer des Feindes auszuhalten. Aber er wird mir nie verzeihen.
—Gehen wir jedenfalls!
So kehre ich auf meinen Spuren zurück. Da ich die Tür geschlossen finde, klopfe ich.
Als nach einer Minute mein Freund öffnet, da, bin ich es, der von Mitleid ergriffen wird. Er, der Chirurg, gewohnt, Leiden zu verursachen, ohne Mitleid zu empfinden, der Verkünder des überlegten Mordes, er sieht kläglich aus, ist blass wie eine Leiche; er zittert und stammelt; als er den Doktor, der hinter mir steht, erblickt, sinkt er zusammen, von einem Schrecken ergriffen, der mich mehr entsetzt, als alle vorhergehenden Schauder.
Ist es möglich, dass dieser Mann einen Mord beabsichtigt hat und dass er die Entdeckung fürchtete? Nein, das ist unmöglich, ich weise diesen Gedanken zurück: er ist ruchlos.
Nachdem wir nichtssagende Worte ausgetauscht haben, die von meiner Seite fast läppisch sind, trennen wir uns, um schlafen zu gehen.
Es gibt im Leben so schreckliche Zwischenfälle, dass die Seele sich in dem Augenblick weigert, die Spur zu bewahren; aber der Eindruck bleibt und tritt bald mit unwiderstehlicher Kraft wieder zum Vorschein.
So kommt mir, als ich nach Hause zurückkehre, plötzlich eine Szene wieder, die sich im Salon des Doktors zutrug, als ich ihn in der Nacht aufsuchte.
Der Doktor verlässt mich um Wein zu holen; allein im Zimmer, betrachte ich einen Schrank mit Füllungen, deren Getäfel aus Nussbaum oder Erle gearbeitet ist, ich weiss es nicht mehr genau. Wie gewöhnlich bilden die Holzfasern Figuren. Hier zeigt sich ein Bockskopf in meisterhafter Ausführung. Ich kehre ihm gleich den Rücken. Pan selbst, nach den Überlieferungen der Alten; Pan, den das Mittelalter später in Satan verwandelte: der war es wohl!
Ich beschränke mich hier darauf, die Tatsache zu erzählen; der Arzt, der Besitzer des Schrankes, würde der Geheimwissenschaft einen Dienst leisten, wenn er die Füllung photographieren liesse. Dr. Mac Haven hat sich in der "Initiation" (November 1896) mit diesen Erscheinungen beschäftigt, die in allen Naturreichen so gewöhnlich sind. Ich empfehle dem Leser, das Gesicht, das auf dem Rückenschild der Krabbe gezeichnet ist, genau zu betrachten.
Nach diesem Abenteuer zeigt sich eine offenbare Feindseligkeit zwischen meinem Freund und mir. Er gibt mir zu verstehen, dass ich faulenze und dass meine Anwesenheit überflüssig sei. Ich antworte ihm, dass ich bereit sei, in ein Hotel zu gehen, um wichtige Briefe abzuwarten. Da spielt er den Beleidigten.
In Wirklichkeit kann ich mich vor Geldmangel nicht rühren. Übrigens ahne ich, dass in meinem Schicksal eine Änderung bevorsteht.
Meine Gesundheit ist wiederhergestellt: ich schlafe nachts ruhig und arbeite am Tage.
Der Zorn der Vorsehung scheint vertagt zu sein, und meine Versuche gelingen in allem. Wenn ich zufällig ein Buch aus der Bibliothek des Doktors hole, enthält es immer die gesuchte Erklärung. So finde ich in einer alten Chemie das Geheimnis meiner Art, Gold zu machen; nun kann ich durch die Metallurgie, mit Berechnungen und Analogien, beweisen, dass ich Gold gemacht habe, und das man immer Gold gemacht hat, wenn man es aus Erzen zu gewinnen geglaubt hat. man es aus Erzen zu gewinnen geglaubt hat.
Ein Aufsatz, den ich über das Thema ausgearbeitet habe, wird an eine französische Zeitschrift gesandt, die ihn sofort druckt. Ich beeile mich, den Artikel dem Doktor zu zeigen; er kann die Tatsache nicht leugnen, ist aber gegen mich eingenommen.
Da muss ich mir sagen, dass er nicht mehr mein Freund ist, da meine Erfolge ihm unangenehm sind.
12. August.—Ich kaufe beim Buchhändler ein Album. Es ist eine Art Notizbuch, in bearbeitetes und vergoldetes Leder prächtig gebunden. Die Zeichnung erregt meine Aufmerksamkeit und—seltsam!—bildet ein Vorzeichen, dessen Deutung in der Folge gegeben werden wird. Die künstlerisch ausgeführte Komposition stellt dar: links den zunehmenden Mond im ersten Viertel, von einem blühenden Zweig umgeben; drei Pferdeköpfe (trijugum) gehen vom Monde aus; darüber ein Lorbeerzweig; unten drei Streifen (drei mal drei); rechts eine Glocke, aus der Blumen hervorquellen, ein Rad in der Form einer Sonne usw....
13. August.—Der Tag, den die Uhr auf dem Boulevard Saint-Michel angekündigt hat, ist da. Ich erwarte irgendein Ergebnis, aber vergebens. Doch bin ich sicher, dass irgendwo etwas geschehen ist, dessen Ergebnisse mir binnen kurzem mitgeteilt werden.
14. August.—Auf der Strasse finde ich ein Blatt, das aus einem alten Kontorkalender gerissen ist; es trägt in grossen Buchstaben: 13. August. (Das Datum der Uhr.) Darunter in kleinen Buchstaben: "Tue niemals heimlich, was du nicht öffentlich tun würdest." (Die schwarze Magie!)
15. August.—Ein Brief von meiner Frau. Sie beweint mein Schicksal; sie liebt mich noch immer und sie hofft unseres Kindes wegen, dass sich die Verhältnisse bessern werden. Ihre Eltern, die mich früher gehasst haben, sind nicht gefühllos gegen meine Leiden: ich bin eingeladen, mein Töchterchen, diesen Engel, der auf dem Lande bei den Grosseltern wohnt, zu sehen.
Das ruft mich ins Leben zurück! Mein Kind, meine Tochter nimmt für mich die erste Stelle ein, selbst vor der Gattin. Das arme unschuldige Kind, dem ich Böses habe tun wollen, umarmen, es um Verzeihung bitten, ihm das Dasein durch die kleinen Aufmerksamkeiten des Vaters erheitern, der seine seit Jahren aufgesparte Zärtlichkeit verschwenden möchte! Ich fange wieder an zu leben, ich erwache endlich aus einem bösen Traum, und ich begreife den wohlwollenden Willen des gestrengen Herrn, der mich mit harter und weiser Hand bestraft hat. Jetzt begreife ich die dunkeln und erhabenen Worte Hiobs: "Glücklich der Mann, den Gott züchtigt!"
Glücklich; denn um die "andern" kümmert er sich nicht.
Ich weiss nicht, ob ich dort unten an der Donau meine Frau treffen werde; das ist mir beinahe gleichgültig geworden, weil unsere Charaktere sich doch nicht vertragen. Ich rüste mich zu meiner Pilgerfahrt, denn ich weiss wohl, dass es eine Büsserreise ist und dass mir neue Golgathas bestimmt sind.
Dreissig Tage der Marter, dann öffnen sich die Türen der Folterkammer. Ich scheide ohne Bitterkeit von meinem Freund und meinem Henker. Er ist nur die Geissel der Vorsehung für mich gewesen.
Glücklich der Mensch, den Gott züchtigt!...
In Berlin bringt mich eine Droschke vom Stettiner zum Anhalter Bahnhof. Auf der halbstündigen Durchfahrt ist es mir, als führe ich durch eine Dornenhecke, soviel leibhaftige Erinnerungen bedrängen mein Herz. Zuerst fahre ich durch die Strasse, in der mein Freund Popoffsky mit seiner ersten Frau wohnte, unbekannt oder vielmehr verkannt, mit dem Elend und den Leidenschaften kämpfend. Jetzt ist die Frau tot, sein Kind ist tot, in diesem Haus linkst war es; und unsere Freundschaft hat sich in wilden Hass verwandelt.
Hier rechts die Bierstube der Künstler und Schriftsteller, der Schauplatz so vieler Geistes-und Liebesorgien.
Dort die Cantina Italiana, wo ich vor drei Jahren meine damalige Braut zu treffen pflegte; dort haben wir das erste Honorar, das ich aus Italien erhielt, in Chianti verwandelt.
Dort der Schiffbauerdamm mit der Pension Fulda, wo wir als junges Ehepaar wohnten. Hier mein Theater, mein Buchhändler, mein Schneider, mein Apotheker.
Welch unseliger Instinkt treibt den Kutscher mich durch diese via dolorosa, die mit begrabenen Erinnerungen gepflastert ist, zu fahren? Zu dieser nächtlichen Stunde werden die Erinnerungen wieder lebendig wie Gespenster. Ich kann nicht erklären, warum er gerade diese Gasse fährt, in der unsere Weinstube "Das schwarze Ferkel" liegt, einst berühmt als Lieblingslokal von Heine und E. T. A. Hoffmann. Der Wirt steht selber auf der Treppe unter dem Ungetüm, das als Firmenschild in der Luft hängt. Er sieht mich ohne mich zu erkennen! Eine Sekunde lang wirft der Kronleuchter von drinnen seine durch die hundert Flaschen der Auslage gefärbten Strahlen und lässt mich ein Jahr meines Lebens, das reichste an Kummer und Freude, Freundschaft und Liebe, wieder erleben. Zugleich aber fühle ich lebhaft, dass dies alles zu Ende ist und begraben bleiben muss, um Neuem Platz zu machen.
Ich schlafe diese Nacht in Berlin. Als ich am nächsten Tag erwache, grüsst mich über den Dächern vom östlichen Himmel ein rosiger, hochrosenroter Schein. Da erinnere ich mich, diese Rosenfarbe in Malmö, am Abend meiner Abreise gesehen zu haben. Ich verlasse dieses Berlin, das meine zweite Heimat geworden ist, wo ich meine seconda primavera und zugleich den letzten Frühling erlebt habe. Auf dem Anhalter Bahnhuf lasse ich mit diesen Erinnerungen jede Hoffnung auf einen neuen Frühling und eine neue Liebe, die niemals, niemals wiederkehren werden.
Nachdem ich eine Nacht in Tabor, wohin mir der rosige Schein gefolgt ist, verbracht habe, steige ich durch den Böhmerwald nach der Donau hinab. Dort hört die Bahn auf, und im Wagen dringe ich in diese Tiefebene ein, welche die Donau bis nach Grein begleitet; zwischen Apfel- und Birnbäumen, Getreidefeldern und grünen Wiesen fahre ich dahin. DA entdecke ich in der Ferne, auf einem Hügel jenseits des Flusses, die kleine Kirche, die ich nie besucht habe, die aber den höchsten Punkt der Landschaft bildet; diese Landschaft breitet sich vor dem Häuschen aus, in dem mein Töchterchen geboren wurde, in jenem unvergesslichen Mai vor zwei Jahren.
Ich fahre durch Dörfer, komme durch Marktflecken und Klöster. Den Weg begleiten unzählige Sühnkapellen, Kalvarienberge, Weihbilder; Denksteine über Unglücksfälle, Blitzschläge, plötzlichen Tod. Und am Ende dieser Pilgerfahrt, dort unten in der Ferne, erwarten mich sicherlich die zwölf Stationen von Golgatha.
Der Gekreuzigte mit der Dornenkrone grüsst mich jede hundert Schritte, ermutigt mich und fordert mich auf, Kreuz und Leiden auf mich zu nehmen.
Jetzt töte ich mein Fleisch ab, indem ich mir von vornherein sage, dass sie, wie ich schon wusste nicht da sein wird.
Da meine Frau das Familiengewitter nicht mehr abwendet, muss ich mir von den alten Eltern, die ich tief verletzt habe, weil ich nicht einmal Abschied von ihnen hatte nehmen wollen, Gleiches mit Gleichem vergelten lassen. Ich lange also an, in dem ich mich darein finde, dass ich bestraft werde, um Frieden zu gewinnen; als ich das letzte Dorf und das letzte Kruzifix hinter mir gelassen habe, ahne ich die Todesqualen es Verurteilten.
Einen Säugling von sechs Wochen hatte ich verlassen, und ein kleines Mädchen von zweieinhalb Jahren finde ich wieder. Bei der ersten Begegnung prüft sie mich bis auf den Grund der Seele, mit einer ernsten, aber nicht strengen Miene, deutlich um zu sehen, ob ich ihretwegen oder um ihre Mutter gekommen sei. Nachdem sie sich vergewissert hat, lässt sie sich küssen und schlingt ihre Ärmchen um meinen Hals.
Das ist Fausts Erwachen zum irdischen Leben, aber lieblicher und reiner: ich nehme die Kleine immer wieder in meine Arme und fühle ihr Herzchen gegen meines schlagen. Ein Kind lieben, heisst für den Mann zum Weibe werden, das Männliche ablegen, die geschlechtslose Liebe der Himmlischen empfinden, wie Swedenborg sie nennt. Dadurch beginnt meine Erziehung für den Himmel. Aber zuerst die Sühne!
Die Situation ist in wenigen Worten diese: meine Frau wohnt bei ihrer verheirateten Schwester, weil die Grossmutter, die im Besitz der Erbschaft ist, geschworen hat, unsere Ehe auflösen zu lassen; so hasst sie mich wegen meiner Undankbarkeit und noch anderer Dinge. Ich bin willkommen bei dem Kinde, das niemals aufhören wird, mein zu sein, und ich bin der Gast meiner Schweigermutter für unbestimmte Zeit. Ich nehme die Situation hin, wie sie ist, und zwar mit Vergnügen. Meine Schwiegermutter hat mir mit dem versöhnlichen und ergebenen Geist einer tief religiösen Frau alles verziehen.
1. September 1896.—Ich bewohne das Zimmer, in dem meine Frau diese beiden Jahre der Trennung zugebracht hat. Hier hat sie gelitten, während ich meine Qualen in Paris durchmachte. Arme, arme Frau! Ist es die Strafe für das Verbrechen, das wir begingen, als wir mit der Liebe spielten?
Am Abend fällt beim Essen dies vor. Um meinem Töchterchen, das sich nicht ganz allein bedienen kann, zu helfen, nehme ich ihre Hand, ganz sanft und in der freundlichsten Absicht. Sie stösst einen Schrei aus, zieht ihre Hand zurück und wirft mir einen Blick voll Schrecken zu. Als die Grossmutter fragt, was sie hat, antwortet sie:
—Er tut mir weh!
Ich bin bestürzt und kann kein Wort hervorbringen. Wie oft habe ich mit Willen weg getan: sollte ich jetzt weh tun, ohne es zu wollen?
In der Nacht träume ich von einem Adler, der mir die Hand zerreisst, zur Züchtigung für ein unbekanntes Vergehen.
Am Morgen besucht mich mein Töchterchen; sie ist zärtlich, liebevoll, freundlich. Sie nimmt den Kaffee mit mir und macht es sich an meinem Schreibtisch bequem, wo ich ihr Bilderbücher zeige.
Wir sind schon gute Freunde, und meine Schwiegermutter ist entzückt, dass ihr jemand die Kleine erziehen hilft.
Am Abend muss ich dem Schlafengehen meines Engels beiwohnen und ihm seine Gebete sprechen hören. Sie ist katholisch, und wenn sie mich auffordert, zu beten und das Zeichen des Kreuzes zu machen, kann ich nicht antworten, denn ich bin Protestant.
2. September.—Allgemeine Aufregung. Die Mutter meiner Schwiegermutter, die einige Kilometer weit am Ufer des Flusses wohnt, will einen Ausweisungsbefehl gegen mich erlassen. Sie verlangt, dass ich sofort abreise, und droht ihre Tochter zu enterben, falls ich nicht gehorche. Die Schwester meiner Schwiegermutter, eine gute Frau, die auch getrennt von ihrem Manne lebt, ladet mich ein, bei ihr im benachbarten Dorf zu wohnen, bis der Sturm sich gelegt habe. Zu diesem Zweck kommt sie, um mich abzuholen.
Wir steigen auf einen zwei Kilometer langen Hügel; als wir auf dem Gipfel angekommen sind, entdecken wir unten einen runden Talkessel, aus dem sich unzählige mit Fichten bestandene Hügel wie Krater eines Vulkans erheben. In der Mitte dieses Trichters liegt das Dorf mit seiner Kirche, und auf der Höhe des steilen Berges das Schloss mit dem Stiel einer mittelalterlichen Burg; eingeschlossen sind hier und dort Felder und Wiesen, und ein Bach bewässert sie, der sich unterhalb der Burg in eine Schlucht stürzt.
Der Anblick dieser seltsamen, einzigartigen Landschaft überrascht mich, und der Gedanke kommt mir: ich habe sie schon gesehen; aber wo? wo?
Auf der Zinkschale im Hotel Orfila! In Eisenoxid gezeichnet. Es ist dieselbe Landschaft, ohne Zweifel!
Meine Tante steigt mit mir ins Dorf hinunter, wo sie über eine Wohnung von drei Zimmer verfügt, in einem grossen Gebäude, das eine Bäckerei, eine Schlächterei, eine Schenke enthält. Das Haus ist mit einem Blitzableiter versehen, weil der Blitz vor einem Jahr den Boden eingeäschert hat.
Als meine gute Tante, die ebenso aufrichtig fromm wie ihre Schwester ist, mich in das für mich bestimmte Zimmer führt, bleibe ich, wie von einer Vision erregt, auf der Schwelle stehen. Die Wände sind rosa gestrichen, rosa wie die Morgenröte, die mich auf meiner Reise nicht verliess. Die Vorhänge sind rosa, und die mit Blumen besetzten Fenster lassen das Tageslicht gefärbt ins Zimmer fallen. Eine peinliche Sauberkeit waltet hier, und das altertümliche Bett mit seinem von vier Säulen getragenen Himmel ist das Lager einer Jungfrau. Das ganze Zimmer, mit der Art seiner Einrichtung, ist ein Gedicht, die Eingebung einer Seele, die nur halb auf dieser Erde lebt. Das Kruzifix ist nicht da; aber die Jungfrau Maria; und der Weihkessel behütet den Eingang gegen die bösen Geister.
Ein Gefühl von Scham erfasst mich, ich fürchte diese Phantasie eines reinen Herzens zu besudeln, das diesen Tempel der jungfräulichen Mutter auf dem Grabe ihrer einzigen, seit mehr als zehn Jahren begrabenen Liebe errichtet hat. Und ich versuche in schlecht gesetzten Worten das hochherzige Angebot abzulehnen.
Aber die gute Alte gibt nicht nach:
—Es wird dir gut tun, deine irdische Liebe der Liebe zu Gott zu opfern und der Zärtlichkeit, die du für dein Kind hegst. Glaube meinem Wort: diese Liebe ohne Dornen wird dir den Frieden des Herzens, die Heiterkeit des Gemüts wiedergeben, und unter dem Schutz der Jungfrau wirst du nachts ruhig schlafen.
Ich küsse ihr die Hand, zum Zeichen der Dankbarkeit für das Opfer, das sie mir bringt, und mit einer Zerknirschung, der ich mich nicht für fähig gehalten hätte, nehme ich im Ernst an. Ich bin überzeugt, dass ich von den Mächten begnadigt werde, da sie die zu meiner Bestrafung bestimmten Züchtigungen eingestellt haben.
Doch unter irgendeinem Vorwand behalte ich mir das Recht vor, eine letzte Nacht in Saxen zu schlafen und die Übersiedlung auf den nächsten Tag zu verschieben. Ich kehre also, von meiner Tante begleitet, zu meinem Kinde zurück. Auf der Dorfstrasse bemerke ich, dass der Blitzableiter und sein Leitungsdraht gerade über meinem Bett befestigt sind.
Welcher teuflische Zufall, der wie persönliche Verfolgung auf mich wirkt!
Zugleich bemerke ich, dass die Aussicht, die sich vor meinen Fenstern ausbreitet, keine andere ist als das Armenhaus mit seiner Bevölkerung alter entlassener Verbrecher, Kranker, Sterbender. Eine traurige Gesellschaft, eine düstere Zukunft habe ich da vor Augen.
Wieder in Saxen angelangt, sammle ich meine Sachen für die Abreise. Mit Bedauern verlasse ich den Wohnsitz meines Kindes, das mir so teuer geworden ist. Die Grausamkeit der alten Dame, mich von Weib und Kind zu trennen, erregt meinen ungerechten Unwillen; in einem Anfall von Zorn erhebe ich die Hand gegen ihr in Öl gemaltes Porträt, das über meinem Bett hängt. Eine dumpfe Verwünschung begleitet die Gebärde.
Zwei Stunden später bricht ein furchtbares Gewitter über dem Dorf aus; die Blitze kreuzen einander, der Regen giesst in Strömen, der Himmel ist schwarz.
Als ich am nächsten Morgen in Klam anlange, wo das rosa Zimmer mich erwartet, sehe ich eine Wolke in Drachenform über dem Haus meiner Tante schweben. Dann erzählt man mir, der Blitz habe ein nahes Dorf in Brand gesteckt und der Platzregen habe unsere Gemeinde verwüstet, die Heuschober verheert, die Brücken fortgeführt.
Am 10. September hat ein Zyklon Paris verwüstet, und unter welch seltsamen Umständen! Zuerst, bei völliger Stille, beginnt er hinter Saint-Sulpice im Luxemburggarten, besucht das Theater du Châtelet und die Polizeipräfektur und löst sich beim St. Ludwigs-Krankenhaus auf, nachdem er fünfzig Meter Eisengitter niedergebrochen hat.
Wegen des Zyklons und des früheren im Jardin des Plantes fragt mich mein Freund der Theosoph:
—Was ist ein Zyklon? Wallungen des Hasses, Schwingungen einer Leidenschaft, Ausströmungen eines Geistes?
Dann fügt er hinzu:
-Sind die um Papus sich ihrer Offenbarungen bewusst?
Ein Zufall, der mehr ist als ein Zufall: in einem Brief, der den meines Freundes kreuzt, richte ich an ihn, der in die Mysterien der Hindus eingeweiht ist, die direkte und bestimmte Frage:
—Können die weisen Hindus Zyklone hervorrufen?
Damals fing ich an, die in der Magie Eingeweihten in Verdacht zu haben, dass sie mich verfolgten, entweder weil ich Gold machen wollte, oder weil ich mich hartnäckig weigerte, mit unter irgend einer Form ihren Gesellschaften anzuschliessen. Die Lektüre von Rydbergs germanischer Mythologie und Hylten-Cavallius' "Wärend und Wirdarne" hatte mich belehrt, dass die Hexen in einem Sturme oder in einem kurzen und heftigen Windstoss zu erscheinen liebten.
Ich erwähne dies, um meinen Seelenzustand zu beleuchten, wie er zu dieser Zeit war, als ich noch nicht die Lehren Swedenborgs kennen gelernt hatte.
Das Heiligtum bereitet, weiss und rosa, und der Heilige wird bei seinem Schüler hausen, der es seinem Landsmann schuldig ist, die Erinnerung an den begabtesten Mann wiederzubeleben, der in der Neuzeit vom Weibe geboren ist.
Frankreich hat Ansgar ausgesandt, um Schweden zu taufen; tausend Jahre später hat Schweden Swedenborg gesandt, um Frankreich durch Vermittlung St. Martins, seines Schülers, wieder zu taufen. Der Martinistenorden, der seine Rolle bei der Gründung des neuen Frankreichs kennt, wird die Tragweite dieser Worte nicht verkennen, noch weniger die Bedeutung dieses Jahrtausends herabsetzen.
Meine Schwiegermutter und meine Tante sind zwei Zwillingsschwestern von vollkommener Ähnlichkeit; sie haben denselben Charakter, denselben Geschmack, dieselben Abneigungen; das geht so weit, dass die eine wie die Doppelgängerin der anderen aussieht. Wenn ich zu der einen in Abwesenheit der andern spreche, ist die Abwesende bald auf dem Laufenden; ich kann meine vertraulichen Mitteilungen gegen eine von beiden fortsetzen, ohne eine Einleitung nötig zu haben. Darum werfe ich sie in dieser Erzählung zusammen, die kein Roman ist mit stilistischen Ansprüchen und literarischer Komposition.
Am ersten Abend erzähle ich ihnen aufrichtig meine unerklärlichen Abenteuer, meine Zweifel, meine Qualen. Da rufen sie, mit einer gewissen Genugtuung in den Zügen, wie mit einem Mund aus:
—Du bist an einem Punkt angelangt, den wir schon passiert haben.
Von derselben Gleichgültigkeit gegen die Religion ausgehend, hatten sie den Okkultismus studiert. Von diesem Augenblick an schlaflose Nächte, geheimnisvolle, von Todesängsten begleitete Vorfälle, schliesslich nächtliche Krisen, Wahnsinnsanfälle. Die unsichtbaren Furien verfolgen die Jagd bis zum rettenden Hafen: das ist die Religion. Ehe sie aber so weit kommen, offenbart sich der Schutzengel, und das ist niemand anders als Swedenborg. Man nimmt mit Unrecht an, dass ich meinen Landsmann gründlich kenne; und, überrascht von meiner Unkenntnis, geben mir die guten Damen, jedoch nicht ohne Zögern, ein altes deutsches Buch.
—Nimm, lies und fürchte dich nicht!
—Fürchten? Was?
Als ich in meinem rosa Zimmer allein bin, öffne ich den alten Band aufs Geradewohl und lese. Ich überlasse es dem Leser, sich meine Gefühle vorzustellen, als meine Blicke auf eine Beschreibung der Hölle fallen, in der ich die Landschaft von Klam, die Landschaft meiner Zinkschale, wie nach der Natur gezeichnet, wiederfinde. Das kesselförmige Tal, die mit Fichten bestandenen Hügel, die düsteren Wälder, die Schlucht mit dem Bach, das Dorf, die Kirche, das Armenhaus, der Düngerhaufen, die Mistjauche, der Schweinestall, alles ist da.
Die Hölle? Aber ich bin in der tiefsten Verachtung gegen die Hölle erzogen; ich habe sie als eine Phantasie betrachten gelernt, die man wie andere Vorurteile verworfen hat. Und doch kann ich die Tatsache nicht leugnen, nur mit dem Unterschied, und das ist das Neue in der Auslegung der sogenannten ewigen Strafen: wir sind schon in der Hölle. Die Erde, das ist die Hölle, das von einer höheren Vernunft gebaute Gefängnis. Ich kann ja nicht einen Schritt gehen ohne das Glück der andern zu verletzen; und die andern können nicht glücklich bleiben, ohne mir Leiden zuzufügen.
So malt Swedenborg, vielleicht ohne es zu wissen, das irdische Leben, indem er die Hölle darstellen will.
Das Feuer der Hölle, das ist der Wunsch emporzukommen; die Mächte erwecken den Wunsch und erlauben den Verdammten, das zu erreichen, nach dem sie trachten. Sobald aber das Ziel erreicht und die Wünsche erfüllt sind erscheint alles wertlos, und der Sieg ist nichtig! Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist nur Eitelkeit. Nach der ersten Enttäuschung blasen die Mächte das Feuer der Begierde und des Ehrgeizes an, und nicht der ungestillte Hunger foltert am meisten, die gesättigte Begier flösst den Ekel an allem ein. So erleidet der Dämon eine endlose Strafe, weil er augenblicklich alles, was er wünscht, erhält, also sich nicht mehr darüber freuen kann.
Wenn ich Swedenborgs Beschreibung der Hölle mit den Qualen der germanischen Mythologie vergleiche, so finde ich eine augenscheinliche Übereinstimmung; aber für mich persönlich bildet allein die Tatsache, dass die beiden Bücher mich im selben Augenblick in Beschlag nehmen, das Wesentliche. Ich bin in der Hölle, und die Verdammnis lastet auf mir. Wenn ich meine Vergangenheit untersuche, sehe ich, dass schon meine Kindheit als Gefängnis und Folterkammer eingerichtet war. Und um die Martern zu erklären, die einem unschuldigen Kind auferlegt wurden, bleibt einem nichts anderes übrig, als ein früheres Dasein anzunehmen, aus dem wir wieder auf die Erde geworfen sind, um die Folgen vergessener Sünden zu sühnen.
Infolge einer Geschmeidigkeit des Geistes, die bei mir nur allzu häufig ist, dränge ich die Eindrücke, welche die Lektüre Swedenborgs in mir hervorgerufen hat, in die Tiefen meiner Seele zurück. Aber die Mächte geben mir keine Frist mehr.
Bei einem Spaziergang, den ich in die Umgebung des Dorfes mache, führt mich der Bach zu dem Hohlweg, der zwischen den beiden Bergen läuft und "Schluchtweg" heisst. Der Eingang, dem eingestürzte Felsen ein wahrhaft erhabenes Aussehen geben, zieht mich in ganz seltsamer Weise an. Der Berg, der die verlassene Burg trägt, stürzt senkrecht herab, um das Tor der Schlucht zu bilden, in dem der Bach in den Mühlfall übergeht. Durch ein Spiel der Natur hat der Felsen die Form eines Türkenkopfes angenommen; niemand der Bevölkerung bestreitet die Ähnlichkeit.
Weiter unten lehnt sich der Schuppen des Müllers an die Felswand des Berges. Am Türschloss hängt ein Bockshorn, das Wagenschmiere enthält: dicht daneben lehnt der Besen.
Obwohl dies alles natürlich und gewöhnlich ist, frage ich mich, welcher Teufel diese beiden Attribute der Hexen gerade dorthin gestellt hat und gerade diesen Morgen auf meinen Weg.
Niedergeschlagen gehe ich weiter auf dem feuchten und finstern Wege. Ein Holzhaus hält mich durch sein ungewöhnliches Aussehen auf. Es ist ein langer, niedriger Kasten mit sechs Ofentüren; Ofentüren!
—Um Gotteswillen, wo bin ich denn?
Das Bild der Danteschen Hölle spukt vor mir, mit den Särgen, in denen die Sünder rot geglüht werden ... und die sechs Ofentüren!!
Ein Alp? Nein, niedrige Wirklichkeit, die sich durch einen furchtbaren Gestank, einen Strom von Kot, einen Chor grunzender Schweine verrät.
Der Weg verengert sich, wird zu einem Gang zusammengedrängt, zwischen dem Berg und dem Haus des Müllers, gerade unter dem Türkenkopf.
Ich gehe weiter, aber im Hintergrund sehe ich eine mächtige dänische Dogge mit dem Fell eines Wolfes liegen, ganz ähnlich jenem Ungeheuer, welches das Atelier in der Rue de la Sante zu Paris bewachte.
Ich weiche zwei Schritte zurück; erinnere mich aber an den Wahlspruch des Jacques Coeur, "Einem tapferen Herzen ist nichts unmöglich", und dringe in die Schlucht ein. Der Cerberus tut, als sehe er mich nicht, und ich gehe weiter, jetzt zwischen zwei Reihen niedriger und düsterer Häuser. Da ist ein schwarzes Huhn ohne Schwanz und mit einem Hahnenkamm; dann eine Frau, die von weitem schön zu sein scheint und auf der Stirn einen blutroten Halbmond trägt; aus der Nähe gesehen, hat sie keine Zähne mehr und ist hässlich.
Wasserfall und Mühle machen einen Lärm, der dem Ohrensausen gleicht, das mich seit den ersten Pariser Unruhen verfolgt. Die Müllergesellen, weiss wie falsche Engel, bedienen das Räderwerk der Maschine wie Henker, und das grosse Schaufelrad tut seine Sisyphusarbeit, indem es das Wasser rinnen und rinnen lässt.
Dann kommt die Schmiede mit ihren nackten und schwarzen Schmieden, die mit Zangen, Haken, Kluppen, Hämmern bewaffnet sind, unter Feuer und Funken, glühendem Eisen und geschmolzenem Blei arbeiten: es ist ein Lärm, der das Gehirn in seinem Schädel erschüttert und das Herz im Brustkasten springen lässt.
Dann das Sägewerk und die grosse Säge, die mit den Zähnen knirscht, wenn sie auf der Folgerbank die riesigen Baumstämme martert, deren durchsichtiges Blut auf den klebrigen Boden rinnt.
Der Hohlweg läuft weiter am Bach entlang, durch den Wolkenbruch und Wirbelsturm verwüsten; die Überschwemmung hat die scharfen Kieselsteine, auf denen die Füsse ausgleiten, mit einer Schicht graugrünen Schlammes überzogen. Ich möchte das Wasser überschreiten, aber der Steg ist fortgerissen, und ich bleibe unter einem Abhang stehen; der überhängende Fels bedroht mit seinem Fall eine Jungfrau Maria, die mit ihren schwachen und göttlichen Schultern allein den unterwaschenen Berg hält.
Ich kehre auf meinen Spuren um, in tiefem Nachdenken über diese Verbindung von Zufällen, die zusammen ein grosses Ganzes bilden, das wunderbar ist, ohne übernatürlich zu sein.
Acht Tage und acht Nächte verlaufen ruhig in der Rosenkammer. Der Friede des Herzens kehrt wieder bei dem täglichen Besuch meines Töchterchens, das mich liebt, das geliebt wird und liebenswürdig ist; und meine Verwandten pflegen mich wie ein armes, verlorenes Kind.
Die Lektüre Swedenborgs beschäftigt mich am Tage. Der Realismus seiner Schilderungen zermalmt mich. Alles findet sich darin wieder, alle meine Beobachtungen, meine Eindrücke, meine Gedanken; seine Visionen scheinen mir erlebt zu sein, wie wahrhafte menschliche Dokumente. Es handelt sich nicht darum, blind zu glauben, es genügt, das Gelesene mit seinen eigenen erlebten Erfahrungen zu vergleichen.
Doch der Band, über den ich verfüge, enthält nur einen Auszug, und die Haupträtsel des geistigen Lebens werden mir erst später gelöst, als das Werk selber, "Arcana Coelestia", mir in die Hände fällt.
Während der Gewissenszweifel, die durch die Überzeugung, dass es einen Gott und Strafen gibt, erwacht sind, trösten mich einige Zeilen Swedenborgs, und alsbald bin ich bereit, mich zu entschuldigen und wieder hochmütig zu werden.
Am Abend also, als ich meiner Schwiegermutter beichte, sage ich zu ihr:
—Du hältst mich für einen Verdammten?
—Nein, obgleich ich noch nie ein Menschenschicksal wie deines gesehen habe. Aber du hast noch nicht den rechten Weg gefunden, der dich zum Herrn führen wird.
—Erinnerst du dich Swedenborgs und seiner Grundsätze des Himmels? Zuerst: die Herrschsucht, mit einem höheren Ziel. Das ist mein Herrschergeist, der nie nach weltlichen Ehren noch nach einer von der Gesellschaft verliehenen Macht getrachtet hat. Dann: die Liebe zu Glücksgütern und Geld, um das allgemeine Wohl fördern zu können. Du weisst, dass ich den Erwerb vernachlässigt und das Geld verachtet habe. Wenn ich Gold mache oder es machen sollte, so habe ich den Mächten geschworen, dass der Gewinn, wenn sich einer ergibt, menschenfreundlichen, wissenschaftlichen, religiösen Zwecken dienen wird. Schliesslich: eheliche Liebe. Muss ich noch sagen, dass sich seit meiner Jugend meine Gefühle für das Wie um die Idee der Ehe, der Gattin, der Familie gedreht haben? Dass das Leben mir das Los vorbehalten hat, die Witwe eines lebenden Mannes zu heiraten, ist eine Ironie, die ich nicht erklären kann; den Unregelmässigkeiten des Junggesellenlebens gegenüber kommt es nicht in Frage.
Nachdem sie einen Augenblick überlegt hatte, sagte die Alte:
—Was du sagst, kann ich nicht in Abrede stellen, und die Lektüre deiner Schriften hat mir einen Geist von hohem Streben gezeigt, der immer trotz seiner Anstrengung gescheitert ist. Sicher sühnst du Sünden, die vor deiner Geburt in einer andern Welt begangen sind. Du musst in einem früheren Leben ein grosser Menschentöter gewesen sein; darum wirst du tausend Male die Angst des Todes leiden, ohne jedoch zu sterben, bevor die Sühne vollendet ist. Jetzt bist du fromm, also ans Werk!
—Du meinst, ich soll die katholische Religion annehmen?
—Ohne Zweifel!
—Swedenborg sagt, es sei nicht erlaubt, die Religion seiner Väter zu verlassen, weil jeder zu dem geistigen Gebiet seines Volkes gehöre.
—Die katholische Religion ist eine höhere Gnade, die jedem, der sie sucht, bewilligt wird.
—Ich bin mit einem niedrigeren Grade zufrieden, und im schlimmsten Fall stelle ich mich vor den Thron hinter Juden und Mohammedaner, die auch zugelassen sind. Ich bleibe bescheiden!
—Die Gnade wird dir angeboten, und du ziehst das Linsengericht dem Erstgeburtsrecht vor!
—Die Erstgeburt für den Sohn der Magd? Das ist zu viel! viel zu viel!
Durch Swedenborg wieder aufgerichtet, bilde ich mir noch einmal ein, Hiob zu sein, der rechtschaffende und sittenreine Mann, der von dem Ewigen auf die Probe gestellt wird, um den Bösen zu zeigen, wie der redliche Mensch die unbilligen Leiden ertragen kann.
Dieser Gedanke erfüllt meinen Geist so, dass er sich von frommer Eitelkeit bläht. Ich rühme mich meiner widrigen Geschicke, die zu Ende gehen, und höre nicht auf, zu wiederholen: Seht, wie ich gelitten habe! Und ich beklage mich über den Wohlstand, den ich hier bei meinen Verwandten finde; die Rosenkammer ist ein bitterer Spott. Man macht sich lustig über meine aufrichtige Reue, indem man mich mit Wohltaten und kleinen Genüssen des Lebens überhäuft. In Summa: ich bin ein Auserwählter, Swedenborg hat es gesagt, und des Schutzes des Ewigen sicher, fordere ich die Dämonen heraus....
Acht Tage bin ich in dem rosa Zimmer, als die Nachricht ankommt, die Grossmutter, die am Ufer der Donau wohnt, sei krank geworden. Ein Leberleiden hat sie befallen, das von Erbrechen, Schlaflosigkeit und nächtlichen Herzkrisen begleitet ist. Meine Tante, deren Gast ich bin, wird zu ihr gerufen, und ich werde eingeladen, zu meiner Schwiegermutter nach Saxen zurückzukehren.
Ich wende ein, die Alte habe es verboten: aber sie scheint ihren Ausweisungsbefehl zurückgezogen zu haben, und es steht mir frei, zu weilen, wo ich will.
Dass die Grollende ihren Entschluss so plötzlich ändert, setzt mich in Erstaunen, und ich wage diesen glücklichen Umschwung nicht der ihr zugestossenen Krankheit zuzuschreiben.
Am nächsten Tag erzählt man, der Zustand der Kranken habe sich verschlimmert. Meine Schwiegermutter bringt mir als Zeichen der Versöhnung einen Blumenstrauss von ihrer Mutter, und sie vertraut mir an, die Alte bilde sich ein, eine Schlange im Magen zu tragen, habe auch andere Phantasien ähnlicher Art.
Dann erzählt man, der Kranken seien zweitausend Kronen gestohlen worden, und sie habe ihre vertraute Dienerin in Verdacht. Die ist entrüstet über den ungerechten Verdacht und will ihre Herrin wegen Verleumdung verklagen. Der häusliche Friede herrscht nicht mehr in dem Haus einer gebrechlichen Frau, die sich von der Welt zurückgezogen hat, um in Frieden zu sterben.
Jeder Bote bringt uns entweder Blumen oder Früchte oder Wildbret, Fasanen, Kücken, Hechte.
Ist es die göttliche Gerechtigkeit, die straft, und hat die Kranke eine Vorstellung davon? Erinnert sie sich, dass sie mich einmal auf die Landstrasse gestossen hat, die mich ins Krankenhaus führte?
Oder ist sie abergläubisch? Hält sie mich für fähig, sie behext zu haben? Sollten die angebotenen Geschenke nur Opfer sein, um den Rachedurst des Zauberers zu stillen?
Unglücklicherweise kommt gerade in diesem Augenblick ein Buch über Magie von Paris und gibt mir Auskunft über die Kunstgriffe, die man Behexung nennt. Der Autor rät dem Leser, sich nicht für unschuldig zu halten, weil er die magischen Kunstgriffe, die darauf hinauslaufen, jemand zu schaden, meide; man muss auch den bösen Willen überwachen, denn der genügt, um auf einen Menschen, auch wenn er abwesend ist, einen Einfluss auszuüben.
Diese Lehre hat für mich eine doppelte Folge: zuerst empfinde ich Gewissensskrupel, da ich in einer zornigen Regung die Hand gegen das Bild der Alten erhoben und eine Verwünschung ausgestossen hatte; dann erwacht wieder mein alter Argwohn, ich könnte selber der Gegenstand geheimer Freveltaten sein, nämlich von seiten der Okkultisten oder Theosophen.
Gewissensqual auf der einen Seite, Furcht auf der andern, und die beiden Mühlsteine beginnen mich feinzumahlen.
So schildert Swedenborg die Hölle. Der Verdammte bewohnt einen entzückenden Palast, findet das Leben lieblich und glaubt zu den Auserwählten zu gehören. Nach und nach lösen sich die Herrlichkeiten in nichts auf und verschwinden, und der Unglückliche bemerkt, dass er in einer elenden Baracke eingeschlossen ist, die Exkremente umgeben. (Siehe das Folgende.)
Dem rosa Zimmer habe ich Lebewohl gesagt, und als ich in ein grosses Zimmer einziehe, das neben dem meiner Schwiegermutter liegt, ahne ich, dass der Aufenthalt nicht von langer Dauer sein wird.
Tausend Kleinigkeiten, die das Leben unerträglich machen, vereinigen sich in der Tat, um mir die für meine Arbeit notwendige Ruhe zu rauben.
Die Bretter des Fussbodens schwanken unter meinen Schritten, der Tisch steht nicht fest, der Stuhl zittert, die Toilette wackelt, das Bett knarrt, und die andern Möbel bewegen sich, wenn ich durchs Zimmer gehe.
Die Lampe raucht, das Tintenfass ist so eng, dass der Federhalter sich beschmutzt. Es ist ein Landhaus, das Dünger, Jauche, Schwefelwasserstoffammoniak, Schwefelkohlenstoff ausdünstet. Den ganzen Tag hört man Kühe, Schweine, Kälber, Hühner, Puter, Tauben. Fliegen und Wespen stören mich am Tage, und nachts sind es die Mücken.
Beim Kaufmann des Dorfes ist fast nichts zu bekommen. Da ich keine bessere habe, muss ich ihre Tinte nehmen, die hochrosenrot ist! Seltsam: ein Päckchen Zigarettenpapier enthält zwischen hundert weissen Blättern ein rosenrotes Blatt (rosenrotes!).
Es ist die Hölle bei kleinem Feuer; gewohnt, die grossen Leiden zu ertragen, leide ich sehr unter diesen kleinlichen Stichen, um so mehr als meine Schwiegermutter mich trotz ihrer sorgsamen Pflege unzufrieden glaubt.
17. September.—Ich erwache in der Nacht davon, dass ich die Dorfkirche dreizehn Male schlagen höre. Sofort fühle ich die elektrische Einwirkung, und auf dem Boden über meinem Kopfe wird ein Geräusch hervorgebracht.
19. September.—Als ich den Boden durchsuche, entdecke ich ein Dutzend Spinnrocken, deren Räder mich an Elektrisiermaschinen erinnern. Ich öffne einen grossen Koffer: er ist beinahe leer und enthält nur fünf schwarz gestrichene Stäbe, deren Gebrauch mir unbekannt ist; in der Form eines Pentagramms liegen sie auf dem Boden. Wer hat mir diesen Streich gespielt, und was hat das zu bedeuten? Ich wage nicht danach zu fragen, und die Sache bleibt rätselhaft.
In der Nacht wütet ein furchtbares Gewitter zwischen Mitternacht und zwei Uhr. Gewöhnlich erschöpft sich ein Gewitter in kurzer Zeit und zieht davon; dieses bleibt zwei Stunden über dem Dorfe stehen. Ich empfinde das wie einen persönlichen Angriff: jeder Blitz zielt auf mich, ohne mich zu treffen.
An den Abenden erzählt mir meine Schwiegermutter die gegenwärtige Chronik der Gegend. Welche ungeheure Sammlung Tragödien, häuslicher und anderer! Ehebruch, Scheidung, Familienprozesse, Mord, Diebstahl, Vergewaltigung, Blutschande, Verleumdung. Die Schlösser, die Villen, die Hütten bergen Unglückliche aller Art, und ich kann nicht auf den Strassen spazieren gehen, ohne an die Hölle Swedenborgs zu denken. Bettler, Irre, Kranke, Krüppel halten die Gräben der grossen Landstrasse besetzt, zu Füssen eines Gekreuzigten, einer Madonna, eines Märtyrers kniend.
In der Nacht irren diese Unglücklichen, die unter Schlaflosigkeit und Alpdrücken leiden, auf den Wiesen und in den Wäldern umher, um die Müdigkeit zu finden, die ihnen Schlaf geben wird. Unter diesen Heimgesuchten sind Leute aus der guten Gesellschaft, wohlerzogene Damen, sogar ein Pfarrer.
Ganz in unserer Nähe liegt ein Kloster, das als Strafanstalt für gefallene Mädchen dient. Es ist ein wahres Gefängnis und hat die strengste Zucht. Im Winter, bei zwanzig Grad Kälte, müssen die Büsserinnen in ihren Zellen auf den eisigen Steinfliesen schlafen; und da das Heizen verboten ist, haben sich ihre Füsse und Hände mit aufgesprungenen Frostbeulen bedeckt.
Unter andern ist dort eine Frau, die mit einem Mönch gesündigt hat, und das ist eine Todsünde. Von Gewissensqual gepeinigt, zur Verzweiflung getrieben, läuft sie zum Beichtvater; der verweigert ihr aber die Beichte und Abendmahl. Für ihre Todsünde sei sie verdammt! Da verliert die Unglückliche den Verstand, bildet sich ein tot zu sein, irrt von Dorf zu Dorf, das Mitleid der Geistlichen anrufend, um in geweihter Erde bestattet zu werden. Verbannt, verjagt, geht und kommt sie, wie ein wildes Tier heulend; und das Volk das ihr begegnet, ruft: "Da ist die Verdammte!" Niemand zweifelt, dass ihre Seele schon im ewigen Feuer ist, während ihr Schatten hier umherstreift, eine wandernde Leiche, um als abschreckendes Beispiel zu dienen.
Man erzählt mir auch, dass ein Mann derart vom Teufel besessen war, dass der Unglückliche seine Persönlichkeit änderte: er war durch den bösen Geist gezwungen, Gotteslästerungen auszustossen, trotzdem ihm das den grössten Widerwillen einflösste. Nachdem man lange einen Beschwörer gesucht hat, entdeckt man einen jungen Franziskaner, jungfräulich und von anerkannter Herzensreinheit. Dieser bereitet sich durch Fasten und Bussübungen vor. Als der grosse Tag gekommen ist, führt man den Besessenen in die Kirche, und er beichtet vor allem Volk, coram populo. Dann macht sich der junge Mönch ans Werk. Indem er vom Morgen bis zum Abend betet und beschwört, gelingt es ihm, den Teufel auszutreiben. Unter welchen Umständen der Teufel geflohen ist, haben die entsetzten Zuschauer nicht zu erzählen gewagt. Ein Jahr darauf starb der Franziskaner.
Solche und noch schlimmere Geschichten bestärken mich in meiner Überzeugung, dass diese Gegend ein zum Büssen vorherbestimmter Ort ist, und dass es eine geheimnisvolle Beziehung zwischen diesem Lande und den Stätten gibt, die Swedenborg als Hölle malt. Hat er diesen Teil von Niederösterreich besucht und, gleichwie Dante die Gegend südlich von Neapel schildert, seine Hölle nach der Natur gezeichnet?
Nachdem ich vierzehn Tage gearbeitet und studiert habe werde ich noch einmal aus meinem Lager aufgestört. Da der Herbst sich nähert, wollen meine Tante und meine Schwiegermutter in Klam zusammenziehen. Wir brechen das Lager also ab. Um meine Unabhängigkeit zu wahren, miete ich ein Häuschen, das aus zwei Zimmern nebst einer Küche besteht, ganz in der Nähe meines Töchterchens.
Am ersten Abend, nachdem ich meine Wohnung in Besitz genommen habe, empfinde ich eine Angst, als sei die Luft vergiftet. Ich gehe zu meiner Mutter hinunter.
—Wenn ich dort oben schlafen gehe, werdet ihr mich morgen tot im Bett finden. Beherberge einen Obdachlosen für die Nacht, gute Mutter!
Sogleich wird mir das rosa Zimmer zur Verfügung gestellt; aber wie hat es sich seit der Abreise meiner Tante verändert! Schwarze Möbel; ein Büchergestell mit leeren Fächern, die mich wie ebensoviel Rachen angähnen; aus den Fenstern sind die Blumen verschwunden; ein gusseisener Ofen, hoch, dürr, schwarz wie ein Gespenst, mit den Ornamenten einer hässlichen Phantasie, Salamandern und Drachen. Es ist eine Disharmonie, die mich krank macht.
Übrigens fällt mir alles auf die Nerven, weil ich ein Mann von geregelten Gewohnheiten bin, der alles zu seiner Stunde tut. Trotzdem ich mir alle Mühe gebe, meinen Verdruss zu verbergen, weiss meine Mutter meine Geheimnisse zu lesen:
—Immer unzufrieden, mein Kind!
Sie tut ihr Möglichstes und mehr, um mich zufrieden zu stellen, aber die Geister der Zwietracht mengen sich ein, und nichts hilft. Sie erinnert sich meiner kleinen Liebhabereien, aber immer geht es verkehrt. So gibt es wenige Gerichte, die mir so zuwider sind, wie Bregen in brauner Butter.
-Heute habe ich etwas Gutes, besonders für dich, sagt sie.
Und sie legt mir Bregen in brauner Butter vor. Ich verstehe, dass es ein Missverständnis ist, und ich esse, aber mit einem schlecht verborgenem Widerwillen und einem erkünstelten Appetit.
—Du isst ja nichts!
Und sie füllt meinen Teller noch einmal ...
Das ist zu viel! Früher schrieb ich alle diese Plagen der weiblichen Bosheit zu; jetzt erkenne ich ihre Unschuld an und sage mir: es ist der Teufel!
Seit meiner Jugend widme ich meinen Morgenspaziergang Betrachtungen, mit denen ich mich auf die Arbeit des Tages vorbereite. Ich habe niemals jemand erlaubt, mich zu begleiten, nicht einmal meiner Frau.
Tatsächlich erfreut sich mein Geist des Morgens einer Harmonie und einer Expansion, die an Ekstase streift. Ich gehe nicht, ich fliege; der Körper hat alle Schwere verloren, alle Traurigkeit ist verdunstet: ich bin ganz Seele. Das ist meine Sammlung, meine Gebetstunde, mein Gottesdienst.
Jetzt, da ich alles opfern, mich selbst und meine billigsten Neigungen verleugnen muss, zwingen die Mächte mich, auf dieses Vergnügen, das letzte und höchste von allen, zu verzichten.
Es ist mein Töchterchen, das den Wunsch ausdrückt, mich zu begleiten. Ich lehne ihr Anerbieten ab, indem ich sie sehr zärtlich küsse, aber sie begreift nicht, warum ich mit meinen Gedanken allein sein möchte. Sie weint. Da kann ich ihr nicht mehr widerstehen und nehme sie mit auf den Spaziergang, aber entschlossen, diesen Missbrauch ihrer Rechte nicht wieder zu erlauben.
Ein Kind ist reizend, entzückend durch seine Ursprünglichkeit, seine Mutwilligkeit, seine Dankbarkeit für ein Nichts, wohl verstanden, wenn man nichts anderes zu tun hat. Wenn man aber mit seinen Gedanken beschäftigt ist, wenn man geistesabwesend ist, wie kann das kleine Ding uns mit seinen endlosen Fragen, seinen unvermuteten Launen die Seele zerreissen. Mein Töchterchen ist wie eine Geliebte auf meine Gedanken eifersüchtig; sie passt den Augenblick ab, da ihr Geplauder ein gut gesponnenes Gedankennetz zerreissen kann.... Doch nein, das ist nicht ihre Absicht, aber man unterliegt der Illusion, ein Raub der überlegten Anschläge einer armen unschuldigen Kleinen zu sein.
Ich gehe mit langsamen Schritten, ich fliege nicht mehr; meine Seele ist gefangen, mein Gehirn leer, wie ich mich anstrengen muss, um mich auf das Niveau des Kindes herabzulassen.
Was mich bis zur Marter leiden lässt, das sind die tiefen, vorwurfsvollen Blicke, die sie mir zuwirft, wenn sie sich einbildet, mir zur Last zu fallen und meine Abneigung zu erregen. Dann verfinstert sich das offene, freimütige, strahlende Gesichtchen, ihre Blicke ziehen sich zurück, ihr Herz schliesst sich, und ich fühle mich des Lichts beraubt, das dieses Kind in meine düstere Seele wirft. Ich küsse sie, ich trage sie auf meinen Armen, ich suche ihr Blumen und Kiesel; ich schneide eine Rute ab und spiele die Kuh, die sie auf die Weide treiben soll.
Sie ist glücklich, zufrieden, und das Leben lächelt mir. Ich habe meine Stunde der Sammlung geopfert! So sühne ich das Böse, das ich in einem wahnsinnigen Augenblick auf das Haupt dieses Engels herabziehen wollte.
Geliebt werden: die Sühne für ein Verbrechen! Wahrhaftig, die Mächte sind nicht so grausam wie wir!
Oktober, November 1896. Der Brahmane erfüllt seine Pflicht gegen das Leben, indem er ein Kind erzeugt. Dann geht er in die Wüste, um sich der Einsamkeit und der Entsagung zu weihen.
MEINE MUTTER.—was hast du, Unglücklicher, in deiner früheren Inkarnation getan, dass das Schicksal dich so schlecht behandelt?
ICH.—Rate! Erinnere dich eines Mannes, der zuerst mit der Frau eines andern verheiratet war, wie ich es gewesen bin; der sich dann von ihr trennt, um eine Österreicherin zu heiraten, wie ich es getan habe! Und dann entreisst man ihm seine liebe Österreicherin, wie man mir die meine geraubt hat, und beider einziges Kind wird am Abhang des Böhmerwaldes gefangen gehalten, wie mein Kind es wird. Erinnerst du dich an den Helden meines Romans "Am offenen Meer", der auf einer Insel mitten im Meer elend umkommt....
MEINE MUTTER.—Genug! Genug!
ICH.—Du weisst nicht, dass die Mutter meines Vaters Neipperg hiess....
MEINE MUTTER.—Schweig, Unglücklicher!
ICH.—... und dass meine kleine Christine dem grössten Menschenschlächter des Jahrhunderts auf ein Haar gleicht; sieh sie nur an, die Despotin, die mit ihren zweieinhalb Jahren schon Männer bändigt....
MEINE MUTTER.—Du bist toll!
ICH.—Ja! Und ihr Frauen, wie habt ihr früher gesündigt, da euer Los noch grausamer ist als unseres? Wie recht ich hatte, das Weib unsern bösen Dämon zu nennen. Jedem nach seinem Verdienst!
MEINE MUTTER.—Ja, es ist doppelte Hölle, Weib sein!
ICH.—Und doppelter Dämon ist das Weib. Übrigens ist die Reinkarnation eine christliche Lehre, die nur von der Geistlichkeit beiseite geschoben ist. Jesus Christus behauptet, Johannes der Täufer sei eine Reinkarnation von Elias. Ist das eine Autorität oder nicht?
MEINE MUTTER.—Allerdings; aber die römische Kirche verbietet das Forschen in dem Verborgenen!
ICH.—Und der Okkultismus erlaubt es, da die Wissenschaften erlaubt sind!
Die Geister der Zwietracht wüten. Trotzdem wir ihr Spiel genau kennen und von unserer gegenseitigen Unschuld überzeugt sind, hinterlassen die sich wiederholenden Missverständnisse einen bitteren Nachgeschmack.
Obendrein argwöhnen die beiden Schwestern, bei der Krankheit ihrer Mutter sei mein böser Wille im Spiel; weil ich kein Interesse daran habe, dass das Hindernis, das mich von meiner Frau trennt, fortgeräumt wird, können sie den ganz natürlichen Gedanken nicht unterdrücken, der Tod der Alten würde mir Freude machen. Dass dieser Wunsch überhaupt vorhanden ist, macht mich verhasst, und ich wage mich nicht mehr nach der Grossmutter zu erkundigen, aus Furcht, als Heuchler behandelt zu werden.
Die Situation ist gespannt, und meine alten Freundinnen erschöpfen sich in endlosen Erörterungen über meine Person, meinen Charakter, meine Gefühle, darüber, ob meine Liebe zu meinem Kind aufrichtig ist.
An einem Tage hält man mich für einen Heiligen, und die Narben in meinen Händen sind Wundmale. Tatsächlich gleichen die Zeichen in der Handfläche Löchern grober Nägel. Um aber jeden Anspruch auf Heiligkeit zurückzuweisen, sage ich, ich sei der gute Schächer, der vom Kreuz gestiegen sei und sich auf der Wallfahrt befinde, um das Paradies zu erringen.
An einem anderen Tage hat man über das Rätsel, das ich bin, gegrübelt und hält mich für Robert den Teufel. Ein Vorfall flösst mir die Furcht ein, die Bevölkerung werde mich steinigen. Hier der einfache Sachverhalt:
Meine kleine Christine hat eine übertriebene Furcht vor dem Schornsteinfeger. Eines Abends beginnt sie beim Essen plötzlich zu weinen, zeigt mit dem Finger auf einen Unsichtbaren hinter meinem Stuhl und schreit:
—Der Schornsteinfeger!
Meine Mutter, die an das Hellsehen von Kindern und Tieren glaubt, wird bleich; und ich, ich habe Furcht, besonders da ich bemerke, dass meine Mutter das Zeichen des Kreuzes über dem Haupt des Kindes macht.
Ein Todesschweigen folgt auf diesen Vorfall, der mir das Herz bedrückt.
Der Herbst mit seinem Sturm, Regen und Dunkel ist gekommen. Im Dorf und im Armenhaus verdoppeln sich die Kranken, die Sterbenden und die Toten. In der Nacht hört man das Glöckchen des Chorknaben, welcher der Hostie vorangeht. Am Tage läuten die Glocken der Kirche die Toten ein, und die Leichenzüge folgen dicht aufeinander. Zum Sterben traurig und düster ist das Leben. Und meine nächtlichen Anfälle beginnen wieder.
Man spricht Gebete für mich, man betet den Rosenkranz, und in meinem Schlafzimmer ist der Weihkessel mit Weihwasser gefüllt, das der Pfarrer gesegnet hat.
—Die Hand des Herrn ruht schwer auf dir!
Es ist meine Mutter, die mich mit dieser Anrede zermalmt.
Ich beuge mich, und ich richte mich wieder auf. Kraft einer eingewurzelten Zweifelsucht und eines geschmeidigen Geistes befreie ich meine Seele von diesen düsteren Vorstellungen. Nachdem ich gewisse okkultistische Schriften gelesen habe, bilde ich mir ein, von Elementargeistern, von Inkuben, Lamien verfolgt zu sein, die mich verhindern wollen, mein grosses alchimistisches Werk zu vollenden. Durch die Eingeweihten unterrichtet, verschaffe ich mir einen Dolch aus Dalmatien, und glaube nun gegen die bösen Geister gut bewaffnet zu sein.
Ein Schuhmacher des Dorfes, Atheist, Gotteslästerer, ist eben gestorben. Eine Dohle, die er besass, ist sich jetzt selbst überlassen und haust auf dem Dach eines Nachbarn. Während der Totenwache entdeckt man die Dohle im Zimmer, ohne dass die Anwesenden ihre Gegenwart erklären können. Am Tage der Beerdigung begleitet der schwarze Vogel den Leichenzug und auf dem Kirchhof setzt er sich während der Totenfeier auf den Deckel des Sarges.
Morgen folgt mir dieses Tier längs der Wege, was mich beunruhigt, da die Bevölkerung, abergläubisch ist. Eines Tages—es war ihr letzter—begleitet mich die Dohle durch die Strassen des Dorfes, indem sie hässliche Schreie ausstösst; dann und wann wirft sie grobe Worte dazwischen, die ihr der Gotteslästerer beigebracht hat. Da erscheinen zwei kleine Vögel, ein Rotkehlchen und eine Bachstelze, und verfolgen die Dohle von Dach zu Dach. Die Dohle rettet sich aus dem Dorf hinaus und flüchtet sich auf einen Schornstein einer Hütte. Im selben Augenblick springt ein schwarzes Kaninchen vor dem Hause auf und verschwindet im Grase.
Einige Tage später stellt man fest, dass die Dohle tot ist. Sie ist von den Gassenjungen getötet worden, die sie nicht leiden konnten, weil sie diebisch war.
Den ganzen Tag arbeite ich in meinem Häuschen, aber es scheint, dass die Mächte mir seit einiger Zeit ihre Gunst entzogen haben. Oft wenn ich eintrete, finde ich die Luft dick, wie vergiftet, und dann muss ich bei offener Tür und offenen Fenstern arbeiten. Mit einem warmen Mantel und einer Pelzmütze bekleidet, sitze ich am Tisch und schreibe, indem ich gegen die sogenannten elektrischen Anfälle kämpfe, die mir die Brust zusammendrücken und mir in den Rücken stechen. Oft ist mir, als stehe jemand hinter meinem Stuhl. Dann richte ich Dolchstösse nach hinten, indem ich mir einbilde, einen Feind zu bekämpfen. Das dauert bis fünf Uhr abends. Wenn ich über diese Stunde sitzen bleibe, wird der Kampf furchtbar; meine Kräfte sind erschöpft, und ich zünde meine Laterne an und steige zu meiner Mutter und meinem Kind hinunter.
Ein einziges Mal verlängere ich den Kampf bis sechs Uhr, um einen Artikel über Chemie zu vollenden, während ich wegen der dicken und erstickenden Luft meines Zimmers im Zuge sitze. Ein Marienkäfer, schwarz mit gelben Flecken, klettert auf einem Blumenstrauss herum, tastet, sucht einen Ausweg. Schliesslich lässt er sich auf mein Papier fallen und schlägt mit den Flügeln, ganz wie der Hahn, der auf der Kirche Notre-Dame-des-Camps in Paris steht. Dann kriecht er das Manuskript entlang, entert meine rechte Hand und klettert hinauf. Er blickt mich an und fliegt dann dem Fenster zu. An dem Kompass, der auf dem Tisch steht, sehe ich, dass er nach Norden fliegt.
—Gut sage ich mir, nach Norden also! Aber wenn ich will und wann es mir gefällt. Bist zu einer neuen Aufforderung bleibe ich, wo ich bin.
Als es sechs Uhr wird, ist es mir nicht mehr möglich, in diesem Spukhaus zu bleiben. Unbekannte Kräfte heben mich vom Stuhl, und ich muss das Haus räumen.
Es ist Allerseelen, gegen drei Uhr nachmittags; die Sonne scheint, die Luft ist ruhig. Die Prozession der Einwohner, voran die Geistlichkeit, die Fahnen und die Musik, bewegt sich nach dem Friedhof, um die Toten zu begrüssen. Die Glocken der Kirche fangen an zu läuten. Da bricht, ohne Vorzeichen, ohne dass sich eine Wolke an dem blassblauen Himmel gezeigt hätte, ein Sturm los. Das Fahnentuch klatscht gegen die Stangen, die Gewänder der in der Prozession gehenden Männer und Frauen sind ein Spiel des Windes, Staubwolken erheben sich in Wirbeln, die Bäume biegen sich....
Es ist ein wahres Wunder.
Ich fürchte mich vor der nächsten Nacht, und meine Mutter ist vorbereitet. Sie hat mir ein Amulett gegeben, damit ich es um den Hals trage. Es ist eine Madonna und ein Kreuz aus heiligem Holz, das zu dem Balken einer mehr als tausendjährigen Kirche gehört hat. Ich nehme es als ein kostbares Geschenk an, das aus gutem Herzen angeboten ist, aber ein Rest der Religion meiner Väter verbietet es mir, es um meinen Hals zu hängen.
Beim Abendessen, es ist gegen acht Uhr und die Lampe ist angesteckt, herrscht eine unglücksverheissende Stille in unserem kleinen Kreise. Draussen ist es dunkel, die Bäume schweigen. Ruhe überall.
Da dringt ein Windstoss, ein einziger, durch die Ritzen der Fenster und stösst ein Gebrüll aus, das dem Laut der Maultrommel ähnlich ist. Dann ist es zu Ende.
Meine Mutter wirft mir einen entsetzten Blick zu und drückt das Kind in ihre Arme.
In einer Sekunde begreife ich, was dieser Blick mir sagt: Weiche von uns, Verdammter, und ziehe nicht die rächenden Dämonen auf Unschuldige herab.
Alles stürzt ein; das einzige Glück, das mir geblieben ist, bei meinem Töchterchen zu weilen, wird mir genommen, und in dem traurigen Schweigen nehme ich in Gedanken Abschied vom Leben.
Nach dem Abendessen ziehe ich mich in das rosa Zimmer zurück, das jetzt schwarz ist, und bereite mich auf einen nächtlichen Kampf vor, denn ich fühle mich bedroht Durch wen? Ich weiss es nicht; aber ich fordere den Unsichtbaren heraus, wer es auch sei, der Teufel oder der Ewige, und ich werde mir ihm ringen, wie Jakob mit Gott.
Man klopft an die Tür: das ist meine Mutter, die eine schlechte Nacht für mich ahnt und mich einlädt, auf dem Sofa im Salon zu schlafen.
—Des Kindes Gegenwart wird dich retten!
Ich danke ihr, versichere aber, dass keine Gefahr ist und dass nichts mir Furcht einflösst, da mein Gewissen rein ist. Mit einem Lächeln wünscht sie mir eine gute Nacht.
Ich kleide mich wieder in Schlachtmantel, Mütze und Stiefel, fest entschlossen, in Kleidern zu schlafen, bereit, als tapferer Krieger, der dem Tod trotzt, nachdem er das Leben verachtet hat, zu sterben.
Gegen elf Uhr beginnt die Luft im Zimmer dick zu werden, und eine tödliche Angst bemächtigt sich meines Mutes. Ich öffne das Fenster: ein Luftzug droht die Lampe auszulöschen; ich schliesse es wieder.
Die Lampe beginnt zu singen, zu seufzen, zu wimmern. Dann Schweigen.
Da stösst ein Dorfhund klagende Laute aus; das bedeutet nach dem Volksglauben eine Totenklage.
Ich sehe zum Fenster hinaus: der grosse Bär ist allein sichtbar. Unten im Armenhaus brennt ein Licht, und eine alte Frau wartet, über ihre Handarbeit gebückt, auf die Befreiung; vielleicht fürchtet sie den Schlaf und die Träume.
Da ich müde bin, lege ich mich wieder auf mein Bett und versuche einzuschlafen. Bald wiederholt sich das alte Spiel. Ein elektrischer Strom sucht mein Herz, die Lungen hören auf zu arbeiten, ich muss aufstehen, wenn ich dem Tode entgehen will. Ich setze mich auf einen Stuhl, bin aber zu erschöpft, um lesen zu können; so sitze ich eine halbe Stunde starr da.
Dann entschliesse ich mich, bis der Morgen anbricht, spazieren zu gehen. Ich gehe hinunter. Die Nacht ist dunkel und das Dorf schläft; aber die Hunde schlafen nicht, und als einer von ihnen anschlägt, umringt mich die ganze Bande; ihre gähnenden Rachen und ihre funkelnden Augen zwingen mich zum Rückzug.
Als ich wieder die Tür meines Zimmers öffne, ist es mir, als sei die Stube von lebendigen und feindlichen Wesen bewohnt. Das Zimmer ist davon erfüllt, und ich glaube durch eine Menge zu dringen, als ich mein Bett zu erreichen suche; resigniert und zum Sterben entschlossen, falle ich darauf nieder.
Aber im letzten Augenblick, wenn der unsichtbare Geier mich unter seinen Schwingen ersticken will, reisst mich jemand vom Bett, und die Jagd der Furien beginnt wieder. Besiegt, zu Boden geschlagen, in Unordnung gebracht, verlasse ich das Schlachtfeld und weiche in dem ungleichen Kampf gegen die Unsichtbaren.
Ich klopfe an die Tür des Salons, der auf der anderen Seite des Flurs liegt. Meine Mutter, die noch auf ist und betet, kommt und öffnet.
Der Ausdruck, den ihr Gesicht annimmt, als sie mich bemerkt, flösst mir vor mir selbst ein tiefes Entsetzen ein.
—Du wünscht, mein Kind?
—Ich wünsche zu sterben, und dann verbrannt zu werden; oder vielmehr, verbrennt mich lebendig!
Kein Wort! Sie hat mich verstanden, sie bekämpft ihr Entsetzen: Mitleid und Barmherzigkeit der religiösen Frau tragen den Sieg davon, und mit eigener Hand macht sie das Sofa zurecht; dann zieht sie sich in ihr Zimmer zurück, wo sie mit dem Kinde schläft.
Zufällig—immer dieser teuflische Zufall!—steht das Sofa dem Fenster gegenüber, und derselbe Zufall hat es gewollt, dass keine Vorhänge da sind, dass also die schwarze Fensteröffnung, die in die Dunkelheit der Nacht hinausgeht, mich angähnt; und ausserdem ist es gerade dieses Fenster, durch das der Windstoss heute abend während des Essens geheult hat.
Am Ende meiner Kräfte angelangt, sinke ich auf mein Lager nieder, indem ich diesen allgegenwärtigen und unvermeidlichen Zufall verwünsche, der mich in der offenbaren Absicht verfolgt, den Verfolgungswahn hervorzurufen.
Ich ruhe mich fünf Minuten aus, indem ich die Augen auf das schwarze Viereck hefte, da gleitet das unsichtbare Gespenst über meinen Leib, und ich erhebe mich. Mitten im Zimmer bleibe ich stehen wie eine Statue, ich weiss nicht wie lange; in einen Säulenheiligen verwandelt, schlafe ich auf absonderliche Art.
Wer verleiht mir Kräfte, um mich leiden zu lassen? Wer versagt mir den Tod, um mich meinen Folterqualen auszuliefern?
Ist er es, der Herr über Leben und Tod, den ich beleidigt habe, als ich nach der Lektüre der "Freude zu sterben" Selbstmordversuche machte, da ich mich schon reif für das ewige Leben hielt?
Bin ich Phlegyas, der für seinen Hochmut zur Todesstrafe der Angst im Tartarus verurteilt wurde? Oder Prometheus, der durch den Geier bestraft ward, weil er den Sterblichen das Geheimnis der Mächte enthüllt hatte?
(Indem ich dies schreibe, denke ich an die Szene in der Passion Christi; die Soldaten speien ihm ins Gesicht; die einen geben ihm Backenstreiche, die andern schlagen ihn mit Ruten, indem sie sagen: Christus, weissage uns, wer hat dich getroffen!—Mögen sich meine Jugendgenossen an die Stockholmer Orgie erinnern, auf welcher der Schreiber dieses Buches die Rolle des Soldaten spielte....)
Wer hat ihn getroffen? Die Frage ohne Antwort, der Zweifel, die Ungewissheit, das Geheimnis: das ist meine Hölle.
Möge er sich enthüllen, auf das ich mit ihm kämpfe, ihm Trotz biete!
Aber gerade davor hütet er sich, um mich mit Wahnsinn zu schlagen, mich mit dem schlechten Gewissen, das mich überall Feinde suchen lässt, zu geisseln. Feinde, das sind die, welche durch meinen bösen Willen verletzt worden sind. Und jedesmal, wenn ich einen neuen Feind aufspüre, wird mein Gewissen getroffen.
Als mich am andern Morgen, nachdem ich einige Stunden geschlafen habe, das Geplauder meiner kleinen Christine weckt, ist alles vergessen, und ich widme mich meinen gewöhnlichen Arbeiten, die auf dem rechten Wege sind. Alles, was ich schreibe, wird alsbald gedruckt; das beruhigt mich über meinen gesunden Menschenverstand und meine Intelligenz.
Die Zeitungen verbreiten das Gerücht, dass ein amerikanischer Gelehrter eine Methode, Silber in Gold zu verwandeln, gefunden habe. Das befreit mich von dem Verdacht, ein Schwarzkünstler, ein Verrückter, ein Scharlatan zu sein.
In diesem Augenblick bietet mir mein Freund, der Theosoph, der mich bisher unterstützt hat, die Hand, um mich für seine Sekte zu gewinne.
Er schickt mir die "Geheimlehre" der Frau Blawatsky, indem er schlecht seine Unruhe verbirgt, dass er meine Ansicht kennen lernen möchte; auch ich bin unruhig, weil ich argwöhne, dass unsere freundschaftlichen Beziehungen von meiner Antwort abhängen.
Diese "Geheimlehre", ein Sammelsurium aller sogenannten okkulten Lehren, ein Ragout aller wissenschaftlichen Ketzereien neuer und alter Zeit, nichtig und wertlos, wenn die Dame ihre eigenen Ansichten, die albern sind, vorbringt, ist interessant durch die Zitate aus wenig bekannten Schriftstellern und verabscheuungswert durch die bewussten oder unbewussten Betrügereien und durch die Fabeln über die Existenz der Mahatmas. Es ist die Arbeit eines Mannweibes, das den Rekord des Mannes hat schlagen wollen und sich einbildet, Wissenschaft, Religion, Philosophie gestürzt und eine Isispriesterin auf den Altar des Gekreuzigten erhoben zu haben.
Mit aller Zurückhaltung und Schonung, die man einem Freunde schuldig ist, teile ich ihm meine Meinung mit. Ich erkläre ihm, dass der Kollektivgott Karma mir missfällt, dass ich aus diesem Grunde nicht einer Sekte beitreten könne, die den persönlichen Gott, der allein meine religiösen Bedürfnisse befriedigt, leugnet. Ein Glaubensbekenntnis verlangt man von mir, und obgleich ich überzeugt bin, dass mein Wort einen Bruch veranlassen und damit die Unterstützung aufheben wird, spreche ich aus, was ich denke.
Da verwandelt sich der aufrichtige, hochherzige Freund in einen Rachegeist, schleudert den Bannstahl gegen mich, droht mir mit okkulten Mächten, schüchtert mich durch Andeutung einer Strafe ein, weissagt wie ein heidnischer Opferpriester. Er schliesst damit, dass er mich vor ein okkultistisches Gericht ladet und mir schwört, dass ich den 13. November nicht vergessen werde.
Meine Lage ist schlimm: ich habe einen Freund verloren, und ich bin in Not gebracht. Durch einen teuflischen Zufall ereignet sich während unseres brieflichen Krieges noch dies:
Die Zeitung "Initiation" veröffentlicht einen Aufsatz von mir, in dem ich das heutige astronomische System kritisiere. Einige Tage darauf stirbt Tisserand, der Direktor der Pariser Sternwarte. In einer Anwandlung von Ausgelassenheit stelle ich diese beiden Tatsachen zusammen und erinnere daran, dass Pasteur am Tage nach dem Erscheinen von "Sylva Sylvarum" starb. Mein Freund, der Theosoph, versteht keinen Scherz; leichtgläubig wie kein anderer, vielleicht auch mehr als ich in die Schwarzkunst eingeweiht, hat er mich im Verdacht, dass ich die Künste des Verhexens übe.
Man stelle sich meinen Schreck vor, als nach dem letzten Schreiben unseres Briefwechsels der berühmteste Astronom Schwedens am Schlaganfall stirbt. Ich werde ängstlich, und mit gutem Recht. Der Ausübung von Zauberkünsten verdächtig zu sein, ist eine schlimme Sache, und "wenn der Zauberer selbst dabei stirbt, so ist es nicht schade um ihn."
Um das Unglück voll zu machen, verscheiden im Lauf des Monats nacheinander fünf mehr oder weniger bekannte Astronomen.
Ich fürchte einen Fanatiker, dem ich die Grausamkeit eines Druiden und der hindostanischen Zauberer angebliche Macht, aus der Ferne zu töten, zuschreibe.
Eine neue Hölle von Ängsten! Und von diesem Tag vergesse ich die Dämonen und richte alle meine Gedanken auf die unheilvollen Anschläge der Theosophen und ihrer mit unerhörten Kräften begabten Magier, die für Hindus ausgegeben werden.
Ich fühle mich zum Tode verurteilt; für den Fall eines plötzlichen Todes schreibe ich die Namen meiner Mörder auf und versiegle das Papier. Dann warte ich ab.
Zehn Kilometer weiter östlich, an der Donau, liegt das Städtchen Grein, der Hauptort des Kreises. Dort soll sich, wie man mir erzählt, jetzt gegen Ende November, mitten im Winter, ein Fremder aus Zanzibar als Tourist aufhalten. Das genügt um alle Zweifel und schwarzen Gedanken eines Kranken zu wecken. Ich lasse Erkundigungen über diesen Fremden einziehen, um zu erfahren, ob er wirklich Afrikaner ist, was er für Pläne hat, woher er kommt.
Man erfährt nichts, und ein geheimnisvoller Schleier umhüllt den Unbekannten, der Tag und Nacht vor mir spukt. In meiner tiefsten Not rufe ich, immer im Geist des Alten Testaments, des Ewigen Schutz und Rache gegen meine Feinde an.
Die Psalmen Davids drücken am besten mein Trachten und Sehnen aus, und der alte Javeh ist mein Gott. Der 86. Psalm besonders prägt sich meinem Geist ein, und ich zögere nicht, ihn zu wiederholen:
"Gott, es setzen sich die Stolzen wider mich, und der Haufe der Gewalttätigen stehet mir nach meiner Seele, und haben dich nicht vor Augen....
"Tu ein Zeichen an mir, das mirs wohlergehe, dass es sehen, die mich hassen, und sich schämen müssen, dass du mir beistehest, Herr, und tröstest mich."
Nach einem Zeichen rufe ich, und man wird sehen, wie bald mein Gebet erhört werden wird.
Der Winter mit seinem graugelben Himmel ist gekommen; die Sonne hat seit mehreren Wochen nicht geschienen; die schmutzigen Wege widersetzten sich den Spaziergängen; die Blätter der Bäume modern, die ganze Natur löst sich unter pestartiger Fäulnis auf.
Das Schlachten des Winters hat angefangen; den ganzen Tag über erheben sich die Klagen der Opfer gegen das dunkle Himmelsgewölbe; man tritt in Blut und unter Leichen.
Es ist zum Sterben traurig, und meine Traurigkeit teilt sich den beiden guten barmherzigen Schwestern mit, die mich wie ihr krankes Kind pflegen. Was mich vollends niederdrückt, ist die Armut, die ich verbergen muss, und die vergeblichen Versuche, das nahende Elend abzuwenden.
Man wünscht übrigens, dass ich abreise, weil dieses einsame Leben für einen Mann zu nichts führe; auch sind sie einig, dass ich einen Arzt nötig habe.
Vergebens erwarte ich aus meiner Heimat das nötige Geld, und ich gehe auf die grosse Landstrasse hinaus, um eine Flucht zu Fuss vorzubereiten.
"Ich bin gleich dem Pelikane in der Wüste geworden; ich bin wie die Eule in ihrem Zufluchtsort."
Meine Anwesenheit peinigt meine Verwandten; man hätte mich schon fortgejagt, wenn sie das Kind nicht geliebt hätten. Jetzt, da Schmutz oder Schnee das Spazierengehen unmöglich machen, trage ich die Kleine auf meinen Armen weite Wege, erklimme Hügel, entere die Felsen. Da sagen die beiden Alten:
—Du schwächst deine Gesundheit, du wirst schwindsüchtig werden, du wirst dich töten!
—Das wäre ein schöner Tod!
Wir sind beim Mittagessen, es ist er 20. November, ein grauer, trüber, hässlicher Tag. Durch eine ruhelose Nacht, in der ich fortwährend mit den Unsichtbaren gekämpft habe, bis zur Fieberglut erhitzt, verwünsche ich das Leben und beklage mich, dass die Sonne fort ist.
Meine Mutter hat mir vorhergesagt, dass ich vor der Lichtmess, wenn die Sonne wiederkehrt, geheilt werden würde.
—Das ist mein einziger Sonnenstrahl, sage ich zu ihr, indem ich mit dem Finger auf meine kleine Christine zeige, die mir gegenübersitzt.
Im selben Augenblick spalten sich die seit Wochen angehäuften Wolken, und ein Lichtbündel dringt in den Saal, erleuchtet mein Gesicht, das Tischtuch, das Geschirr....
—Da ist die Sonne! Papa, da ist die Sonne! ruft das Kind und faltet seine Händchen. Verwirrt erhebe ich mich, ein Raub der verschiedenartigsten Gefühle. Ein Zufall? Nein, sage ich mir.
Das Wunder, das Zeichen? Aber das ist zu viel für einen, der wie ich in Ungnade gefallen ist! Der Ewige mischt sich nicht in die kleinen Angelegenheiten der Erdenwürmer!
Und doch bleibt mir dieser Sonnenstrahl im Herzen wie ein grosses Lächeln, mit dem ich Unzufriedener angelächelt bin....
Während der zwei Minuten, die ich brauche, um mein Häuschen zu erreichen, häufen sich die Wolken zu Gruppen, welche die seltsamsten Formen annehmen; und im Osten, wo sich der Schleier gehoben hat, ist der Himmel grün, wie ein Smaragd, eine Wiese mitten im Sommer.
Ich bleibe in meinem Zimmer stehen und erwarte etwas, das ich nicht erklären kann, in einer stillen Zerknirschung versunken, die frei von Furcht ist.
Da rollt, ohne dass ein Blitz ihm vorangegangen wäre, ein Donner, ein einziger, über meinem Kopfe.
Zuerst empfinde ich Furcht, und ich erwarte den Regen und das Gewitter, wie es natürlich ist. Aber nichts geschieht; eine vollständige Ruhe herrscht und alles ist zu Ende.
Warum, frage ich mich, bin ich nicht vor der Stimme des Ewigen demütig in den Staub gesunken?
Wenn der Allmächtige mit einer majestätischen Inszenierung zu einem Insekt zu sprechen geruht, fühlt sich das Insekt von einer solchen Ehre erhoben und aufgebläht, und der Hochmut flüstert ihm zu, dass es ein besonders würdiges Wesen sein müsse. In aller Freimütigkeit: ich fühle mich mit dem Herrn auf gleichem Niveau, als ein Bestandteil seiner Persönlichkeit, als eine Ausströmung seines Wesens, als ein Organ seines Organismus. Er brauchte mich, um sich zu offenbaren, sonst hätte er mich auf der Stelle durch seinen Blitz erschlagen.
Woher dieser ungeheuere Hochmut eines Sterblichen? Stamme ich vom Beginn der Jahrhunderte her, als sich die aufständischen Engel in Empörung gegen einen Herrn vereinigten, der zufrieden war, über ein Volk von Sklaven zu herrschen? Ist darum meine Wallfahrt über die Erde zu einem Spiessrutenlaufen geworden, bei dem die Letzten der Letzten sich die Freude gemacht haben, mich zu schlagen, zu beleidigen, zu besudeln?
Keine denkbare Demütigung, die ich nicht zu ertragen gehabt hätte; und doch wächst mein Hochmut immer im selben Masse, wie sich meine Erniedrigung vertieft! Was ist das? Jakob, der mit dem Ewigen ringt und, zwar etwas gelähmt, aber mit Ehren aus dem Kampf hervorgeht? Hiob, der auf die Probe gestellt wird und darauf besteht, sich Strafen gegenüber, die ihm mit Unrecht auferlegt sind, zu rechtfertigen?
Von so viel unzusammenhängenden Gedanken bestürmt, zwingt mich die Müdigkeit, den Griff loszulassen; und mein aufgeblasenes Ich fällt zusammen, wird so klein, dass sich das, was sich eben zugetragen hat, auf ein Nichts reduziert: ein Donnerschlag Ende November!
Das Rollen des Donners hallt von neuem wider und, noch einmal von Ekstase ergriffen, öffne ich die Bibel, indem ich den Herrn bitte, lauter zu sprechen, damit ich ihn verstehe.
Meine Blicke fallen alsbald auf diesen Vers Hiobs:
"Willst du meinen Urteilsspruch aufheben? Willst du mich verdammen, um dich zu rechtfertigen? Hast du einen Arm wie der mächtige Gott? Donnerst du mit der Stimme wie er?"
Kein Zweifel mehr: der Ewige hat gesprochen!
—Ewiger, was willst du von mir? Sprich dein Diener hört. Keine Antwort?
—Gut, ich demütige mich vor dem Ewigen, der geruht hat, sich vor seinem Diener zu demütigen. Aber die Kniee vor Volk und Mächtigen beugen? Niemals!
Am Abend empfängt mich meine gute Mutter auf eine Weise, die ich noch nicht begreife. Sie betrachtet mich mit einem prüfenden Blick von der Seite, als wolle sie sehen, welchen Eindruck das majestätische Schauspiel auf mich gemacht habe.
—Du hast es gehört?
—Ja, es ist eigentümlich, ein Donnerschlag im Winter.
Wenigstens hält sie mich nicht mehr für einen Verdammten.
Um die richtigen Ideen über die Natur der geheimnisvollen Krankheit, die mich betroffen hat, zu verwirren, verbreitet eine Nummer des "Evenement" diese Nachricht:
"Der unglückliche Strindberg, der mit seinem Frauenhass nach Paris kam, war bald zur Flucht gezwungen. Und seitdem schweigen seinesgleichen vor dem Banner der Weiblichkeit. Sie möchten nicht das Los des Orpheus erleiden, dem die thracischen Bacchantinnen den Kopf abrissen...."
Es war also wahr, dass man mir in der Rue de la Clef eine Falle gestellt hatte! Es war also wahr, dieser Mordversuch, der die Kränklichkeit zur Folge gehabt hat, deren Symptome sich noch zeigen! Oh diese Frauen! Jedenfalls wegen meines Aufsatzes über die feministischen Bilder meines dänischen Freundes, des Frauenverehrers.
Endlich eine Tatsache, eine greifbare Wirklichkeit, die mich von den furchtbaren Zweifeln, ich könnte geisteskrank sein, befreit.
Ich eile mit der guten Nachricht zu meiner Mutter.
—Da sieh, dass ich nicht verrückt bin.
—Nein, du bist nicht verrückt, du bist nur krank, und der Arzt rät dir körperliche Übungen an, zum Beispiel Holz hacken....
—Ist das auch gut gegen die Frauen oder nicht?
Diese unüberlegte Antwort trennt uns. Ich habe vergessen, dass eine Heilige doch immer eine Frau bleibt, das heisst die Feindin des Mannes.
Alles ist vergessen, die Russen, die Rotschilde, die Schwarzkünstler, die Theosophen, selbst der Ewige. Ich bin das Opfer, Hiob ohne Schuld, und die Frauen haben Orpheus, den Autor von "Sylva Sylvarum", den Erwecker der toten Naturwissenschaften, töten wollen. In Unschlüssigkeit aller Art befangen, schiebe ich den neugeborenen Gedanken, dass die Mächte zu höherem Zweck in übernatürlicher Weise eingreifen, beiseite und vergesse, die einfache Kenntnis, die ich von einem Attentat habe, dadurch zu vervollständigen, dass ich nach dem suche, der es angestiftet hat.
Brennend vor Begierde, mich zu rächen, setze ich einen Brief auf, in dem ich der Pariser Polizeipräfektur Anzeige erstatte; dann einen zweiten, den ich an die Pariser Zeitungen richte; da macht ein gutgeführter Umschwung diesem langweiligen Drama, das in eine Farce auszulaufen drohte, eine Ende.
An einem graugelben Tage, gegen ein Uhr nach dem Mittagessen, äussert meine kleine Christine den dringenden Wunsch, mich in das Häuschen zu begleiten, wo ich mein Mittagsschläfchen zu halten pflege.
Es ist unmöglich, ihr zu widerstehen, und ich gebe ihren Bitten nach.
Als wir oben sind, befiehlt meine Christine Federn und Papier. Dann will sie illustrierte Bücher haben. Und ich muss dabei sein, muss erklären, muss zeichnen.
—Nicht schlafen, Papa!
Müde, erschöpft, begreife ich nicht, warum ich diesem Kinde gehorche; aber in ihrer Stimme ist ein Tonfall, dem ich nicht widerstehen kann.
Da beginnt draussen vor der Tür ein Drehorgelspieler einen Walzer. Ich schlage der Kleinen vor, mit dem Kindermädchen, das sie begleitet hat, zu tanzen.
Durch die Musik angelockt, kommen die Kinder des Nachbarn herbei; in meinem Flur wird ein Ball improvisiert, nachdem man den Spielmann in die Küche hat kommen lassen.
Das dauert eine Stunde, und meine Traurigkeit schwindet.
Um mich zu zerstreuen und meine Schlaflust zu besänftigen, greife ich zur Bibel, die mir als Orakel dient, und öffne sie aufs Geradewohl; und ich lese:
"Der Geist aber des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn machte ihn sehr unruhig. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott macht dich sehr unruhig; unser Herr sage seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe wohl spielen könne, auf dass, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand spiele, das es besser mit dir werde."
Der böse Geist, das ist es eben, was ich argwöhnte.
Während die Kinder sich so belustigen, kommt meine Mutter, um die Kleine zu suchen; als sie den Ball sieht, bleibt sie erstaunt stehen.
Sie erzählt mir, dass gerade zu dieser Stunde unten im Dorfe eine Dame aus bester Familie einen Anfall von Wahnsinn gehabt hat.
—Was ist ihr denn?
—Sie tanzt, diese alte Frau, sie tanzt, ohne zu ermüden im Brautkleid, und sie bildet sich ein, Bürgers Leonore zu sein.
—Sie tanzt? Und dann?
—Weint sie, aus Furcht vor dem Tod, der sie holen will.
Was die Sache noch furchtbarer macht, ist, dass die Dame das Häuschen, in dem ich jetzt hause, bewohnt hat und dass ihr Gatte dort gestorben ist, wo der Ball der Kinder vor sich geht.
Erklärt mir das Mediziner, Psychiater, Psychologen, oder räumt ein, dass die Wissenschaft bankrott ist!
Mein Töchterchen hat den Bösen beschworen, und der von der Unschuld in die Flucht gejagte Geist ist über die alte Frau hergefallen, die sich rühmte, eine Freidenkerin zu sein.
Der Totentanz dauert die ganze Nacht, und die Dame wird von Freundinnen gehütet, die sie gegen die Angriffe des Todes schützen. Sie nennt es Tod, weil sie das Dasein von Dämonen leugnet. Zuweilen behauptet sie, ihr verstorbener Mann quäle sie.
Meine Abreise ist aufgeschoben; um aber nach so vielen schlaflosen Nächten wieder zu Kräften zu kommen, gehe ich zum Schlafen in die Wohnung meiner Tante, die auf der andern Seite der Strasse liegt.
Ich verlasse also das rosa Zimmer. (Welches eigentümliche Zusammentreffen, dass die Marterkammer in Stockholm in der guten alten Zeit auch "Rosenkammer" hiess.)
Die erste Nacht vergeht in einem ruhigen Zimmer, dessen weissgekalkte Wände voll Heiligenbilder hängen. Über meinem Bett ist ein Kruzifix.
Aber in der zweiten Nacht beginnen die Geister ihr Spiel wieder. Ich zünde die Kerzen an, um die Zeit mit Lesen hinzubringen. Ein unheilvolles Schweigen herrscht, und ich höre mein Herz klopfen. Da trifft mich ein schwaches Geräusch wie ein elektrischer Funke.
Was ist das?
Ein grosses Stück Stearin ist von der Kerze auf die Erde gefallen. Weiter nichts; aber das verkündet bei uns den Tod! Meinetwegen denn der Tod!
Nachdem ich eine Viertelstunde gelesen habe, will ich nach meinem Taschentuch greifen, das ich unter das Kopfkissen gesteckt habe. Es ist nicht da, und, als ich es suche, finde ich es auf dem Fussboden. Ich bücke mich, um es aufzuheben. Dabei fällt mir etwas auf den Kopf, und als ich mit den Fingern durch die Haare fahre, finde ich ein zweites Stück Stearin.
Statt zu erschrecken, kann ich ein Lächeln nicht unterdrücken, so spasshaft kommt mir das Abenteuer vor.
Lächeln beim Tode! Wie wäre das möglich, wenn das Leben nicht an und für sich lächerlich wäre? So viel Lärm um so wenig! Vielleicht verbirgt sich sogar auf dem Grunde der Seele ein unbestimmter Argwohn, dass alles hier unten nur Verstellung, Heuchelei, Trugbild ist, und dass sich die Götter über unsere Leiden lustig machen.
Hoch über den Gipfel des Berges, auf dem das Schloss gebaut ist, erhebt sich ein zweiter Berg, der alle andern beherrscht: von dem kann man die ganze Höllenlandschaft übersehen. Man gelangt dahin durch einen Hain von vielleicht tausendjährigen Eichen, der einst ein Druidenhain gewesen sein soll, weil die Mistel in der Gegend viel auf Linden und Apfelbäumen vorkommt. Oberhalb dieses Waldes steigt der Weg steil durch niedrige Fichten empor.
Mehrere Male habe ich bis zum Gipfel zu kommen versucht, immer aber trieben mich unvorhergesehene Dinge zurück. Bald war es ein Rehbock, der die Stille durch einen unerwarteten Sprung unterbrach; bald ein Hase, der ungewöhnlich aussah; bald ein Häher mit seinem entnervenden Geschrei.
Am letzten Morgen, dem Tag vor meiner Abreise, trotzte ich allen Hindernissen, drang durch den dunklen, grausigen Fichtenwald und kletterte bis zum Gipfel hinauf. Von dort hatte ich eine prachtvolle Aussicht über das Donautal und die steirischen Alpen. Ich habe die düsteren Trichter dort unten verlassen und ich atme zum erstenmal auf. Die Sonne erleuchtet die Gegend unter unendlichen Aussichten, und die weissen Kämme der Alpen vereinigen sich mit den Wolken. Es ist schön wie der Himmel!
Umfasst die Erde den Himmel und die Hölle? Gibt es keine anderen Stätten für Strafe und Belohnung?
Vielleicht! Und sicher ist, wenn ich mich an die schönsten Augenblicke meines Lebens erinnere, erscheinen sie mir himmlisch, ebenso wie mir die schlimmsten als höllisch vorkommen.
Behält mir die Zukunft noch Stunden oder Minuten dieses Glückes vor, das sich nur durch Sorgen und ein ziemlich reines Gewissen erkaufen lässt?
Ich bleibe hier oben, da ich es nicht eilig habe, wieder in das Tal der Schmerzen hinabzusteigen, und gehe auf dem Plateau spazieren, um die Schönheit der Erde zu bewundern. Da bemerke ich, dass der abgesonderte Felsen, der die eigentliche Spitze bildet, durch die Natur wie eine ägyptische Sphinx geformt ist. Auf dem Riesenkopfe liegt ein Steinhaufen, aus dem ein kleiner Stock mit einer Fahne aus weisser Leinwand aufragt.
Ich ergründe nicht, was diese Zurüstung zu bedeuten hat, aber ein einziger Gedanke packt mich so, dass ich nicht widerstehen kann: die Fahne entführen!
Ich achte der Gefahr nicht, erstürme den steilen Abhang und raube die Fahne. Da ertönt, ganz unerwartet, vom Ufer der Donau ein Hochzeitsmarsch, der von Triumphgesängen begleitet wird. Es ist ein Hochzeitszug, den ich nicht sehen kann, aber an den üblichen Flintenschüssen erkenne.
Kind genug und genügend unglücklich, um aus den alltäglichsten und natürlichsten Vorfällen die Poesie zu ziehen, nehme ich dies als ein günstige Vorbedeutung an.
Und mit Bedauern, langsamen Schrittes, steige ich wieder in das Tal der Schmerzen und des Todes, der Schlaflosigkeit und der Dämonen hinab; denn meine kleine Beatrice erwartet mich dort unten, und ich bringe ihr die Mistel, die ich ihr versprochen habe, den Zweig, der im Schnee grünt, den man mit einer goldenen Sichel pflücken müsste.
Schon lange hatte die Grossmutter den Wunsch ausgedrückt, mich zu sehen, sei es, um eine Versöhnung herbeizuführen, sei es aus Gründen, die vielleicht okkult sind, denn sie ist eine Hellseherin und eine Visionärin. Unter verschiedenen Vorwänden hatte ich den Besuch aufgeschoben, da aber meine Abreise entschieden ist, nötigt mich meine Mutter, die Grossmutter zu besuchen und ihr Lebewohl zu sagen, wahrscheinlich zum letzten Mal diesseits des Grabes.
Am 26. November einem kalten und klaren Tagen, machen meine Mutter, das Kind und ich uns auf den Weg nach der Donau, an welcher der Stammsitz der Familie liegt.
Wir steigen im Gasthaus ab, und meine Mutter begibt sich zur Grossmutter, um meinen Besuch anzumelden. Während ich auf ihrer Rückkehr warte, durchwandere ich die Wiesen und Wälder, die ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe. Die Erinnerungen überwältigen mich, und das Bild meiner Frau taucht überall auf. Alles ist verwüstet durch den Frost des Winters; keine Blume blüht mehr, keine Grashalm grünt mehr, wo wir beide alle Blumen des Frühlings, des Sommers, des Herbstes gepflückt haben.
Am Nachmittag werde ich zu der Grossmutter geführt, die den Pavillon der Villa bewohnt, das Häuschen, in dem mein Kind geboren ist. Die Begegnung ist konventionell und kalt; man scheint eine Wiederholung des Szene vom verlorenen Sohn zu erwarten, aber derartiges ist mir zuwider.
Ich begnüge mich damit, die Erinnerungen an ein verlorenes Paradies wieder lebendig zu machen. Meine Frau und ich haben das Getäfel der Türen und Fenster gestrichen, um die Geburt der kleinen Christine zu feiern. Die Rosen und die Clematis, welche die Fassade zieren, sind von meiner Hand gepflanzt. Der Gang, der den Garten durchläuft, ist von mir geharkt worden. Aber der Nussbaum, den ich am Morgen nach der Geburt Christinens gepflanzt habe, ist verschwunden. "Der Baum des Lebens", wie er genannt wurde, ist tot.
Zwei Jahre, zwei Ewigkeiten, sind vergangen, seit die Abschiedsworte zwischen uns gewechselt wurden. Sie war am Ufer, und ich stand auf dem Dampfer, der mich auf meinen Weg nach Paris bis Linz bringen sollte.
Wer hat den Bruch durchführt! Ich, ich habe meine Liebe und ihre getötet. Ade, weisses Haus von Dornach, Flur der Dornen und Rosen! Ade, Donau! Ich tröste mich, indem ich denke: ihr waret nur ein Traum, kurz wie der Sommer und lieblicher als die Wirklichkeit, die ich nicht vermisse.
Die Nacht verbringe ich im Gasthaus, wo auch meine Mutter und mein Kind auf meine Bitte schlafen, um mich gegen die Schrecken des Todes zu schützen, die ich ahne, dank meinem sechsten Sinn, der sich unter dem Einfluss sechsmonatiger Marter entwickelt hat.
Um zehn Uhr abends beginnt ein Windstoss meine Tür, die sich auf den Flur öffnet, zu rütteln. Ich befestige sie mit hölzernen Keilen. Es hilft nichts: sie zittert weiter.
Dann klirren die Fenster, der Ofen heult wie ein Hund, das ganze Haus schwankt wie ein Schiff.
Ich kann nicht schlafen. Bald seufzt meine Mutter, bald weint mein Kind.
Am andern Morgen ist meine Mutter durch Schlaflosigkeit und andere Dinge, die sie mir verbirgt, erschöpft und sagt zu mir:
—Reise, mein Kind! Ich habe genug von diesem Höllengeruch!
Und ich reise gen Norden, um auf meiner Pilgerfahrt das feindliche Feuer einer andern Sühnestation zu empfangen.
Es gibt neunzig Städte in Schweden, und zu der, die ich am meisten verabscheue, haben die Mächte mich verdammt.
Ich beginne damit, dass ich die Ärzte besuche.
Der erste nennt es Nervenschwäche, der zweite Brustklemme, der dritte Verrücktheit, der vierte Luftgeschwulst.... Das genügt mir, um sicher zu sein, dass man mich nicht in ein Irrenhaus sperrt.
Um mich zu versorgen, bin ich gezwungen, für eine Zeitung Artikel zu schreiben. Aber jedes Mal, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, wird die Hölle losgelassen. Jetzt hat man etwas Neues erfunden, um mich verrückt zu machen. Sobald ich in ein Hotel eingezogen bin, bricht ein Lärm los, ähnlich dem in der Rue de la Grande-Chaumière in Paris: Schritte schleppen und Möbel werden gerückt. Ich wechsle das Zimmer, ich wechsle das Hotel: der Lärm ist da, über meinem Kopfe. Ich gehe in die Restaurants: sobald ich mich im Speisesaal an den Tisch setze beginnt das Gepolter.
Wohlgemerkt: ich frage die Anwesenden ob sie dasselbe Geräusch höre, und man bejaht es stets und gibt dieselbe Beschreibung. Also ist es keine Halluzination des Gehörs, sondern einer Intrige, sage ich mir.
Als ich aber eines Tages unversehens in einen Schuhmacherladen trete, beginnt im selben Augenblick der Lärm. Also doch keine Intrige. Es ist der Teufel!
Von Hotel zu Hotel gejagt, überall von elektrischen Drähten belästigt, die bis an den Rand des Bettes laufen; überall von Strömen angegriffen, die mich vom Stuhl oder aus dem Bett reissen, bereite ich in aller Form den Selbstmord vor.
Es ist das schlechteste Wetter, und ich suche mich in meiner Traurigkeit zu zerstreuen, indem ich mit Freunden zeche.
An einem Tage der Verzweiflung, am Morgen nach einem Gelage, beende ich auf meinem Zimmer mein erstes Frühstück. Das Brett mit dem Geschirr bleibt auf dem Tisch stehen, und ich drehe den Resten des Mahles den Rücken. Ein Geräusch erregt meine Aufmerksamkeit, und ich bemerke, dass das Messer zu Boden gefallen ist. Ich hebe es auf und lege es vorsichtig so hin, dass der Fall sich nicht wiederholen kann. Das Messer erhebt sich und fällt.
Also Elektrizität!
Am selben Morgen schreibe ich einen Brief an meine Mutter, indem ich mich über das schlechte Wetter und über das Leben im allgemeinen beklage. Bei diesem Satz: "Die Erde ist schmutzig, das Meer ist schmutzig, und der Himmel lässt Dreck regnen...." fällt zu meiner grossen Überraschung ein Tropfen klaren Wassers auf das Papier!
Keine Elektrizität! Ein Wunder!
Am Abend, als ich noch am Tisch sitze, erschreckt mich ein Geräusch, das von der Waschtoilette zu hören ist. Ich sehe hin und merke dass ein Wachstuch, das ich bei meinen morgendlichen Waschungen benutze, herabgefallen ist. Um die Sache nachzuprüfen, hänge ich das Wachstuch so auf, dass es nicht fallen kann.
Es fällt noch einmal!
Was ist das?
Jetzt richten sich meine Gedanken wieder auf die Okkultisten und ihre geheime Macht.
Ich setze eine Anzeige auf und verlasse mit diesem Brief die Stadt, um mich nach Lund zu begeben, wo alte Freunde wohnen, Ärzte, Psychiater, Theosophen selbst, auf deren Hilfe ich für mein zeitliches Heil rechne.
Warum und wie werde ich dazu getrieben, mich in dieser kleinen Universitätsstadt niederzulassen, diesem Verbannungs- und Bussort für die Studenten von Upsala, wenn sie zu toll auf Kosten ihres Beutels und ihrer Gesundheit gelebt haben?
Ist es ein Canossa, wo ich meine übertriebenen Ansichten abschwören muss, vor derselben Jugend, die mich einst zwischen 1880 und 1890 zu ihrem Bannerträger ernannten? Ich kenne die Lage sehr gut, und ich weiss wohl, dass ich von der Mehrzahl der Professoren als Verführer der Jugend in den Bann getan bin, und dass die Eltern mich wie den Bösen selbst fürchten.
Obendrein habe ich mir noch persönliche Feinde hier zugezogen; ich habe hier unter Umständen Schulden gemacht, die ein schlechtes Licht auf meinen Charakter werfen; hier wohnt die Schwägerin Popoffskys mit ihrem Gatten und beide sind durch die Stellung, die sie in der Gesellschaft einnehmen, imstande, mir grosse Schwierigkeiten zu bereiten. Hier legen sogar Verwandte, die mich verleugnet; Freunde, die mich im Stich gelassen haben, um ebenso viele Feinde zu werden. Kurz, es ist der schlechtestgewählte Platz für einen ruhigen Aufenthalt, es ist die Hölle, aber mit meisterhafter Logik, mit göttlichem Scharfsinn ausgesucht. Hier muss ich den Kelch leeren, hier muss ich die Jugend mit den erzürnten Mächten wieder vereinigen.
Durch einen übrigens sehr pittoresken Zufall habe ich eben einen modernen Mantel mit Pelerine und Kapuze gekauft, von flohbrauner Farbe, der Kutte der Franziskaner ähnlich. In Büssertracht also kehre ich nach Schweden zurück, nachdem ich sechs Jahre verbannt gewesen bin.
Gegen 1885 bildete sich in Lund eine Studentenverbindung, "Die alten Jungen" genannt, deren literarische, wissenschaftliche und soziale Tendenzen sich mit der Losung "Radikalismus" übersetzen liessen. Ihr Programm, das sich den modernen Ideen anschloss, war zuerst sozialistisch, dann nihilistisch, um auf ein Ideal allgemeiner Auflösung und des fin de siècle mit einem Anstrich von Satanismus und Dekadenz hinauszulaufen.
Das Haupt der Partei, der Tapferste der Paladine, der seit mehreren Jahren mein Freund ist und den ich seit drei Jahren nicht gesehen habe, besucht mich.
Wie ich in eine Kutte gekleidet, aber in eine graue Franziskanerkutte, gealtert, abgemagert, von kläglichem Aussehen erzählt er mir seine Geschichte allein durch seinen Gesichtsausdruck.
—Du auch?
—Ja, es ist aus!
Als ich ihm ein Glas Wein anbiete, lehnt er ab, da er so mässig geworden ist, dass er keinen Wein mehr trinkt!
—Und die alten Jungen?
—Gestorben, zusammengebrochen, Spiessbürger, aufgenommen in die verwünschte Gesellschaft.
—Canossa?
—Canossa auf der ganzen Linie!
—Dann hat die Vorsehung mich hierher geführt!
—Vorsehung! Das ist das rechte Wort.
—Werden die Mächte in Lund wieder anerkannt?
—Die Mächte bereiten ihre Rückkehr vor.
—Schläft man nachts in Schonen?
—Nicht viel! Alle Menschen klagen über Alpdrücken, Brustbeklemmungen, Herzbeschwerden.
—Wie bin ich da am Platze, denn das ist gerade mein Fall!
Wir haben einige Stunden über die Wunderdinge gesprochen, die sich jetzt ereignen, und mein Freund hat mir ausserordentliche Tatsachen erzählt, die hier und dort vorgekommen sind. Zum Schluss drückt er die Ansicht der heutigen Jugend aus, die etwas Neues erwartet.
Man wünscht eine Religion, eine Versöhnung mit den Mächten (das ist das Wort), eine Wiederannäherung an die unsichtbare Welt. Die naturalistische Epoche, die kräftig und fruchtbar war, hat ihre Zeit gehabt. Man braucht sie nicht zu tadeln und nicht zu bedauern: die Mächte haben gewollt, dass wir sie durchmachen. Es war eine experimentelle Epoche, deren Versuche durch ihre negativen Ergebnisse gezeigt haben, wie eitel gewisse Lehren sind. Ein Gott, bis auf weiteres unbekannt, entwickelt sich und wächst, offenbart sich mit Zwischenräumen, in denen er die Welt sich selber zu überlassen scheint, wie der Bauer Unkraut und Weizen wachsen lässt, bis die Ernte kommt. Jedesmal, wenn er sich enthüllt, hat er seine Gedanken geändert und beginnt seine Regierung wieder, indem er Verbesserungen einführt, die er aus der Praxis gewonnen hat.
Die Religion wird also wiederkehren, aber unter andern Formen, und ein Kompromiss mit den alten Religionen erscheint unmöglich. Nicht eine Epoche der Reaktion erwartet uns, nicht eine Rückkehr zu dem, was sich ausgelebt hat, sondern ein Fortschritt zu etwas Neuem.
Was für Neues? Warten wir ab!
Als unser Gespräch zu Ende ist, werfe ich eine Frage auf, wie man einen Pfeil gegen die Wolken schiesst.
—Kennst du Swedenborg?
—Nein, aber meine Mutter besitzt seine Werke, und es sind ihr sogar wunderbare Dinge begegnet.
Vom Atheismus zu Swedenborg ist nur ein Schritt!
Ich bitte meinen Freund, mir Swedenborgs Werke zu leihen. Und der Saul der jungen Propheten bringt mir die "Arcana coelestia".
Zur selben Zeit stellt er mir einen jungen Mann vor, der von den Mächten begnadet ist, ein verlorener Sohn. Der erzählt mir ein Abenteuer seines Lebens, das den meinen ganz ähnlich ist; und als wir unsere Leiden vergleichen, wird es hell in uns und wir werden mit Swedenborgs Hilfe befreit.
Ich danke der Vorsehung, die mich in die kleine verachtete Stadt gesandt hat, um dort Busse zu tun und mein Heil zu finden.
Als Balzac mir in seiner "Seraphita" meinen erhabenen Landsmann Emanuel Swedenborg, den "Buddha des Nordens", vorstellte, hat er mich die evangelische Seite des Propheten kennen gelehrt. Jetzt ist es das Gesetz, das mich trifft, zermalmt und befreit.
Durch ein Wort, ein einziges, wird es Licht in meiner Seele, und verschwunden sind die Zweifel, die fruchtlosen Grübeleien über eingebildete Feinde, Elektriker, Schwarzmagier. Dieses kleine Wort ist: devastatio (ödeläggelse, Verödung). Alles, was mir geschehen ist, finde ich bei Swedenborg wieder: die Angstgefühle (angor pectoris), die Brustbeklemmung, das Herzklopfen, der Gürtel, den ich elektrisch nannte, alles ist da; und die Summe dieser Erscheinungen bildet die geistige Reinigung, die schon dem Apostel Paulus bekannt war und von ihm in den Briefen an die Korinther und an Timotheus erwähnt wird: "Ich habe beschlossen, über den, der solches getan hat, ihn zu übergeben dem Satan zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist selig werde am Tage des Herrn Jesu".—"Unter welchen ist Hymenäus und Alexander, welche ich habe dem Satan übergeben, dass sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern."
Als ich Swedenborgs Träume von 1744 lese, dem Jahr, das seinen Verbindungen mit der unsichtbaren Welt vorausgeht, entdecke ich, dass der Prophet dieselben nächtlichen Martern wie ich erduldet hat. Was mich aber besonders packt: die Symptome gleichen einander so, dass ich über die Natur meiner Krankheit nicht mehr im Zweifel bin.
In "Arcana coelestia" erklären sich die Rätsel der beiden letzten Jahre mit einer so überwältigenden Genauigkeit, dass ich, das Kind des berühmten neunzehnten Jahrhunderts, die unerschütterliche Überzeugung bekomme, dass es die Hölle gibt, aber hier, auf der Erde, und dass ich sie eben durchgemacht habe.
Swedenborg erklärt mir, warum ich im Krankenhaus des heiligen Ludwig geweilt habe: Die Alchemisten werden vom Aussatz befallen und reissen sich den Schorf ab, der Fischschuppen gleicht. Es ist eine unheilbare Krankheit der Haut.
Swedenborg sagt mir, was die hundert Abtritte des Hotel Orfila bedeuten: Das ist die Kothölle. Der Schornsteinfeger, den mein Töchterchen in Österreich gesehen hat, findet sich auch wieder: "Unter den Geistern gibt es solche, die man unter dem Namen Schornsteinfeger kennt, weil ihr Gesicht wirklich von Rauch geschwärzt ist und sie in einem Gewand von brauner Russfarbe erscheinen.... Einer dieser Schornsteinfegermeister kam zu mir und ersuchte mich dringend, darum zu beten, dass er in den Himmel aufgenommen werde. Ich glaube nicht, sagte er, etwas begangen zu haben, was mich davon ausschliessen könnte; ich habe die Bewohner der Erde zurechtgewiesen, aber ich habe immer dem Verweis und der Züchtigung die Belehrung folgen lassen....
"Die richtenden, bessernden und belehrenden Geister des Menschen heften sich an seine linke Seite, indem sie sich gegen den Rücken neigen und das Buch seines Gedächtnisses nachschlagen und seine Handlungen, ja sogar seine Gedanken darin lesen; denn wenn ein Geist beim Menschen eindringt, bemächtigt er sich des Gedächtnisses. Wenn sie eine schlechte Handlung oder die Absicht, Böses zu tun, sehen, strafen sie ihn durch einen Schmerz im Fuss, in der Hand (!) oder um die Magengegend; und sie tun das mit einer beispiellosen Fertigkeit. Ein Beben kündigt ihr Kommen an.
"Ausser dem Schmerz der Glieder wenden sie noch einen schmerzhaften Druck um den Nabel an, als drücke einem ein stachliger Gürtel; von Zeit zu Zeit Zusammenschnüren der Brust, das bist zur Angst getrieben wird; Ekel vor jeder Nahrung, ausser Brot, und zwar Tage lang.
"Andere Geister bemühen sich vom Gegenteil dessen zu überzeugen, was die belehrenden Geister gesagt haben. Die Geister des Widerspruchs sind auf der Erde aus der Gesellschaft der Menschen wegen ihrer Ruchlosigkeit verbannt gewesen. Man erkennt ihr Nahen an einem fliegenden Feuer, das vor dem Gesicht sich herabzulassen scheint; sie stellen sich unter den Rücken des Menschen, von wo sie sich nach den Teilen bemerkbar machen".
(Diese fliegenden Feuer oder Funken habe ich zweimal gesehen, und immer in Augenblicken der Empörung, als ich alle Vorstellungen als leere Träume verwarf.)
"Sie predigen, dem, was die belehrenden Geister den Engeln nachsprechen, keinen Glauben zu schenken, seinen Wandeln nicht den Lehren anzupassen, die man von ihnen empfangen hat, sondern in aller Freiheit und Ausgelassenheit zu leben. Gewöhnlich kommen sie, sobald die andern sich entfernt haben. Die Menschen kennen sie und beunruhigen sich kaum über sie; aber sie lernen dadurch, was gut und was böse ist. Denn man lernt die Eigenschaft des Guten durch sein Gegenteil kennen; jeder Begriff von einer Sache bildet sich, indem man überlegt, wie sie sich von ihrem Gegenteil unterscheidet, und zwar von verschiedenen Gesichtspunkten aus und auf verschiedene Arten".
Der Leser erinnert sich an die antiken Marmorskulpturen ähnlichen menschlichen Gesichter, die sich aus dem weissen Bezug meines Kopfkissens im Hotel Orfila formten. Darüber sagt Swedenborg:
"Zwei Zeichen lassen erkennen, dass sie (die Geister) bei einem Menschen sind; das eine ist ein alter Mann mit weissem Gesicht; dieses Zeichen verkündet ihnen, dass sie immer die Wahrheit sagen und nur gerecht handeln sollen.... Ich habe selber ein greisenhaftes menschliches Gesicht dieser Art gesehen.... Gesichter von grosser Weisse und grosser Schönheit, aus denen zugleich Aufrichtigkeit und Bescheidenheit leuchten".
(Um den Leser nicht zu erschrecken, habe ich mit Absicht verschwiegen, dass sich alles, was ich hier oben zitiert habe, auf die Bewohner des Jupiters bezieht. Man denke sich nun meine Überraschung, als man mir eines Tages im Frühling eine Revue bringt, die Swedenborgs Haus auf dem Planeten Jupiter, von Viktorien Sardou gezeichnet, wiedergibt. Zunächst, warum Jupiter? Welche seltsame Zusammentreffen! Und hat der Meister der französischen Komödie beachtet, dass die linke Fassade, aus genügender Entfernung betrachtet, ein greisenhaftes Menschengesicht bildet? Dieses Antlitz gleicht dem meines Kopfkissens! Aber in der Zeichnung Sardous gibt es noch mehr solche menschlichen Silhouetten, die durch die Umrisse geschaffen werden. Ist die Hand des Meisters von einer andern Hand geführt worden, so dass er mehr gegeben hat, als er wusste?)
Wo hat Swedenborg diese Höllen und Himmel gesehen? Sind es Visionen, Intuitionen, Inspirationen? Ich wüsste es nicht zu sagen, aber die Ähnlichkeit, die seine Hölle mit der Dantes und der griechischen, römischen, germanischen Mythologie hat, lässt mich glauben, dass die Mächte sich immer fast der gleichen Mittel bedient haben, um ihre Pläne zu verwirklichen.
Und diese Pläne? Den menschlichen Typs zu vervollkommnen, den höheren Menschen zu erzeugen, den "Übermenschen", wie ihn Nietzsche, die vor der Zeit verbrauchte und ins Feuer geworfene Zuchtrute, verkündigte.
So erscheint das Problem des Bösen wieder, und die sittliche Gleichgültigkeit Taines fällt vor neuen Forderungen zu Boden. Die Dämonen sind eine notwendige Konsequenz.
Was sind Dämonen? Sobald wir die Unsterblichkeit der Seele zugeben, sind die Toten nichts anderes als Überlebende, die ihre Beziehungen zu den Lebenden fortsetzen. Die bösen Geister sind also nicht böse, weil ihr Zweck ein guter ist, und man müsste sich eher des Wortes Swedenborgs bedienen, Zuchtgeister, um den Menschen Furcht und Verzweiflung zu nehmen.
Den Teufel als selbständige, Gott gleiche Macht braucht es nicht zu geben, und des Bösen unleugbare Erscheinungen unter der traditionellen Form brauchen nur ein Schreckbild zu sein, das die einzige und gute Vorsehung hervorgerufen hat. Diese Vorsehung, die mittels einer aus den Verstorbenen zusammengesetzten ungeheuren Verwaltung herrscht.
Tröstet euch also und seit stolz auf die Gnade, die euch allen bewilligt ist, die ihr von Schlaflosigkeit, Alpdrücken, Erscheinungen, Angstzuständen, Herzklopfen heimgesucht und gemartert werdet! Numen adest. Gott verlangt nach euch!
In der kleinen Musenstadt eingeschlossen, ohne eine Hoffnung, herauszukommen, liefere ich die furchtbare Schlacht gegen den Feind, mich selbst.
Jeden Morgen, wenn ich auf dem von Platanen beschatteten Wall spazieren gehe, erinnert mich das grosse rote Irrenhaus an die Gefahr, der ich entgangen bin, und an die Zukunft, falls ich einen Rückfall erleide. Swedenborg hat mich, indem er mich über die Natur der Schrecken aufgeklärt, die ich während des letzten Jahres durchgemacht habe, von den Elektrikern, Schwarzkünstlern, Zauberern, den Neidern des Goldmachers, dem Wahnsinn befreit. Er hat mir den einzigen Weg gezeigt, der zum Heil führt: die Dämonen in ihrem Zufluchtsort, in mir selber, aufzusuchen und sie zu töten durch.... Reue. Balzac, der Adjutant des Propheten, hat mir in "Seraphita" gezeigt, dass "Gewissensqual eine Ohnmacht dessen ist, der seinen Fehltritt wiederholen wird. Die Reue allein ist eine Stärke und beendigt alles".
Also die Reue! Aber heisst das nicht die Vorsehung missbilligen, die mich zu ihrer Geissel ausgewählt hat? Heisst das nicht den Mächten sagen: ihr habt mein Schicksal schlecht geleitet; ihr habt mich geboren werden lassen mit dem Beruf zu strafen, die Götzenbilder zu stürzen, mich zu empören, und dann zieht ihr euren Schutz zurück und liefert mich einem lächerlichen Widerruf aus? Zu Kreuze kriechen und Busse tun!
Seltsamer Circulus vitiosus, den ich mit zwanzig Jahren voraussah, als ich mein Drama "Meister Olof" dichtete, das die Tragödie meines Lebens geworden ist. Wozu dreissig Jahre lang ein elendes Leben führen, um durch Erahnung das zu erreichen, was man vorausgeahnt hat? Jung, war ich aufrichtig fromm, und ihr habt einen Freidenker aus mir gemacht. Aus dem Freidenker habt ihr einen Atheisten gemacht, aus dem Atheisten einen Religiösen. Für die Menschheit begeistert, habe ich den Sozialismus verkündet: fünf Jahre später habt ihr mir gezeigt, wie sinnlos der Sozialismus ist. Alles, was mich begeistert hat, habt ihr für nichtig erklärt. Und wenn ich mich der Religion weihe, so bin ich sicher, in zehn Jahren werdet ihr sie widerlegen.
Sieht es nicht so aus, als trieben die Götter ihren Scherz mit uns Sterblichen? Und darum können wir bewussten Spötter in den schlimmsten Augenblicken unseres Lebens lachen!
Wie könnt ihr verlangen, dass man ernst nimmt, was sich als ein ungeheurer Scherz erweist?
Jesus Christus, der Erlöser, wen hat er erlöst? Seht die christlichen aller Christen, unsere skandinavischen Frommen, diese blassen, elenden, eingeschüchterten Menschen, die nicht lächeln können: sie haben das Aussehen von Besessenen! Sie scheinen den Dämon in ihrem Herzen zu tragen. Und beachtet, wie alle ihre Führer als Missetäter im Gefängnis geendet haben. Warum hat ihr Herr sie dem Feind überliefert?
Ist die Religion eine Züchtigung und Christus ein Rachegeist?
Alle alten Götter werden in der folgenden Epoche Dämonen: Die Bewohner des Olymp sind Dämonen geworden; Odin, Thor, der Teufel in Person. Prometheus-Lucifer, zum Satan entartet. Ist etwa—Gott verzeihe mir!—Christus auch in einen Dämon verwandelt? Er tötet ja Vernunft, Fleisch, Schönheit, Freude, die reinsten Leidenschaften der Menschheit. Tötet die Tugenden: Freimut, Tapferkeit, Ruhm; Liebe, Barmherzigkeit!
Die Sonne scheint, das tägliche Leben geht seinen Gang, der Lärm der Arbeit ermuntert die Lebensgeister. Da bäumt sich der Mut der Empörung auf, da schleudert man seine Zweifel herausfordernd gegen den Himmel.
Dann aber sinken Nacht, Stille, Einsamkeit herab, und der Hochmut vergeht, das Herz klopft, die Brust zieht sich zusammen! Dann springt man zum Fenster hinaus, kniet in der Dornenhecke nieder, sucht den Arzt auf und bittet einen Kameraden, im selben Zimmer zu schlafen!
Tretet nachts wieder in euer Zimmer, und ihr werdet dort jemand finden; ihr seht ihn nicht, aber ihr fühlt deutlich dessen Anwesenheit. Geht in die Irrenanstalt und fragt den Irrenarzt, und er wird von Nervenschwäche, Verrücktheit, Brustbeklemmung und dergleichen sprechen, aber er wird euch niemals heilen!
Wohin könnt ihr also gehen, ihr alle, die ihr an Schlaflosigkeit leidet und die Strassen durchwandert, bis die Sonne wieder aufgeht?
Weltmühle, Gottes Mühle sind sprüchwörtlich geworden. Habt ihr dieses Sausen in den Ohren gehört, das dem Geräusch einer Wassermühle gleicht? Habt ihr in der Einsamkeit, bei Nacht oder selbst am hellen Tage, beobachtet, wie die Erinnerungen des vergangenen Lebens wieder auferstehen, eine nach der andern? Alle Verstösse, alle Vergehen, alle Dummheiten treiben euch das Blut bis in die Ohren, pressen euch den Schweiss bis in die Haare, jagen euch den Schauder bis in den Rücken. Ihr lebt das gelebte Leben noch einmal, von der Geburt bist auf den heutigen Tag, ihr leidet noch einmal alle erlittenen Leiden, ihr leert noch einmal all die bitteren Kelche, die ihr so oft geleert habt; ihr kreuzigt euer Skelett, weil kein Fleisch mehr zu töten ist; ihr verbrennt die Seele, weil euer Herz schon verbraucht ist.
Ihr kennt das!
Das ist die Mühle des Herrn, die langsam mahlt, aber fein und schwarz. Ihr seid in Staub aufgelöst, und ihr glaubt, es sei aus mit euch. Aber nein, es beginnt von neuem und ihr müsst die Mühe noch einmal durchgehen! Das ist die Hölle hier auf Erden; die ist von Luther erkannt worden, der es als eine besondere Gnade schätzt, auf dieser Seite der Feuerhimmel zermahlen zu werden.
Seid glücklich und dankbar!
Was ist zu machen? Sich demütigen?
Aber wenn ihr euch vor den Menschen demütigt, so weckt ihr deren Hochmut, weil sie glauben werden, sie seien besser als ihr, wie gross auch ihre Ruchlosigkeit ist.
Also vor Gott sich demütigen! Aber es ist eine Beleidigung, den Höchsten zu einem Plantagenbesitzer zu erniedrigen, der über Sklaven herrscht!
Beten! Wie? Sich das Recht anmassen, Wille und Urteil des Ewigen durch Schmeichelei und Kriecherei zu beeinflussen!
Gott suchen und den Teufel finden! Das ist mir geschehen.
Ich habe Busse getan, ich habe mich gebessert, und sobald ich meine Seele wieder besohlen will, muss ich einen neuen Rüster haben; setz neue Hacken an, und das Oberleder platzt. Zu Ende kommt man nicht.
Ich höre auf zu trinken und komme gegen neun Uhr abends nüchtern nach Haus, um ein Glas Milch zu nehmen. Das Zimmer ist von Dämonen erfüllt, die mich aus dem Bett reissen und unter der Decke ersticken. Wenn ich aber gegen Mitternacht berauscht nach Haus komme, schlafe ich ein wie ein Engel und erwache stark wie ein junger Gott, bereit wie ein Galeerensträfling zu arbeiten.
Ich meide Frauen, und ungesunde Träume beunruhigen meine Nächte.
Ich gewöhne mich, nur Gutes von meinen Freunden zu denken, ich vertraue ihnen meine Geheimnisse und mein Geld an: Alsbald werde ich verraten. Lehne ich mich gegen eine Treulosigkeit auf, so bin ich es immer, der bestraft wird.
Ich versuche die Menschen im allgemeinen zu lieben; ich mache mich blind gegen ihre Fehler, und mit einer Langmut ohne Grenzen lasse ich ihre Gemeinheiten und Verleumdungen durchgehen; eines Tages finde ich, dass ich ihr Mitschuldiger werde. Wenn ich mich von einer Gesellschaft, die ich für schlecht halte, zurückziehe werde ich alsbald von den Dämonen der Einsamkeit angefallen, und suche ich bessere Freunde, finde ich die schlimmsten.
Wenn ich die bösen Leidenschaften besiegt habe und durch Enthaltsamkeit zu einem gewissen Frieden des Herzens gelangt bin, empfinde ich eine Selbstzufriedenheit, die mich über meinen Nächsten erhebt; und das ist eine Todsünde, die Eigenliebe, die auf der Stelle bestraft wird.
Wie die Tatsache erklären, dass jede Lehrzeit in der Tugend ein neues Laster zur Folge hat.
Swedenborg löst die Frage, indem er sagt die Laster seien Strafen, die den Menschen für Sünden höherer Art auferlegt werden. So werden zum Beispiel die Ehrgeizigen zur sodomitischen Hölle verdammt. Geben wir zu, dass diese Lehre die Wahrheit enthält, so müssen wir unsere Laster ertragen und uns über die Gewissensqual, die sie begleitet, freuen, als bezahlten wir unsere Schulden am Schalter der grossen Kasse. Die Tugend suchen, bedeutet also, aus dem Gefängnis der Strafen zu entrinnen suchen.
Das hat Luther im Artikel 39 seiner Schrift gegen die römische Bulle sagen wollen, in dem er verkündigt: "Die Seelen des Fegefeuers sündigen unaufhörlich, weil sie den Frieden suchen und den Qualen ausweichen."
Ebenso in Artikel 34: "Die Türken bekämpfen, ist nichts anderes, als sich gegen Gott, der uns durch die Türken für unsere Sünden züchtigt, auflehnen."
Es ist also klar, dass "alle unsere guten Werke Todsünden sind", und dass "die Welt vor Gott schuldig sein muss, und dass niemand gerecht werden kann ohne die Gnade".
Leiden wir also, meine Brüder, ohne von dem Leben eine einzige wirkliche Freude zu erhoffen, denn wir sind in der Hölle.
Und klagen wir nicht den Herrn an, wenn wir die kleinen unschuldigen Kinder leiden sehen. Niemand wird wissen, warum sie leiden, aber die göttliche Gerechtigkeit lässt uns ahnen, dass sie Verbrechen sühnen, die begangen sind, bevor sie zur Welt kamen.
Freuen wir uns über die Qualen, die ebenso viele bezahlte Schulden sind, und glauben wir, dass wir aus Barmherzigkeit nicht erfahren, welche Ursachen ursprünglich unsere Strafen haben.
Sechs Monate sind vergangen, und ich gehe noch immer auf dem Stadtwall spazieren, von wo ich meine Blicke nach dem Irrenhaus schweifen lasse und nach dem blauen Streifen des fernen Meeres spähe. Von dort wird die neue Zeit, die neue Religion kommen, von der die Welt träumt.
Der düstere Winter ist begraben, die Felder grünen, die Bäume blühen, die Nachtigall schlägt im Garten der Sternwarte; aber die Traurigkeit des Winters lastet auf unseren Seelen, denn so viel unheilvolle Ereignisse, so viel unerklärliche Vorfälle haben wir erlebt, dass selbst die Ungläubigsten unruhig geworden sind. Die Schlaflosigkeit nimmt zu, die Nervenkrisen vermehren sich, die Visionen sind häufig geworden, wahre Wunder erfüllen sich. Man erwartet etwas.
Ein junger Mensch besucht mich.
—Was muss man tun, um nachts ruhig zu schlafen?
—Was ist geschehen?
—Ich weiss es wahrhaftig nicht zu sagen, aber ich habe einen Schrecken vor meinem Schlafzimmer bekommen, und ich ziehe morgen aus.
—Junger Mann, Atheist und Realist, was ist geschehen?
—Als ich heute Nacht die Tür öffnete, um einzutreten, fasste mich jemand beim Arm und schüttelte mich.
—Es ist also jemand in Ihrem Zimmer?
—Aber nein! Ich habe die Kerzen angezündet und ich habe niemand gesehen.
—Junger Mann, es gibt jemand, den man bei Kerzenlicht nicht sieht.
—Wer ist das?
—Das ist der Unsichtbare, junger Mann. Haben sie Sulfonal, Bromkalium, Morphium, Chloral genommen?
—Ich habe alles versucht!
—Und der Unsichtbare räumt nicht das Feld. Sie wollen nachts ruhig schlafen und Sie verlangen von mir das Mittel. Hören Sie, junger Mann, ich bin weder ein Arzt noch ein Prophet; ich bin ein alter Sünder, der Busse tut. Verlangen Sie weder Predigten noch Prophezeiungen von einem Schächer, der kaum Zeit genug hat, sich selber zu predigen. Ich habe an Schlaflosigkeit und Niedergeschlagenheit gelitten, ich habe Körper an Körper mit dem Unsichtbaren gerungen, und ich habe endlich Schlaf und Gesundheit wiedergewonnen. Wissen Sie, wie? Raten Sie!
Der junge Mann errät mich und schlägt die Augen nieder.
—Sie erraten es! Dann gehen Sie in Frieden und schlafen Sie gut!
Ich muss schweigen und mich erraten lassen, denn in dem Augenblick, in dem ich mir einfallen liesse, den Prediger zu spielen, würde man sich von mir wenden.
Ein Freund fragt mich:
—Wohin gehen wir?
—Ich wüsste es nicht zu sagen; mich persönlich scheint der Weg des Kreuzes zum Glauben meiner Väter zurückzuführen.
—Zum Katholizismus?
—Es scheint mir so! Der Okkultismus hat seine Rolle gespielt, indem er die Wunder und die Dämonologie wissenschaftlich erklärte. Die Theosophie, die der Religion den Weg bahnte, hat ausgelebt, nachdem sie die Weltordnung, die straft und belohnt, wiederhergestellt hat. Karma wird sich in Gott verwandeln, und die Mahatmas werden sich als die neugeborenen Mächte, als Zuchtgeister (Dämonen) und als Lehrgeister (Eingeber) enthüllen. Der Buddhismus, den das junge Frankreich pries, hat die Resignation und den Kultus des Leidens eingeführt, die geraden Weges nach Golgatha leiten.
Was das Heimweh betrifft, das ich nach der Mutterkirche empfinde, so ist das eine lange Geschichte, die ich in Kürze erzählen möchte.
Als Swedenborg mich lehrte, dass es verboten sei, die Religion seiner Väter zu verlassen, hat er dem Protestantismus, der ein Verrat an der Mutterkirche ist, das Urteil gesprochen.
Vielmehr, der Protestantismus ist eine den Barbaren des Nordens auferlegte Strafe; der Protestantismus, das ist das Exil, die babylonische Gefangenschaft. Aber die Rückkehr in das gelobte Land scheint nahe zu sein. Die grossen Fortschritte, die der Katholizismus in Amerika, England, Skandinavien macht, verkünden die allgemeine Versöhnung: zur selben Zeit hat die griechische Kirche dem Abendland die Hand gereicht.
Das ist der Traum der Sozialisten, die Vereinigten Staaten des Abendlandes wiederherzustellen, aber in geistigem Sinn verbessert. Doch bitte ich euch, nicht zu glauben, dass politische Überlegungen mich zur römischen Kirche zurückführen. Nicht ich habe den Katholizismus gesucht, er hat sich mir aufgedrängt, nachdem er mich jahrelang verfolgt hat. Mein Kind, das gegen meinen Willen katholisch wurde, hat mich die Schönheit eines Kultes gelehrt, der sich seit seinem Ursprung unberührt erhalten hat, und ich habe immer das Original der Kopie vorgezogen. Der lange Aufenthalt im Lande meines Töchterchens liess mich die hohe Aufrichtigkeit des religiösen Lebens bewundern. Von ähnlicher Wirkung war mein Aufenthalt im Krankenhaus des heiligen Ludwig und schliesslich meine Abenteuer der letzten Monate.
Nachdem ich mein Leben, das mich wie gewisse Verdammte in Dantes Hölle dem Wirbelwind überlieferte, untersucht und dabei erkannt hatte, dass mein Dasein im ganzen keinen anderen Zweck gehabt habe, als mich zu demütigen und zu besudeln, entschloss ich mit, den Henkern zuvorzukommen und selbst die Folterungen an mir zu vollziehen. Ich wollte mitten in den Leiden, Unsauberkeiten und Todesängsten leben und bereitete mich vor, eine Stelle als Krankenpfleger zu suchen und zwar im Hospital der Frères Saint-Jean-de-Dieu zu Paris. Dieser Gedanke kam mir am Morgen des 29. April, nachdem ich einer alten Frau mit einem Totenkopf begegnet war. Als ich nach Hause kam, fand ich auf meinen Tisch "Seraphita" aufgeschlagen; auf der rechten Seite zeigte ein Holzsplitter auf diesen Satz:
"Tut für Gott, was ihr für eure ehrgeizigen Pläne tun würdet; was ihr tut, wenn ihr euch einer Kunst widmet; was ihr getan habt, als ihr ein Wesen mehr als ihn liebtet; oder als ihr ein Geheimnis der menschlichen Wissenschaften verfolgtet! Ist Gott nicht die Wissenschaft selbst...."
Am Nachmittag erhielt ich die Zeitung "L'Eclair", und—welcher Zufall!—das Hospital der Frères Saint-Jean-de-Dieu wird zweimal im Text genannt.
Am 1. Mai las ich zum erstenmal in meinem Leben, "Wie man Magier wird" von Peladan.
Peladan, mir bis heute ein Unbekannter, erscheint wie ein Gewitter, eine Offenbarung des höheren Menschen, des Nietzscheschen Übermenschen, und mit ihm hält der Katholizismus seinen feierlichen und sieghaften Einzug in mein Leben.
Ist "der da kommen soll", in der Person Peladans gekommen? Der Dichter-Denker-Seher, ist er es, oder sollen wir noch eines andern warten?
Ich weiss es nicht; aber nachdem ich diese Vorhallen zu einem neuen Leben überschritten habe, beginne ich am 3. Mai dieses Buch zu schreiben.
Am 5. Mai besucht mich ein katholischer Priester, ein Konvertit.
Am 9. Mai sehe ich Gustav Adolf in der Asche des Kamins.
Am 14. Mai las ich in Peladan: "An Zaubereien zu glauben, war gut gegen das Jahr tausend; beim Nahen des Jahres zweitausend stellt ein Beobachter fest, das mancher Mensch die verhängnisvolle Eigenschaft besitzt, dem, der ihn verletzt, Unglück zu bringen. Du verweigerst ihm eine Bitte, und deine Geliebte betrügt dich; du machst ihn schlecht, und du musst das Bett hüten; alles Böse, was du ihm antun willst, wendet sich in verstärktem Masse gegen dich.—Tut nichts, der Zufall wird dieses unerklärliche Zusammentreffen erklären; der Zufall genügt dem Determinismus des Modernen".
17. Mai.—Ich las von dem Dänen Jörgensen, der sich zum Katholizismus bekehrt hat, eine Schrift über das Kloster Beuron.
18. Mai.—Ein Freund, den ich seit sechs Jahren nicht gesehen habe, ist soeben nach Lund gekommen und zieht in das Haus, in dem ich wohne. Man denke sich meine Bewegung, als ich erfahre, dass er sich soeben zum Katholizismus bekehrt hat. Er leiht mir das römische Gebetbuch, da ich meins vor einem Jahr verloren habe; als ich die lateinischen Kirchenlieder wieder lese, fühle ich mich zu Hause.
27. Mai.—Nachdem wir mehrere Male über die Mutterkirche gesprochen haben, hat mein Freund an das belgische Kloster, in dem er getauft worden ist, einen Brief geschrieben und um einen Ruhesitz für den Verfasser dieses Buches gebeten.
28. Mai.—Ein Gerücht läuft um, Annie Besant sei katholisch geworden; aber es wird nicht bestätigt.
Ich warte noch auf die Antwort des belgischen Klosters.
Wenn dieses Buch gedruckt sein wird, werde ich die Antwort empfangen haben. Und dann? Darauf?—Ein neuer Spass der Götter, die laut auflachen, wenn wir heisse Tränen weinen?
Lund, 3. Mai bis 25. Juni 1897
Ich hatte dieses Buch zuerst mit dem Ausruf beendet: "Welcher Schwindel, welcher traurige Schwindel ist das Leben!"
Nachdem ich aber etwas nachgedacht hatte, fand ich den Satz unwürdig und strich ihn.
Aber die Unschlüssigkeit hörte nicht auf, und ich nahm meine Zuflucht zur Bibel, um die ersehnte Aufklärung zu erhalten.
Dies hat es mir geantwortet, das heilige Buch, das mehr als jedes andere mit wunderbaren prophetischen Eigenschaften ausgestattet ist:
"Ich will mein Angesicht wider ihn setzen, dass er zum Zeichen und Sprichwort werden soll, und ich will ihn aus meinem Volk roden, dass ihr erfahren sollt, Ich sei der Herr.
"Wo aber ein Prophet sich betören lässt, etwas zu reden, den habe Ich, der Herr, betörtet, und will meine Hand über ihn ausstrecken, und ihn aus meinem Volk Israel roden." (Hesekiel 14, 8/9.)
Das also ist die Gleichung meines Lebens: ein Zeichen, ein Beispiel, um andern zur Besserung zu dienen; ein Sprichwort, um zu zeigen, wie eitel Ruhm und Ehre sind; ein Sprichwort, um die Jugend aufzuklären, wie man nicht leben darf, ein Sprichwort, ich, der ein Prophet zu sein glaubte, und sich als Betrüger entlarvt sieht.
Nun, der Ewige hat diesen Betrüger-Propheten verleitet, aufzutreten und zu sprechen, und der falsche Prophet fühlt sich unverantwortlich, da er die Rolle gespielt hat, die ihm auferlegt wurde.
Hier ist, meine Brüder, ein Menschenschicksal unter so vielen andern; gebt zu, dass das Leben eines Menschen ein Schwindel scheinen kann!
Warum ist der Verfasser dieses Buches auf eine so ausserordentliche Art bestraft worden? Man lese das Mysterium, das dem Text vorangeht. Es ist vor dreissig Jahren geschrieben worden, bevor der Verfasser etwas von den Ketzern, die "Stedinger" heissen, wusste. Papst Gregor IX. tat sie 1232 in den Bann, wegen ihrer satanistischen Lehre: "Lucifer, der gute Gott, von "dem andern" verjagt und abgesetzt, wird zurückkehren, wenn sich der Usurpator, Gott genannt, durch seine elende Regierung, seine Grausamkeit und Ungerechtigkeit bei den Menschen verächtlich gemacht und von seiner eigenen Unfähigkeit überzeugt haben wird".
Der Fürst dieser Welt, der die Sterblichen zu Lastern verurteilt und die Tugend durch das Kreuz und den Scheiterhaufen, durch Schlaflosigkeit und Alpdrücken züchtigt, wer ist er? Der Henker, dem wir überliefert sind, für unbekannte oder vergessene Verbrechen, die wir in einer andern Welt begangen haben!
Und die Zuchtgeister Swedenborgs? Schutzengel, die uns vor geistigen Übeln bewahren!
Welche babylonische Verwirrung!
Augustinus hat es für unklug erklärt, am Dasein von Dämonen zu zweifeln.
Thomas von Aquino hat verkündet, Dämonen riefen Gewitter und Blitzschläge hervor, und diese Geister könnten ihre Macht den Händen der Sterblichen anvertrauen.
Papst Johannes XXII. Beklagt sich über unerlaubte Kunstgriffe seiner Feinde: die quälten ihn, indem sie seine Porträts mit Nadeln zerstachen. (Behexung.)
Luther ist der Ansicht, dass alle Unfälle, Knochenbrüche, Einstürze, Feuersbrünste, die meisten Krankheiten von Teufeln herrühren, die ihr Spiel treiben.
Luther geht noch weiter und spricht die Ansicht aus, gewisse Menschen hätten ihre Hölle schon in diesem Leben gefunden.
Habe ich also mit gutem Vorbedacht mein Buch "Inferno" getauft?
Wenn der Leser meine Ansicht als zu pessimistisch in Zweifel zieht, lese er meine Lebensgeschichte: "Der Sohn einer Magd, Die Entwicklung einer Seele, Die Beichte eines Toren".
Wer dieses Buch für eine Dichtung halten sollte, möge mein Tagebuch vergleichen, das ich seit 1895 Tag für Tag geführt habe und von dem dieses Buch nur eine ausgeführte und geordnete Bearbeitung ist.
Meinen Unglücksbrüdern
eigne ich dieses Buch zu, indem ich mir zu gleicher Zeit ihre Nachsicht für die Sünden der Indiskretion erbitte, die ich darin aus ehrlicher Absicht und zu lobenswertem Zweck begangen habe. Es wird ihre Sache sein, mich freizusprechen oder zu verurteilen, und mir kommt nur zu, sie um Verzeihung zu bitten, falls ich wehgetan habe.
Der Verfasser.
Gejagt von den Erinnyen, wurde ich schliesslich im Dezember 1896 in der kleinen Universitätsstadt Lund in Schweden festgehalten. Eine Anhäufung kleinbürgerlicher Häuser um eine Domkirche, ein palastartiges Universitätsgebäude und eine Bibliothek, bildet die Stadt eine Zivilisations-Oase in der grossen südschwedischen Ebene.
Ich muss den raffinierten Scharfsinn bewundern der mir diesen Ort zum Gefängnis ausersehen hat. Von den "Eingeborenen" in Schonen wird die Universität Lund sehr geschätzt, aber für einen Mann vom Norden, wie ich es bin, ist der Umstand, dass man hier lebt, ein Zeichen, dass man heruntergekommen ist.
Ferner für mich, der ich hoch in den Vierzigern stehen, zwanzig Jahre lang verheiratet gewesen bin, mich an ein regelmässiges Familienleben gewöhnt habe, ist es eine Demütigung, eine Relegation, auf den Umgang mit Studenten angewiesen zu sein; Junggesellen, die einem ausschweifenden Kneipenleben ergeben und wegen ihrer oppositionellen Denkart bei den väterlichen Autoritäten der Akademie mehr oder weniger schlecht angeschrieben sind.
Gleichaltrig und einst Kamerad der Professoren, die mich jetzt nicht mehr kennen, werde ich gezwungen, meine Gesellschaft bei den Studenten zu suchen, also die Rolle eines Feindes der Alten und der angesehenen Gesellschaftskreise zu übernehmen.
Heruntergekommen, das ist das rechte Wort. Und warum? Weil ich es verschmähte, mich den Gesetzen des Gesellschaftslebens und der Familiensklaverei zu unterwerfen. Aus eine heilige Pflicht habe ich den Kampf für die Aufrechterhaltung meiner Persönlichkeit betrachtet, ob diese nun gut oder schlecht sein mag.
In Acht erklärt, scheel angesehen, von Vätern und Müttern als ein Verführer der Jugend verflucht, bin ich in eine Lage versetzt, die an die der Schlange im Ameisenhaufen erinnert, um so mehr als ich infolge von Geldverlegenheit die Stadt nicht verlassen kann.
Geldverlegenheit! Das ist nun mein Schicksal seit drei Jahren, und ich kann es nicht erklären, wie es kommt, dass alle Quellen versiegt sind, nachdem aller Vorrat erschöpft war. Vierundzwanzig Theaterstücke von meiner Hand, jetzt aufgelegt im Winkel, und kein einziges wird mehr gespielt; ebenso viele Romane und Erzählungen und kein Band ist in neuer Auflage herausgekommen. Alle Versuche, eine Anleihe aufzunehmen, sind gescheitert und scheitern noch immer. Nachdem ich alles verkauft hatte, was ich besass, zwang die Not mich schliesslich, die Briefe zu verkaufen, die ich Laufe der Jahre empfangen habe, das heisst fremdes Eigentum!
Diese unveränderliche Armut scheint mir so deutlich auf einer besonderen Absicht zu beruhen, dass ich sie schliesslich gutwillig hinnehme, als einen Bestandteil meiner Sündenbusse, und nicht mehr Widerstand zu leisten suche.
Was mich selbst betrifft, für mich als freien Schriftsteller hat die Mittellosigkeit nichts zu bedeuten, aber nicht für den Unterhalt meiner Kinder sorgen zu können, das ist die reine Schande.
Nur zu denn mit der Schande! Nur zu mit der Schmach! Nur zu mit dieser Hölle! Ich gebe der Versuchung nicht nach, die falsche Ehre mit meinem Leben zu bezahlen!
Gefasst auf alles, leere ich entschlossen bis auf den Grund die äusserste der ausserordentlichen Demütigungen; und man gebe acht, wie meine Sühneleiden anfangen.
Wohlerzogene Jünglinge aus wohlhabenden Familien bringen mir eines Nachts eine Katzenmusik im Korridor. Ich nehme sie entgegen wie etwas Wohlverdientes und ohne mich zu rühren.
Ich will eine möblierte Wohnung mieten. Die Vermieter sagen nein unter durchsichtigen Vorwänden, und die abschlägige Antwort wird mir ins Gesicht geworfen. Ich mache Besuche und werde nicht angenommen. Nur Kleinigkeiten!
Was dagegen meine Seele geisselt, ist die erhabene Ironie, die sich in dem unbewussten Benehmen meiner jungen Freunde offenbart, wenn sie mir Mut einflössen wollen, indem sie Lobreden auf meine literarische Laufbahn halten: "so fruchtbar an befreienden Ideen" usw.! Und ich habe eben diese sogenannten Ideen auf den Kehrrichthaufen geworfen; die Träger dieser Ansichten sind also meine Gegner geworden! Ich führe Krieg mit meinem alten Ich; indem ich meine Freunde und meine früheren Gesinnungsgenossen bekämpfe, schlage ich mich selbst zu Boden.
Das ist gut arrangiert; und als Dramatiker muss ich die prächtige Komposition in dieser Tragikomödie bewundern. Wahrhaftig, eine gut gemachte Szene.
Da sich aber die alten und neuen Ansichten während dieser Epoche des Übergangs so kreuzen, dass sie sich verstricken, nimmt man es nicht so genau mit einem Alten, wie ich es bin, lauscht nicht so ernsthaft auf meine Argumente, sondern fragt mich lieber nach Neuigkeiten in der Welt der Ideen.
Ich schliesse ihnen den Vorhof zum Isistempel auf und sage voraus, dass der Okkultismus im Anzuge ist. Da tobt man und säbelt mich nieder, indem man die Waffen benutzt, die ich selbst während zwanzig Jahre gegen Aberglauben und Mystizismus geschmiedet habe.
Da diese Debatte immer in Kneipen bei unmässigem Verbrauch vom Saft der Traube gehalten werden, vermeidet man in heftigen Wortwechsel zu geraten, und ich gewöhne mich daran, nur Tatsachen und wirkliche Fälle zu erzählen, indem ich die Maske eines aufgeklärten Skeptikers anlege. Es kann gewiss nicht gesagt werden, dass man Widerwillen gegen alles Neue hat, im Gegenteil; aber man ist konservativ geworden, das es das Ideal gilt, das man sich durch Streit erkämpft hat; man ist nicht geneigt zu desertieren, noch weniger einen Glauben abzuschwören, der durch Bluttaufe teuer bezahlt worden ist. Es kommt also mir zu, zwischen dem Naturalismus und dem Supernaturalismus eine Brücke zu schlagen, indem ich verkündige, dass der letzte nur eine Entwicklung des ersten ist.
Zu diesem Zweck stelle ich das Problem auf, eine, wie eben angedeutet, natürliche und wissenschaftliche Lösung für alle unerklärlichen Erscheinungen zu geben, die uns auf den Leib gerückt sind. Ich zerspalte meine Persönlichkeit und zeige der Welt den naturalistischen Okkultisten, erhalte aber aufrecht in meinem Innern und pflege den Keim zu einer konfessionslosen Religion. Oft gewinnt die exoterische Rolle die Oberhand; ich mische meine beiden Naturen so durcheinander, dass ich über meinen neuerworbenen Glauben lachen kann; das trägt dazu bei, dass meine Theorien sich bei den widerspenstigen Gemütern einschleichen können.
Der Dezember vergeht träge und furchtbar düster unter einem dunkelgrauen rauchigen Himmel. Obgleich ich bei Swedenborg Aufklärung über die Art meiner Leiden gewonnen habe, kann ich mich nicht dazu bringen, mich auf einmal unter die Hand der Mächte zu beugen. Mein Hang, Einwendungen zu machen, erhebt sich, und ich will immer noch die eigentliche Ursache nach aussen verlegen und sie in der Bosheit der Menschen suchen. Tag und Nacht von "elektrischen Strömen" angegriffen, welche die Brust zusammenklemmen und ins Herz stechen, verzichte ich auf meine Folterkammer und besuche das Wirtshaus, wo ich Freunde treffe. Aus Furcht, nüchtern zu werden, trinke ich; das ist das einzige Mittel, um nachts schlafen zu können. Aber Ekel und Schamgefühl, im Verein mit der friedlosen Unruhe, nötigen mich damit aufzuhören, und einige Abende gehe ich in das Café der Temperänzler, das den Namen "Das blaue Band" trägt. Doch, ich werde ängstlich vor der Gesellschaft, die man dort trifft. Bläulichblasse und abgequälte Gesichter, unheimliche und böse Augen, und ein Schweigen, das nicht der Friede von Gott ist.
Wenn alles zusammen kommt, ist der Wein eine Wohltat und die Enthaltsamkeit eine Züchtigung. Und ich kehre nach dem halbnüchternen Wirtshaus zurück, ohne dort die Grenzen zu überschreiten, nachdem ich mich selbst mit Teeabenden gestraft habe.
Weihnachten steht vor der Tür und ich sehe dem Fest der Kinder mit einer kühlen Bitterkeit entgegen, die ich kaum mit dem Namen Resignation ehren will. Seit sechs Jahren habe ich alles leiden müssen und bin nun gefasst auf alles.
Einsam und in einem Hotel! Nun, das ist ja lange mein Alp gewesen, und ich habe mich daran gewöhnt. Es sieht aus, als ob alles, was ich verabscheue, mir vorbehalten wäre.
Inzwischen ist die Vertraulichkeit zwischen mir und dem Freundeskreise so gross geworden, dass man anfängt mir sein Herz auszuschütten. Die Sache ist die: Während der letzten Monaten sind so manche Dinge geschehen.... So?
So manche ungewöhnliche, unerwartete Dinge....
—Lass hören!
Man erzählt mir: das Haupt des revoltierenden Jugendschwarms, der freieste Freidenker, der neulich aus einer Kuranstalt für Alkoholisten gekommen ist und das Gelübde der Nüchternheit abgelegt hat, sei jetzt bekehrt worden, so dass er geradezu....
—Nun, was?
—Busspsalmen singt.
—Unglaublich!
In der Tat hatte der junge Mann, der mit einer nicht gewöhnlichen Intelligenz ausgerüstet war, gegenwärtig seine Aussichten dadurch verdorben, dass er die an der Universität herrschenden Ansichten heftig angegriffen hatte, eingeschlossen den Missbrauch starker Getränke. Bei meiner Ankunft hielt er sich etwas abseits auf Grund seiner Mässigkeit, doch war er es, der mir Swedenborgs "Arcana coelestia" lieh, die er aus der Bücherei seines Elternhauses nahm. Und ich erinnere mich jetzt: nachdem ich angefangen hatte die Arbeit zu lesen, setzte ich ihm Swedenborgs Theorien auseinander und schlug ihm vor, den Propheten zu lesen, um Licht zu erhalten; er aber unterbrach mich mit einer Gebärde des Entsetzens.
—Nein! Ich will nicht! Nicht jetzt! Später!
—Ist dir bange?
—Ja, für den Augenblick!
—Aber nur als literarische Kuriosität?
—Nein!
Ich glaubte anfangs, er scherze, später aber wurde mir klar, dass es voller Ernst gewesen war.
Also scheint es eine allgemeine Erweckung zu sein, die durch die Welt geht, und ich brauche nicht zu verbergen, wie es mir geht.
—Sag mir, alter Junge, kannst du nachts schlafen?
-Nicht gerade viel! Siehst du, wenn ich wach liege, kommt mein ganzes verflossenes Leben und passiert Revue; alle Dummheiten, die ich begangen habe, alle Leiden und alles Unglück zieht vorbei, aber vor allem die Dummheiten. Und wenn die Reihe zu Ende ist, beginnt sie wieder von neuem!
—Auch du also!
—Auch?
—Ja! Das ist die Krankheit der Zeit! Man nennt das Gottes Mühle!
Bei dem Worte Gott grinst er und erwidert:
—Ja, es ist eine komische Zeit, in der wir leben; die verkehrte Welt.
—Oder der Wiedereintritt der Mächte!
Die Weihnachtstage sind zu Ende. Meine Tischgesellschaft hat sich infolge der Ferien in die Umgebung von Lund zerstreut. Da kommt eines Morgens mein Freund, der Arzt, mein Psychiater, und zeigt mir ein Schreiben, in dem uns unser Freund der Dichter in sein Elternhaus, ein Gut wenige Meilen von der Stadt, einladet.
Ich weigere mich mit hinauszufahren, da ich Reisen verabscheue.
—Aber er fühlt sich unglücklich.
—Was ist ihm denn?
—Schlaflosigkeit; du weisst, er hat wieder gekneipt....
Ich schütze eine dringende Arbeit vor, und die Frage bleibt unentschieden. Am Nachmittag berichtet ein neues Schreiben, dass der Dichter krank ist und um den ärztlichen Rat seines Freundes bittet.
—Wie ist es jetzt mit ihm?
—Er ist nervös, Neurastheniker, und glaubt sich verfolgt....
—Von Dämonen?
—Nicht gerade, aber jedenfalls....
In einem Anfall von Galgenhumor, hervorgerufen, durch das Gefühl, Genossen im Unglück zu haben, lasse ich mich bestimmen, mitzufahren.
—Nun, dann machen wir uns auf den Weg; du besorgst die Medizin und ich treibe den Teufel aus.
Übrigens denke ich diese Lustfahrt mit meinen Ausflügen zu kombinieren, die ich mache, um Schonen zu studieren.
Als die Sache abgemacht ist, packe ich meine Reisetasche; wie ich die Hoteltreppe hinuntergehe, werde ich unvermutet von einer Frau angesprochen.
—Verzeihen Sie, sind Sie Doktor Norberg?
—Nein, das bin ich nicht, antworte ich nicht gerade zu höflich, da ich glaubte es mit einer Dirne zu tun zu haben.
—Können Sie mir sagen, wieviel die Uhr ist? Fuhr sie fort.
—Nein!
Und ich räume das Feld.
Wie wenig merkwürdig diese Szene auch war, die hinterliess doch einen beunruhigenden Eindruck bei mir.
Am Abend bleiben wir in einem Dorf, um dort die Nacht zuzubringen. Ich war gerade in mein Zimmer gekommen, eine Treppe hoch, und hatte mich etwas säubern können, als das gewöhnliche Geräusch sich über mir hören liess; man schleppt Möbel und macht Tanzschritte.
Dieses Mal begnüge ich mich nicht mit Verdacht, sondern klettre in Gesellschaft meines Kameraden die Bodentreppe hinaus, um mir Gewissheit zu verschaffen. Aber dort oben ist nichts Verdächtiges zu finden, da niemand über meinem Zimmer unter den Dachpfannen wohnt.
Nachdem wir die Nacht schlecht geschlafen haben, setzen wir die Fahrt fort und befinden uns einige Stunden später im Elternhaus des Dichters, der hier beinahe als ein verlorener Sohn religiöser Eltern, guter und redlicher Mensch, erscheint. Der Tag vergeht unter Spaziergängen in einer schönen Landschaft und unschuldigen Gesprächen. Der Abend senkt sich herab und bringt einen unbeschreiblichen Frieden in eine häusliche Umgebung, in der der Arzt und ich uns gänzlich verloren vorkommen, er noch mehr als ich, da er Atheist ist.
Spät am Abend ziehen wir uns in das Zimmer zurück, das dem Doktor und mir angewiesen ist. Als ich etwas zu lesen suche, bekomme ich die "Magie des Mittelalters" von Viktor Rydberg in die Hand. Immer dieser Schriftsteller, dem ich ausgewichen bin, so lange er lebte, und der mich nach seinem Tod verfolgt!
Ich blättere in dem Buche, und der Blick heftet sich auf die Stelle über Incubi und Succubi. Der Verfasser glaubt an so etwas nicht und zieht den Teufelsglauben ins Lächerliche.
Aber ich kann nicht lachen; die Lektüre erregt bei mir Anstoss, und ich beruhige mich bei dem Gedanken, das der Verfasser jetzt seine Ansicht geändert haben dürfte!
Indessen ist das Lesen solcher unheimlichen und magischen Dinge nicht geeignet, Schlaf hervorzurufen, und eine gewisse Unruhe in den Nerven macht sich vernehmbar. Deshalb wird der Vorschlag, zusammen nach dem Bequemlichkeitshäuschen zu gehen, angenommen als eine heilsame Zerstreuung und eine hygienische Einleitung für die Nacht, vor der ich Furcht habe.
Mit einer Laterne versehen, streben wir über den Hof, wo bei einem wolkigen Himmel die Skelette der bereiften Bäume unter der neckischen und launenhaften Windsbraut krachen.
—Ich glaube, ihr fürchtet euch vor eurem eigenen Schatten, lacht der Arzt verächtlich.
Keiner antwortet, denn die Windstösse versuchen uns auf eine ganz persönliche Weise umzuwerfen, stellen uns ein Bein, reissen uns am Haar, heben den Rockschoss auf.
Angekommen an Ort und Stelle, die neben dem Stall und unter dem Heuboden lag, werden wir von einem Lärm über unsern Köpfen begrüsst und—seltsam—es ist genau das Geräusch, das mich seit einem halben Jahr verfolgt.
—Horch! Hört ihr etwas?
—Ja, es sind Leute oben, die dem Vieh Futter geben! antwortet der Dichter.
Ich will die Tatsache nicht leugnen, warum aber gerade in dem Augenblick, da ich eintrete? Und wie kommt es, dass das Unwesen überall dieselben akustischen Formen annimmt? Es muss unbedingt jemand sein, ein Unsichtbarer, der diese Katzenmusik für mich anstellt; es ist keine Gehörshalluzination, da die anderen dieselbe physische Wahrnehmung haben wie ich.
Als wir ins Schlafzimmer zurückgekommen sind, wird dennoch nichts aus der Ruhe. Der Dichter, der sich den ganzen Tag ruhig verhalten hat, dem die Eltern ein Bodenzimmer zum Schlafen angewiesen haben, macht den Anfang damit, unruhig auszusehen, und gesteht schliesslich ein, dass er sich nicht getraut allein zu schlafen, weil der Alp ihn reite.
Ich trete ihm mein Lager ab und darf statt dessen über einen grossen Saal nebenan verfügen, der mit einem ungeheuren Bett versehen ist.
Der ungeheizte Saal, ohne Rouleaux und fast unmöbliert, lastet auf meinem Gemüt mit einem Unbehagen, das beständig durch die Feuchtkühle vermehrt wird.
Um mich zu zerstreuen, suche ich nach Büchern und finde auf einem kleinen Tisch die Bibel mit Gustae Dores Illustrationen sowie eine Sammlung Andachtsbücher. Da erinnere ich mich, dass ich in ein religiöses Haus eingedrungen bin, dass ich der Freund des verlorenen Sohnes und ein Verführer der Jugend bin. Welche demütigende Rolle für einen achtundvierzigjährigen Mann. Wie erniedrigend!
Und ich verstehe das Leiden des jungen Mannes, der zwischen tugendhafte und fromme Menschen eingesperrt ist. Das muss dieselbe Pein sein wie für den Teufel, die Messe zu besuchen. Und um den Dämon mit dem Dämon zu vertreiben, bin ich hierher eingeladen; ich bin gekommen, um durch Befleckung diese reine Luft zum Einatmen möglich zu machen, da der junge Mann sie nicht ertragen kann.
Unter derartigen Gedanken bin ich zu Bett gegangen. Der heilige Schlaf war früher meine letzte und treueste Zuflucht, deren Erbarmen mir niemals mangelte. Jetzt hat der Tröster in der Nacht mich im Stich gelassen und das Dunkel erschreckt mich.
Die Lampe ist angezündet, und Stille herrscht nach dem Sturm. Da weckt ein unbekannter surrender Laut meine Aufmerksamkeit und reisst mich aus dem Halbschlaf. Und ich werde gewahr, wie oben im Saale ein Insekt hin und her fliegt. Was mich aber wundert, ist, dass ich die Art nicht kenne, obgleich ich in der Insektenkunde zu Hause bin und mir schmeichle, alle Zweiflügler in Schweden auswendig zu können. Und dies ist kein Schmetterling, kein Seidenspinner und auch keine Motte, es ist eine Fliege, schwarz, länglich, aber mit einem Tonfall ausgerüstet, der dem einer Gallwespe oder eines Nachtfalters gleicht. Ich stehe auf, um Jagd darauf zu machen; Fliegenjagd zu Ende Dezember! Sie macht sich unsichtbar.
Ich will wieder unters Laken kriechen und mich in meine Betrachtungen versenken.
Aber das fliegt das verdammte Tier unter dem Kopfkissenbezug hervor; nachdem es nun meinen Bett Ruhe und Wärme entlehnt hat, lenkt es seinen Flug kreuz und quer. Ich lasse das Geschöpf gewähren, sicher, dass ich es bald an der Lampe fange, wohin die Flamme es schon locken wird.
Dieser Augenblick lässt nicht auf sich warten, und sobald die Fliege innerhalb des Lampenschirmes gekommen ist, versengt ein Streichholz ihre Flügel so, dass der Friedensstörer seinen Totentanz aufführt und sich leblos auf den Rücken legt. Durch den Augenschein überzeuge ich mich davon, dass es ein unbekanntes zweiflügliges Insekt ist, keine zwei Zentimeter lang, schwarz mit zwei feuerroten Punkten auf den Flügeln.
Was war das? Ich weiss es nicht, aber am nächsten Tage gebe ich den andern Gelegenheit das Dasein der toten Fliege zu bestätigen.
-Eine Hexe! Wirft der Doktor hin.
-Die lebendig verbrannt worden ist!
Indessen, nach bewerkstelligtem Autodafé schlafe ich ein.
Mitten in der Nacht werde ich von Wimmern und Zähneklappern geweckt, das aus dem Zimmer nebenan tönt. Ich zünde ein Licht an und gehe hinein. Mein Freund, der Arzt, hat sich mit dem halben Körper aus dem Bett geworfen und windet sich, ein Raub schrecklicher Konvulsionen, den Mund weit geöffnet; er zeigt mit einem Wort alle Symptome der grossen Hysterie, wie sie in Charcots Abhandlung beschrieben sind, und zwar in einem Grade, dass er ein Bild von dem Stadium gibt, das Besessenheit genannt wird. Und er, ein Mann von hervorragender Intelligenz und gutem Herzen, nicht lasterhafter als andere, gut gewachsen, mit regelmässigen und angenehmen Gesichtszügen, ist nun so entstellt, dass er dem Bilde eines Teufels des Mittelalters gleicht.
Entsetzt wecke ich ihn auf.
—Hast du geträumt, alter Junge?
—Nein! Es war nur ein Anfall von Alpdrücken!
—Incubus!
—Ja, wahrhaftig! Es war jemand, der drückte mir die Lungen zusammen. Etwas im selben Stil wie ... "angina pectoris".
Ich reiche ihm ein Glas Milch; er zündet eine Zigarre an, und ich gehe in meinen Saal zurück.
Aber nun ist es für mich mit dem Schlafen vorbei. Was ich gesehen hatte, war zu furchtbar, und bis zum Morgen setzen meine Kameraden ihren Strauss mit dem Unsichtbaren fort.
Man trifft sich beim Frühstück, und die Geschehnisse der Nacht werden ins Lächerliche gezogen. Aber unser Wirt lacht nicht; welchen Umstand ich der religiösen Denkart zuschreibe, die ihm Achtung vor den verborgenen Mächten lehrt.
Die schiefe Stellung, in der ich mich befinde, zwischen den Alten, die ich billige, und den Jungen, die zu tadeln ich kein Recht habe, lässt mich auf die Abreise dringen.
Als wir vom Tisch aufstehen, bittet der Herr des Hauses, den Arzt um eine besondere Konsultation, und sie ziehen sich für eine halbe Stunde zurück.
—Was fehlt dem Alten?
—Er kann nicht schlafen! Nächtliche Herzaffektionen....
—Also er auch! Der gerechte und fromme Mann! Das ist also eine Epidemie, die keinen verschont.
Ich will nicht verhehlen, dass dieser Umstand mich aufrichtete, und gleich nahmen der Aufruhrgeist und die Zweifelsucht meine Seele wieder in Besitz. Die Dämonen herausfordern, den Unsichtbaren trotzen und zuletzt unterjochen! Das war die Losung, die ich mir gab, als ich diese gastfreie Familie verliess, um meine beabsichtigten Ausflüge in Schonen zu machen.
Am selben Abend in der Stadt Höganäs angelangt, nehme ich mein Abendessen im grossen Speisesaal des Hotels ein; dabei habe ich einen Zeitungsmann zur Gesellschaft. Sowie wir uns zu Tisch gesetzt haben, lässt sich das übliche Poltern über meinem Kopfe hören; und um mich gegen die Mangelhaftigkeit meiner eigenen Wahrnehmung zu sichern, lasse ich die Erscheinung von dem Zeitungsmann beschreiben; der bezeugt deren Wirklichkeit.
Als wir nach beendeter Mahlzeit hinausgingen, stand die unbekannte Frau, die mich vor der Abreise von Lund angesprochen hatte, ganz unbeweglich draussen vor dem Portal und liess mich und meinen Begleiter vorbeidefilieren.
Da vergesse ich die Dämonen und die Unsichtbaren und verfalle von neuem auf die Vermutung, dass ich von sichtbaren Feinden verfolgt bin. Aber im nächsten Augenblick widerlege ich diese Annahme, indem ich mich an meinen unvorhergesehenen Besuch beim Schuhmacher in Malmö erinnere; auch in jener Nacht, als wir nach dem Stallgebäude gingen, war unmöglich eine überlegte Intrige anzunehmen.
Die schrecklichen Zweifel sitzen fest und höhlen mir das Gehirn aus, erhitzen mein Blut und flössen mir Ekel vor dem Leben ein.
Doch die Nacht hat mir eine Überraschung vorbehalten, die mich mehr erschreckt als die letzten Tage zusammengenommen.
Ermüdet von der Reise gehe ich um elf Uhr zu Bett. Alles ist still im Hotel und kein Poltern vernehmbar. Mein Mut wächst, und ich falle in einen tiefen Schlaf, um nach einer halben Stunde von einem Lärm und Gepolter, das im Zimmer über dem meinen ist, geweckt zu werden. Es scheint mindestens eine Stiege junger Leute zu sein, die singen, auf den Boden stampfen, Stühle hin und her schieben.
Dies wilde Leben währt bis zum Morgen!
Warum ich nicht beim Wirt Klage führe? Weil es mir im Laufe meines Lebens nie gelungen ist, recht zu bekommen. Dazu geboren und vorherbestimmt, unrecht zu bekommen, habe ich aufgehört, mich zu beklagen.
Am Morgen setze ich meine Reise fort, um die Steinkohlegruben, bei Höganäs zu besehen. Im selben Augenblick, wie ich ins Wirtshaus eintrete, um ein Fuhrwerk zu bestellen, beginnt der gewöhnliche Hexensabbath oben. Unter einem Vorwand, ich erinnere mich jetzt nicht, welcher, steige ich eine Treppe hinauf. Ein grosser Saal, der leer ist, ist alles, was ich dort finde.
Da die Gruben nicht vor zwölf Uhr besehen werden dürfen, lasse ich mich nach einem Fischerort einige Meilen nördlich fahren, von wo die Aussicht über den Sund sehr berühmt ist.
Als der Wagen durch den Schlagbaum vor dem Dorfe fährt, fühle ich auf einmal meinen Brustkorb von hinten zusammengeklemmt, ganz als ob jemand mir seine Knie in den Rücken stemme, und die Illusion ist so vollständig, dass ich mich umwende, um den Feind, der hinten aufsitzt, in Augenschein zu nehmen.
Da erhebt ein Schock Krähen ein entsetzliches Geschrei und fliegt über den Kopf des Pferdes; das scheut, bäumt sich, spitzt die Ohren und schwitzt grosse Tropfen. Es kaut am Zaum, und der Fuhrmann muss abspringen, um das Tier zu beruhigen.
Ich frage, warum das Pferd so unvernünftig bange würde, aber die Antwort steht in dem Blick zu lesen, den der Fuhrmann auf die Krähen richtet, die gleich einer Wolke uns noch einige Minuten folgen. Es ist eine ganz natürliche Begebenheit, aber von schlimmer Art und nach dem Volksglauben ein schlechter Vorbote!
Nach zwei Stunden Wegs ohne Nutzen für meine Studien, weil ein Nebel die Aussicht über den Sund verschliesst, fahren wir in das Dorf Mölle hinein. Entschlossen, die Bergspitze von Kullen zu Fuss zu besteigen, verabschiede ich den Kutscher und lasse ihn im Wirtshaus meine Rückkehr abwarten.
Als ich die Bergwanderung beendigt habe, komme ich in das Dorf zurück und lenke meine Schritte nach der Gastwirtschaft. Aber mir fehlt die Ortskenntnis und ich suchen einen Einwohner, um mich hin zu fragen. Nicht ein lebendes Wesen ist zu sehen, weder auf den Strassen noch anderswo. Ich klopfe an die Türen; keine Antwort. Am Vormittag um elf Uhr in einem Dorf von zweihundert Einwohnern nicht ein Mann, nicht eine Frau, nicht ein Kind, nicht einmal ein Hund! Und der Kutscher, das Pferd, der Wagen wie weggeblasen. Ich irre in den Gassen umher und finde nach einer halben Stunde die Gastwirtschaft. Sicher, meinen Fuhrmann dort zu haben, bestelle ich Frühstück; nachdem ich gegessen habe, bitte ich es dem Kutscher anzusagen.
—Welchem Kutscher?
—Meinem!
—Ich habe keinen gesehen!
—Haben Sie nicht einen Wagen bemerkt, von einem rotbraunen Pferde gezogen und von einem dunklen Kutscher gefahren?
—Nein, das habe ich nicht.
—Und ich habe ihn doch hierher ins Wirtshaus bestellt.
—Dann sitzt er wohl im Ausspann nebenan.
Das Mädchen bezeichnet den Weg, und ich setze mich in Gang.
Doch, ich bin nicht imstande, den Krug zu finden, und ich gehe irre, so dass ich nicht wieder zurück nach meinem Wirtshaus finde. Und kein Mensch zu sehen! Da werde ich bange! Bange am hellen Tage! Dieses Dorf ist verhext!
Ich vermag mich nicht mehr zu rühren, sondern stehe, wo ich stehe, wie festgekettet. Was nützt das Suchen, da der Teufel einen Finger im Spiel hat?
Nach sieben Sorgen und acht Betrübnissen kommt endlich der Kutscher, und ich schäme mich, ihm meine Verdriesslichkeiten zu offenbaren oder ihm Erklärungen abzufordern, die nichts erklären.
Wir sind nach Högandäs zurückgefahren. Vor der Hoteltreppe fällt das Pferd plötzlich zur Erde, als habe jemand vor der Tür gestanden und es erschreckt.
Jetzt lasse ich mich über den Weg nach den Steinkohlengruben unterrichten; dieses Mal gewiss, mein Ziel nicht zu verfehlen, gehe ich zu Fuss die fünf Minuten Wegs, die man mir angewiesen hat. Ich gehe und gehe zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, geradeaus aufs ebene Land, ohne eine Spur von Gebäuden oder Schornsteinen zu erblicken, die auf eine Grube hinweisen können. Die angebaute Ebene streckt sich in Unendlichkeit aus; nicht eine Hütte, niemand zum Fragen.
Das ist der Böse, der mir diesen boshaften Schabernack spielt! Und ich bleibe stehen wie festgeleimt, erblindet, ohne einen Schritt vorwärts oder rückwärts machen zu können.
Schliesslich kehre ich ins Dorf zurück, nehme ein Zimmer und ruhe mich auf einem Sofa aus.
Nach einer Viertelstunde werde ich aus meinen traurigen Gedanken durch ein Unwesen geweckt. Diesmal klopft man mit einem Hammer Nägel ein. Kleingläubig, was die Klopfgeister anbetrifft, schreibe ich die Erscheinung auf Rechnung böswilliger Leute oder eines mehr als gewöhnlich grossen Pechs. Ich klingele, bezahle was ich schuldig bin und begebe mich auf den Bahnhof.
Drei Stunden warten! Das ist viel, wenn man ungeduldig ist, aber es gibt keine Wahl. Als ich zwei Stunden auf einer Bank hingebracht habe, geht eine gutgekleidete und hübsche Frauensperson an mir vorbei, um in den Wartesaal erster Klasse einzutreten. In der Art dieser Dame sich zu bewegen und in ihrem ganzen Wesen lag etwas, das bei mir unbestimmte Erinnerungen weckte; neugierig, wie sie von vorn aussieht, bewache ich die Tür, um mir die Dame anzusehen, wenn sie wieder vorbeikommt. Nachdem ich lange gewartet habe, gehe ich in den Wartesaal hinein.
Niemand ist drinnen zu sehen; und keine andere Tür ist da; kein Toilettenzimmer. Und Doppelfenster setzen der Möglichkeit, auf andere Weise zu entkommen, ihr Halt entgegen.
Bin ich geblendet? Gibt es Menschen, die mit der Fähigkeit ausgerüstet sind, einem das Gesicht zu verkehren? Kann man sich unsichtbar machen? Das sind ungelöste Fragen, die mich zur Verzweiflung bringen. Bin ich verrückt? Nein, die Ärzte sagen, es sei nicht der Fall. Da kann man an Wunder glauben. Ich bin ein Verdammter, ich befinde mich in der Hölle, wenn man Swedenborg glauben darf, und die Mächte strafen mich, rastlos, unbarmherzig. Die Geister, die ich heraufbeschwöre, haben keine Lust, wieder in die Flasche zu kriechen, von der ich das Insiegel genommen habe.
Der Abend desselben Tages, in einem guten Hotel erster Klasse der Stadt Malmö. Ich gehe um zehn Uhr zu Bett. Um halb elf fängt man an im Korridor Holz zu spleissen, ohne dass jemand seine Unzufriedenheit darüber äussert; und zwar in einem kontinentalen Hotel voller Reisender. Danach wird getanzt! Später dreht man an einer Maschine mit Räderwerk ... Ich stehe auf, bezahle die Rechnung und beschliesse meine Reise die ganze Nacht fortzusetzen.
Mutterseelenallein draussen in der kalten Januarnacht, gehe ich und schleppe meine Reisetasche, ermüdet und erschöpft, unter einem pechschwarzen Himmel. Einen Augenblick halte ich es für das Beste, mich in den Schnee zu legen und zu sterben. Aber im nächsten Moment sammle ich meine Kräfte und biege in eine öde Hinterstrasse ein, wo ich ein anspruchsloses Hotel antreffe. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass niemand mich auskundschaftet, schleiche ich durch das Tor hinein.
Ohne mich auszukleiden, strecke ich mich auf dem Bett aus, fest entschlossen, mich lieber töten als zum Aufstehen bringen zu lassen.
Totenstille herrscht im Hause und der liebliche Schlaf nähert sich. Da höre ich plötzlich, wie eine unsichtbare Tatze an der Papierbekleidung der Decke gerade über meinem Kopfe kratzt. Es kann keine Maus sein, da das lose gespannte Papier sich nicht bewegt; und übrigens ist es eine ziemlich grosse Tatze, wie von einem Hasen, einem Hund!
Bis zum Tagesgrauen erwarte ich, in Schweiss gebadet, die Klauen in meiner Haut zu fühlen, aber vergebens, denn selbst die Angst ist quälender als der Tod.
Warum ich nicht krank werde nach solchen Peinigungen?
Weil ich das Leiden bis auf die Hefe leeren muss, um das Gleichgewicht zwischen den begangenen Missetaten und der auferlegten Strafe wieder herzustellen. Und es ist wirklich merkwürdig, wie ich die Qualen auszuhalten vermag; ich verschlinge sie mit grimmiger Freude, um endlich ein Ende mit ihnen zu machen.
Als Neujahr und die unzähligen Feiertage überstanden sind, finde ich mich eines Tages allein. Es ist, als ob ein Orkan dahergezogen wäre: alle sind zerstreut, fortgeblasen, schiffbrüchig. Mein Freund der Arzt ist als krank ins Lazarett aufgenommen. Tatsächlich hat er, von Trunksucht geschwächt, von Geldmangel bedrängt, von Schlaflosigkeit aufgerieben, schliesslich "Neurasthenie" bekommen. Das ist herzzerreissend; und statt ins Wirtshaus zu gehen, lenke ich nun meine Schritte ins Lazarett, um für eine Stunde Zwiegespräch und Gesellschaft zu suchen.
Im Café bin ich der einzige, der ein Glas trinkt, da drei von den Kameraden das Gelübde der Nüchternheit abgelegt haben. Der Dichter ist fortgereist. Der junge Ästhetiker, der Sohn des Professors der Ethik, ist ins Ausland geschickt, um von dem schlechten Umgang mit dem Verführer der Jugend (das bin ich!) loszukommen.
Ein Doktor der Philosophie hat sich das Bein gebrochen und liegt zu Bett. Gleichzeitig wird der junge Chemiker, der Bannerträger der Fortschrittsmänner, krank und muss auf Neurasthenie behandelt werden. Es ist Schlaflosigkeit, ein Anfall von Alpdrücken und Schwindel gewesen.
Alle diesen traurigen Umstände und andere haspeln sich im Laufe von anderthalb Monaten ab. Und was meine Lage unerträglich macht, ist, dass man mehr oder weniger direkt die Schuld auf mich schiebt. Ich bin der Böse selbst, ich habe den bösen Blick! Es ist nur gut, dass man über die Macht des bösen Willens und die heimlichen Finten des Okkultismus nichts weiss und den Gedanken daran verwirft, denn sonst würde man mich totschlagen.
Eine flache und trübe Stille hat sich über das geistige Leben an der Universität gebreitet. Nicht eine neue zeugungskräftige Idee, keine Gärung und Bewegung! Die Naturwissenschaften haben die transformistische Methode, die Fortschritt versprach, abgenutzt, und sie drohen nun an allgemeiner Schwäche zu sterben. Man diskutiert nicht mehr, weil man einig ist, dass die reformatorischen Bestrebungen eitel sind. Man hat so viele Illusionen stürzen sehen, und die grosse Befreiungsaktion ist jetzt in eine allgemeine Auflösung oder vielmehr Zersetzung übergegangen.
Die Jugend wartet auf etwas Neues, ohne sich noch klar gemacht zu haben, was sie ersehnt. Neues um jeden Preis, ausgenommen Abbitte und Rückzug. Vorwärts zu dem Unbekannten, was es auch sei, wenn es nur nicht etwas Altes ist. Man will freilich eine Versöhnung mit den Göttern, aber es sollen umgeschaffene sein, besser entwickelte Götter, die auf gleicher Höhe mit der Gegenwart stehen, Götter von weitherziger Auffassung, frei von kleinlichen Vorurteilen, berauscht von Lebensglück. Leider aber sind die Unsichtbaren krittlig geworden, neidisch auf die Freiheiten, welche die Sterblichen sich erworben haben. Der Wein ist vergiftet worden und verursacht wilde Verrücktheit, statt liebliche Visionen hervorzurufen. Die durch Gesellschaftsbande geregelte Liebe erweist sich als ein Zweikampf auf Leben und Tod; die freie Liebe führt im Schlepptau unnennbare und endlose Krankheiten, bringt Elend über die Heimstätten, stösst ihre Opfer schimpfbeladen vom Verkehr aus.
Die Epoche eines Experimentiergeistes ist abgelaufen und die Experimente haben lauter negative Resultate ergeben. Um so besser für die Menschen der Zukunft: die werden Nutzen ziehen aus den heilsamen Lehren, die sie aus der Niederlage der Vorhut holen können, welche in der Wüste irre gegangen und in einem hoffnungslosen Kampf gegen die Übermacht gefallen ist.
Einsam, wie ich bin, schiffbrüchig, ein Wrack, das auf eine Schäre im Ozean geworfen worden ist, habe ich Augenblicke, in denen ich von Schwindel vor dem blauenden Nichts ergriffen werde. Ist es der Himmel, der einen Widerschein von dem ausgebreiteten Tuche des Meeres trägt, oder das Meer, das den Himmel spiegelt?
Ich habe die Menschen geflohen, und die Menschen fliehen mich. In meiner ersehnten Einsamkeit werde ich von einer ganzen Schar Dämonen heimgesucht, und wenn alles zusammen kommt, fange ich doch an den geringsten unter den Sterblichen den interessantesten Schemen vorzuziehen. Aber wenn ich einen Menschen suche, während der langen Abende, durch die ganze Stadt, treffe ich keinen, weder bei sich zu Hause noch in den Cafés.
Da, mitten in meiner schicksalbestimmten, unvermeidlichen Armut sendet die Vorsehung einen Mann auf meinen Weg, ja einen Mann, dessen Vater ich früher missachtet hatte, sowohl wegen seiner mangelhaften Erziehung wie wegen seiner radikalen Ansichten, die ihn von den besseren Gesellschaftskreisen ausschlossen .... Jetzt kam die Vergeltung: ich hatte den Vater geschmäht, trotzdem er ein reicher Mann war, und ich werde geradezu gezwungen, mit dem Sohn fürlieb zu nehmen. Hier muss hinzugefügt werden, dass der junge Mann in der Stadt ebenso schlecht angeschrieben ist, wie ich, ebenso isoliert, weil er die Rolle eines Verführers der Jugend spielt. Und das Unglück bringt uns dazu, eine wahrhaftige Freundschaft zu knüpfen.
Er ladet mich ein, bei sich zu wohnen, er streckt mir Existenzmittel vor, er wacht über mich wie über einen Kranken; und in der Tat hat die Verfolgung mich verleitet, in einem Hotel Skandal zu erregen: ich wollte in ein Zimmer neben dem meinen eindringen, überzeugt, dort Feinde zu finden, die mich beunruhigten. Wenn ich noch einen Tag in diesem Hotel gewohnt hätte, würde die Polizei sich eingemischt haben, und eine Zukunft im Irrenhause wäre mir sicher gewesen.
Zur selben Zeit bringt das Auftreten eines andern jungen Mannes mich zu der Überzeugung, dass die Götter nicht unversöhnlichen Groll gegen mich nähren.
Ein richtiges Wunderkind, geboren mit frühreifer Einsicht in alle Zweige des menschlichen Wissens, wohl erzogen von einem gelehrten und sittlich hoch stehenden Vater, wurde der junge Mann vor zwei Jahren von einer ganz geheimnisvollen Krankheit ergriffen, deren Einzelheiten er mir zu dem Zweck offenbarte, meine Meinung zu erfahren oder vielmehr die Bestätigung seines eigenen Argwohns zu hören.
Genug, der junge Mann, der ein reines Jünglingsleben gelebt und die strengsten Grundsätze eingesogen hat, tritt unter günstigen Verhältnissen hinaus ins Leben, von seinen Altersgenossen beschützt und beliebt wohin er kommt. Aber eines Tages begeht er eine Handlung, die ihm sein Gewissen bestimmt verbietet. Nichts ist seitdem imstande ihn zu beruhigen. Nach langer Zeit geistiger Tortur unterliegt auch sein Körper. Gleichzeitig erreicht seine Seelenkrise eine erschreckende Höhe. Jeden Tag konstatiert er einen neuen Fortschritt eines eingebildeten Übels, und schliesslich macht er die Qual der Agonie durch. Darauf glaubt er tot zu sein; er hört in allen Wohnungen des Hauses Särge zunageln. Wenn er die Zeitung liest—sein Verstand ist nämlich dauernd klar—erwartet er die Anzeige seines eigenen Begräbnisses zu sehen. Gleichzeitig erleidet sein Körper eine Scheinauflösung mit Leichengeruch, der seine Umgebung von seinem Bett schreckt und ihn selbst zum Schaudern bringt. Eine Veränderung in der Persönlichkeit selbst scheint vor sich gegangen zu sein, da der junge Mann, der auf seine Weise religiös gesinnt war, nun von Zweifeln angefochten wird.
Eine Wahrnehmung, die er im Gedächtnis behielt, war, dass seine Umgebung stets wachsbleiche oder blaue Gesichter hatte. Und wenn er aufgestanden war, um die Leute auf der Strasse zu betrachten, schienen ihm alle Passanten blau im Gesicht zu sein. Was ihm ferner Entsetzen einflösste, war, dass sich unten auf der Strasse eine unendliche Reihe von Bettlern, zerlumpten Kerlen, gebrechlichen beinlosen Krüppeln auf Krücken an seinem Fenster vorbei schleppten, als seien sie zusammengerufen worden, um Revue zu passieren. Während der ganzen Zeit behielt der Kranke den Eindruck, dass die Wirklichkeit von dem, was er sah, über jeden Zweifel erhaben war; daneben aber wurde er gezwungen, eine symbolische Bedeutung hineinzulegen. Jedes Buch, das er öffnete, enthielt direkte Mahnungen an ihn.
Nachdem er seine Erzählung beendet hatte, frage er, was ich von der Sache denke.
—Etwas Halbwirkliches, eine Reihe Visionen, von jemand heraufbeschworen, zu bewusstem Zweck. Eine lebende Scharade, aus der die Nutzanwendung zu ziehen Ihnen zukommt. Nun, wie wurden Sie geheilt?
—Es ist recht lächerlich, aber ich will es Ihnen gestehen. Früher hatte ich immer in Opposition zu meinen Eltern gestanden, die mich mit unermüdlicher Fürsorge für Leib und Seele umgaben; jetzt aber beuge ich schliesslich den Nacken unter das Joch, das mir lieblich und wohltuend geworden, da es von ungeheuchelter Liebe abgemessen war. So wurde ich geheilt.
—Und haben Sie nie einen Rückfall gehabt?
—Doch! Ein einziges Mal! Aber von der gelindesten Art. Eine Zeitlang unbedeutende Nervosität und Schlaflosigkeit, die vor den einfachsten medizinischen Verhaltensmassregeln wich. Aber dieses Mal hatte ich mir auch nichts vorzuwerfen.
—Und was hat Ihnen der Arzt verordnet?
-Ordentlich zu leben, nachts zu schlafen und Ausschweifungen zu vermeiden.
—Das ist ja ganz der Weg des Kreuzes!
Nun bin ich also nicht mehr einsam und verlassen; der junge Gelehrte scheint mir als ein Bote von den Mächten gekommen zu sein, ich kann ihm alles anvertrauen; und indem wir vergleichen, was wir erlebt haben, stützen wir einander gegenseitig auf dem schmalen Pfad im Tal der Schmerzen.
Auch er getroffen in jungen Jahren!
Alle Menschen gewaltsam aus dem Schlaf gerissen!
Es ist also eine allgemeine Erweckung, und was bezweckt sie?
Swedenborg, mein Wegweiser in der Finsternis, hat sich nur als Bestrafer offenbart. Die "Arcana Coelestia" sprechen nur von der Hölle und von Strafen, die vollzogen werden von bösen Geistern, das heisst Teufeln. Nicht ein Wort des Trostes, keine Gnade. Und doch ward ja der Teufel in meiner Jugend abgeschafft, alle lachten über ihn; und durch die Ironie des Zufalls bereitet man sich gerade jetzt dazu, das Jubiläum des Philosophen Boström zu begehen, der die Hölle niederriss und den Teufel vernichtete. Zu diesem Denker sah man in meiner Jugend wie zu einem Reformator auf, und jetzt rüstet sich der Teufel zu einer Renaissance für sich. Er ist in die Erzeugnisse der sogenannten satanischen Literatur geschlüpft, in die schönen Künste an die Seite von Christus, ja sogar in die Industrie. Letzte Weihnacht habe ich bemerkt, dass die Geschenke meist kleine Teufel und Gespenster vorstellten, sowohl die Spielsachen der Kinder wie komische Gegenstände, welche die älteren für einander kaufen, Zuckerwerk, Kontorkalender. Gibt es ihn noch, oder ist er nur ein halb wirkliches Schreckbild, das von den Unsichtbaren projiziert wird, um einen starken Eindruck auf uns zu machen? Uns zum Kreuze hinzustossen? Eine Antwort darauf zu finden, war mir noch nicht gelungen, als man mich an einem trüben Abend zu einem Bildhauer führt, der Freidenker und Atheist ist, wie die theosophische Gesellschaft, deren Anhänger er ist. Bei ihm kann man eine Privatsammlung von Gegenständen in Ton sehen, die für die Stockholmer Ausstellung bestimmt sind.
Mit abstossendem Realismus und Cynismus ist da der Teufel in verschiedenen Situationen dargestellt, immer in Verbindung mit einem Priester, dem vor ihm bange ist.
Das ist ein Lachen! Aber ich, ich kann nicht lachen und denke: warte, wir werden sehen!
Nach Verlauf von vier Monaten begegne ich dem Bildhauer auf der Strasse.
Er sieht betrübt aus, als sei ihm etwas Unangenehmes widerfahren.
—Können Sie sich solch ein verdammtes Pech denken: man hat drei meiner besten Figuren zerschlagen, als man sie auf der Ausstellung auspackte.
Das ist etwas, was mich ausserordentlich interessiert, und in demselben Augenblick, in dem ich das Unglück beklage, frage ich mit einer fast schmählichen Neugier:
—Und welche von Ihren Statuetten waren es?
—Die drei mit dem Teufel, so viel ich weiss. Ich lache nicht, aber antworte lächelnd:
—Da sehen Sie, Lucifer kann Karikaturen nicht leiden!
Einige Wochen später hat der Bildhauer ein neues Schreiben erhalten, in dem man ihm mitteilt, dass die anderen Figuren von ihrem Sockel gefallen und in Stücke zerschlagen sind, ohne dass die Verwaltung erklären kann, wie es zugegangen ist. Mithin hat der arme Künstler ein Jahr verloren, die Herstellungskosten nicht gerechnet, und er sieht sich aus dem Verzeichnis der Aussteller gestrichen.
In seiner Untröstlichkeit tröstet er sich mit dem Zufall, der nichts besagt; zugleich rettet der jedoch den menschlichen Stolz, welcher vor dem blinden Ungefähr die Knie beugt. Man senkt den Kopf vor dem Stein, der von der Schleuder geflogen kommt: aber der Schleuderer selbst? Einen solchen hat man nicht gesehen.
Inzwischen bekomme ich nach und nach Swedenborgs Arbeiten in die Hände, eine nach der anderen, und immer in einem günstigen Augenblick. So treffe ich in seinen "Träumen" alle Symptome der "Krankheit" an, die mich heimsucht, die nächtlichen Anfälle, die Atemnot. Und die Tatsachen, die in diesen seinen Aufzeichnungen erzählt werden, gehören in die Zeit vor den Offenbarungen. Das war für Swedenborg die Periode der "Verwüstung", als er dem Satan überliefert wurde, damit das Fleisch getötet werde.
Das gibt mir Klarheit über die wohlwollenden Absichten des Unsichtbaren, ohne mir jedoch Trost bringen zu können. Erst nachdem ich "Himmel und Hölle" gelesen habe, fange ich an mich erbaut zu fühlen. Es gibt einen Zweck in diesen unerklärlichen Leiden: die Verbesserung und Entwicklung meines Ichs zu etwas Grösserem, Nietzsches erträumtem Ideal, wiewohl anders aufgefasst.
Den Teufel gibt es nicht als ein selbständiges Wesen, das Gott gleich und sein Widersacher ist. Der Unsichtbare, der uns plagt, ist der Zuchtgeist. Viel ist schon gewonnen mit der Einsicht, dass das Böse um des Bösen willen nicht existiert; und von neuem wird die Hoffnung geboren, dass man durch Reue und gewissenhafte Überwachung der eigenen Gedanken und Handlungen zum Frieden des Herzens kommen kann.
Und da ich beobachte, was sich im täglichen Leben zuträgt, wird eine neue Erziehung wirksam, und ich lerne nach und nach die konventionellen Zeichen deuten, die von den Unsichtbaren benutzt werden. Doch sind die Schwierigkeiten gross infolge meines Alters und der eingewurzelten schlechten Gewohnheiten; auch bin ich durch eine gewisse Nachgiebigkeit zu sehr geneigt, mich meiner Umgebung anzupassen. Es hält so schwer, zuerst von einem fröhlichen Gelage aufzubrechen; ich bin ein "schlechter Kamerad", wenn ich meinen Willen Freunden, denen ich verpflichtet bin, aufzwingen will. Aber man muss auf dieser Welt alles lernen.
So hatte ich mir angewöhnt, nach dem Mittagessen, das ich um zwei einnehme, beim Kaffee sitzen zu bleiben; und eines Tages Anfang Februar sitze ich da, mit dem Rücken gegen die Aussenwand. Man hat begonnen, die Frage zu erörtern: sollen wir uns eine halbe Flasche Punsch leisten?
Im selben Augenblick kommt eine unmittelbare Antwort in Form eines Lärms, der hinter meinem Rücken so stark ausbricht, dass die Kaffeetassen auf dem Tablett hüpfen.
Man kann sich denken, was ich für ein Gesicht machte! Einer von den Freunden steht auf, um nachzusehen, was los ist. Es ist etwas ganz Einfaches: ein Arbeiter bessert den Mauerputz draussen aus.
Wir setzen uns in ein besonderes Zimmer. Sofort bricht ein neues Poltern über meinem Kopfe aus, oben auf dem Boden. Ich erhebe mich und fliehe vom Schlachtfeld. Von dieser Stunde bleibe ich niemals nach dem Mittagessen beim Kaffee sitzen, ausgenommen an Feiertagen.
Am Abend dagegen kann ich ein Glas mit den Freunden trinken, da es sich nicht so sehr ums Trinken handelt, als um Gedanken austauschen mit kenntnisreichen Leuten, die alle Zweige der Wissenschaft vertreten. Aber manchmal geschieht es, dass die reine Trunksucht überhand nimmt und eine zügellose Fröhlichkeit sowie Vorschläge in cynischer Richtung zur Folge hat; dann bricht die schlimmere Natur in einem durch, die brutalen Instinkte nehmen sich freien Spielraum. Es ist so bequem, eine Weile Tier zu sein, und übrigens ist das Leben nicht immer lustig ... und so weiter im selben Sinne.
Eines Tages, nachdem ich einige Zeit an stürmischen Trinkgelagen teilgenommen habe, bin ich auf dem Wege zu meinem Mittagstisch. Ich gehe an einem Beerdigungsinstitut vorbei, wo ein Sarg ausgestellt ist. Die Strasse ist mit Fichtenzweigen bestreut und die grosse Glocke des Doms läutet Totengeläut. Als ich ins Restaurant komme, finde ich meinen Tischkameraden in Betrübnis: er ist gerade vom Krankenhaus gekommen, wo er von einem Sterbenden Abschied genommen hat.
Als ich nach dem Mittagessen durch Hinterstrassen, in denen ich noch nicht gewesen bin, nach Hause gehe, begegne ich zwei Leichenzügen.
Wie alles heute nach Tod riecht! Und der Kirchturm fängt wieder an mit Totengeläut.
Als ich am Abend durch den Torweg in die Kneipe zu gehen beabsichtige, sehe ich einen alten Mann an der Mauer stehen, der sichtlich betrunken und krank ist. Um nicht mit ihm zusammenzustossen, mache ich einen Umweg und begebe mich in den Speisesaal. Mein Katzenjammer von gestern und die Begräbniseindrücke im Laufe des Tages flössen mir eine heimliche Furcht vor Spirituosen ein, so dass ich Milch zum Abendessen bestelle.
Während der Mahlzeit erschallt im Hause ein Lärm, der mit ängstlichen Rufen gemischt ist, und nach einer kleinen Weile trägt man den Alten vom Torweg in Prozession herein, der Sohn des Verschiedenen an der Spitze. Der Vater ist gestorben. Ein gib acht für den Trinker!
In der folgenden Nacht bekam ich einen schrecklichen Anfall von Alpdrücken. Jemand klammerte sich fest an meinem Rücken an und schüttelte mich an den Schultern.
Dies genügte mir, um mich im nächtlichen Trinken vorsichtig zu machen, ohne dass ich jedoch ganz davon abstand.
Ende Januar bin ich in eine Privatwohnung umgezogen und sehe immer meinem Geschick ins Auge, ohne meine Zuflucht zu der Zerstreuung nehmen zu können, die in der Gegenwart eines Freundes liegt. Es ist ein Zweikampf, und zu entschlüpfen ist nicht möglich! Wenn ich abends nach Haus komme, erfahre ich sofort, wie es um mein Gewissen steht. Eine erstickende Atmosphäre auch wenn die Fenster aufgemacht werden, verkündet eine schwere Nacht. Es gibt Abende, da ich überzeugt bin, dass ich jemand in meinem Zimmer befindet. Dann bekomme ich infolge der furchtbaren Angst Fieber mit kaltem Schweiss und wenn ich mein Gewissen untersuche, finde ich augenblicklich, wo der Schuh drückt. Aber ich fliehe nicht mehr, weil es nichts nützt.
Unter den Lektionen, welche die Zuchtgeister mir geben, wage ich eine nicht zu vergessen, nämlich das Verbot, in verborgenen Dingen zu forschen; denn diese sollen verborgen bleiben.
So hatte ich auf meinen Ausflügen in Schonen eine Art an verschiedenen Stellen befindlicher Steine von eigentümlicher und sehr charakteristischer Form bemerkt. Sie gaben nämlich entweder Tiertypen wieder, besonders Vögel, oder Hüte, Helme. Es fanden sich auch andere, mit Rillen, welche die Widmannstättenschen Figuren auf Meteorsteinen nachahmten.
Ohne mir ganz klar darüber zu sein, woher deren Ursprung herzuleiten wäre, erhielt ich den Eindruck, dass es nicht "ein Spiel der Natur" sei. Ihre Gestalt gab an, dass sie Kunsterzeugnisse seien, hervorgegangen und bearbeitet von Menschenhand.
Zwei Jahre lang setzte ich die Jagd nach ihnen fort; nachdem ich einen Freund für die Sache interessiert habe, sage ich ihm einen Fundort, damit er einen Photographen dorthin schickt.
Die Expedition missglückte, und ein Jahr später entdeckte ich, dass die Adresse unrichtig war.
Jedesmal, wenn ich seitdem eigensinnig diese Untersuchung fortsetzen will, stellen sich Hindernisse ein, die zu merkwürdig sind, als dass ich sie dem Zufall auf Rechnung setzen könnte.
So, um nur ein Beispiel anzuführen, habe ich eines Morgens beschlossen, mit einem Altertumsforscher einen Ausflug zu machen, um die Frage mit einem einzigen lange vorbereiteten Schlag zu entscheiden. Da passiert es mir, dass auf der Strasse vor meiner Tür eine Zwecke in meinem Stiefel losgeht und mich in den Fuss sticht. Anfangs kümmere ich mich nicht darum, als ich aber an die Wohnung des Begleiters gekommen bin, wird der Schmerz so heftig, dass ich stehen bleiben muss. Unmöglich, weiter zu gehen; kein Ausweg, umzukehren! Wütend ziehe ich in meinem Verdruss den Stiefel aus und mache die Zwecke mit einem Messer glatt. Eine dunkle Erinnerung an meine Swedenborg-Lektüre ruft mir in einem Augenblick folgende Stelle zurück: "Wenn die Zuchtgeister eine schlechte Handlung sehen oder die Absicht, etwas Unrechtes zu tun, so strafen sie durch einen Schmerz im Fuss, in der Hand oder in der Gegend des Zwerchfells." Aber aufgestachelt wie ich war von Wissbegierde, die ich für zulässig und lobenswert hielt, setzte ich den unterbrochenen Weg fort und schloss mich alsbald meinem Kameraden an.
Die Exkursion soll in einer Grotte, die im Park liegt, anfangen. Aber der Eingang ist durch Schmutzhafen scheusslichster Art versperrt; auf eine so herausfordernde oder vielmehr ironische Weise sind sie dahingelegt, dass ich lächeln muss.
Die andere Fundstelle, die ich gut kenne, ist in einem Garten, wo Steinblöcke um einen Baum gruppiert sind, an die man leicht heran gehen kann. Aber diesen Morgen hat der Gärtner den Baum und die Altertümer durch einen Ring von Blumentöpfen so abgesperrt, dass ich meinem gelehrten Begleiter nichts zeigen kann. Ein schönes Fiasko!
Doch durch die Hindernisse gereizt, schleppe ich meinen Mann, der anfängt, sich zweifelnd zu stellen, quer durch die Stadt nach einem Hof, wo ein ganzes Museum zusammengebracht ist. Dort wird wohl der Ausschlag gegeben werden, und ich erwarte ein Resultat, das geeignet ist, verblüfft zu machen. Wir werden sogleich von einem der schlimmsten Köter begrüsst; als wir ihn anschnauzen, werden die Einwohner des Hauses auf den Hof gelockt; wir müssen unser Anliegen hervorbrüllen, um den bellenden Hofhund überschreien zu können. Es ist ein geschlossenes Gitter rings herum angebracht, und man kann den Schlüssel nicht finden!
—Gibt es noch mehr Stellen? Fragt mich der Altertumsforscher, der mich bereits verachtet.
—Ja, die gibt es, aber ausserhalb der Stadt!
Ich will den Leser nicht mit Lappereien ermüden; genug, nach mehr oder minder ärgerlichen Irrfahrten kommen wir endlich zu einem solchen Haufen Steine. Aber welche Hexerei: ich konnte dem gelehrten Manne nichts zeigen, weil er nichts sah; auch ich selbst, wie mit Verblendung geschlagen, vermochte nicht mehr in ihrer Gestalt etwas wie Abbildung organischer Wesen zu unterscheiden.
Am folgenden Tage dagegen, als ich mich wieder an die Stelle begeben hatte, dieses Mal allein, sah ich eine ganze Menagerie.
Die Erzählung dieses Abenteuers mag geschlossen werden, indem ich auf die Beschaffenheit dieser Überreste einer präadamitischen Skulptur hinweise. Die Okkultisten leiten nämlich deren Ursprung vom Menschengeschlecht der Atlaszeiten ab und stellen sie auf dieselbe Linie wie die Kolossalsteinbilder der Osterinseln und der Wüste Gobi. Olaus Magnus erwähnt sie auch und hat sie in grosser Menge an der Küste von Broviken in Ostergötland gefunden. Swedenborg legt ihnen eine symbolische Bedeutung unter und hält sie für Kunsterzeugnisse des Geschlechts des silbernen Zeitalters. (Vergleiche "Delitiae sapientiae".)
Nach dem zu urteilen, was sich in dem begrenzten Kreise, in dem ich lebe, zeigt, erlauben die Mächte mir nicht, meine Bekanntschaften zu wählen; noch weniger, jemand zu verschmähen, wer es auch sein mag. Wie alle anderen werde ich von Sympathien und Vorliebe für gewisse Arten von Naturen beherrscht. Gegenwärtig suche ich ernst angelegte Menschen, denen ich meine Gedanken mitteilen kann, ohne mich unpassendem und verletzendem Scherz auszusetzen. Die Vorsehung hat mir einen Freund geschickt, den ich wegen seiner reinen Atmosphäre hochachte. Gleich einem verzogenen Kind fange ich an die andern, ungekünstelte Seelen ohne Schwung, die zuweilen Vergnügen an Grobkörnigkeiten finden, zu missachten.
Aber im selben Augenblick, da ich mich zurückziehe, ist mein Freund aus der Stadt gereist; die andern kann ich nirgends treffen, und in meiner Isolierung werde ich genötigt, mich so zu demütigen, dass ich die Gesellschaft von unbedeutenden Menschen erbettle, mit denen mein gewöhnlicher Freundeskreis nicht verkehrt. Doch nachdem ich einige Erfahrungen in dieser Richtung gemacht habe, erneuert sich schliesslich meine alte Entdeckung, dass der Unterschied zwischen Mensch und Mensch nicht so gross ist, wie man sich vorgestellt hat; tatsächlich habe ich unter dem niederen Volk wirkliche Gentlemen getroffen, und wie manchen Heiligen und Helden habe ich nicht ahnend in der Schar der Verachteten unterschieden?
Andererseits behauptet man ja: "Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten". Wo gibt es denn die schlechte Gesellschaft? Und wo wäre die gute?
Angenommen, wie ich getan habe, eine Mission sei mir auferlegt worden, als ich mich in einer fremden Stadt niederliess, ohne selbst zu wissen warum, was habe ich hier zu tun? Gute Sitten zu predigen? Mein Gewissen antwortet mir: durch dein Vorbild. Aber nun nimmt mich niemand zum Vorbild! Und was würde es nützen, suchte ich junge Männer, die nicht so viel gesündigt haben wie ich, zu moralisieren?
Übrigens scheint das Zeitalter der Propheten zu Ende zu sein; die Mächte wollen nichts mehr von Priestern wissen, sonder haben selber die Regierung über die Seelen wieder aufgenommen; man braucht nicht lange zu suchen, um Beispiele dafür zu finden.
Einer unserer Dichter ist neulich vor Gericht beschieden worden infolge einer Sammlung Gedichte, in der man unsittliche Stellen gefunden hat. Von der Jury freigesprochen, findet er doch keine Ruhe.
In einem der Gedichte hat er den Ewigen zum Ringkampf herausgefordert, auch wenn der Streit in der Hölle abgemacht werden müsse. Es sieht aus, als sei die Herausforderung angenommen worden und der junge Mann wie ein gebrochenes Rohr gezwungen, um Gnade zu bitten.
Eines Abends, als er in der fröhlichen Gesellschaft der Freunde sitzt, geschieht es, dass eine den exakten Wissenschaften unbekannte Kraft ihm die Zigarre entreisst, so dass sie zu Boden fällt.
Ein wenig überrascht, nimmt er die Zigarre wieder auf und tut so, als begreife er nichts. Aber derselbe Streich wiederholte sich drei Male hintereinander. Da wird der Kleingläubige bleich wie der Tod; ohne ein Wort zu sagen, räumt er das Feld, während seine Freunde verblüfft dasitzen.
Bei der Heimkunft wurde der Verwegene von einer neuen Überraschung erwartet. Ohne sichtbare Ursache begannen seine beiden Hände auf Art des Masseurs den ganzen Körper, der durch zu fleissiges Trinken wirklich unnötig beleibt worden war, zu reiben oder richtiger zu kneten. Diese unfreiwillige Massage wurde ohne Unterbrechung ganze vierzehn Tage fortgesetzt.
Doch nach Verlauf dieser Zeit hält sich der Ringer für vollständig erstarkt, um wieder auf der Arena aufzutreten. Er mietet ein Hotel und ladet seine Freunde zu einem Balthasarfest ein, das drei ganze Tage dauern soll. Er will nämlich der Welt zeigen, wie der Übermensch (Nietzsche!) die Dämonen des Weines bezwingen kann. Man hat den ganzen ersten Tag getrunken, und die Nacht fällt herab, und mit ihr fällt der Kämpe. Aber ehe er es verloren gibt, nehmen die Dämonen des Weins diese überlegene Seele in Besitz und flössen ihm eine solch unbändige Tollheit ein, dass er seine Gäste durch Türen und Fenster hinauswirft. So endigt das Fest. Worauf der Wirt nach einer Pflegeanstalt gebracht wird!
So hat man mir das Abenteuer erzählt, und es tut mir leid, es wiedergegeben zu haben ohne die Tränen, die man dem Unglück schuldig ist.
Doch der Angeklagte hat einen Verteidiger für seine Sache gewonnen, einen jungen Doktor, der ihm seinen Beistand im Kampf gegen den Ewigen anbietet.
Ist es vermessen diese beiden Tatsachen zusammenzuwerfen: der Doktor plädiert für den Lästerer, und der Doktor bricht sich ein Bein. Hat der Zufall sein Pferd erschreckt, dass es scheu wurde und den Wagen umwarf? Ich frage nur. Und wie ging es zu, dass der Doktor, nachdem er mehrere Monate zu Bett gelegen hatte, "mit zerrissener Hüftsehne" wieder aufstand; dass sein vorher klarer und fester Blick einen wilden und sonderbaren Ausdruck angenommen hatte, wie bei einem Menschen, der seiner selbst nicht mehr mächtig ist?
Brauche ich darauf zu antworten? Wenn man mit einem Ja antwortet, werde ich die Erzählung bis zum Ende fortsetzen.
Dieser Doktor, ein guter Kerl, einsichtig und ehrlich, kam eines Tages gegen Ende des Sommers und vertraute mir an, er werde von Schlaflosigkeit geplagt, und ein seltsames Kitzeln wecke ihn des Nachts und lasse ihm nicht eher Ruhe, bis er aufstehe. Wenn er eigensinnig liegen bleibe, stelle sich Herzklopfen ein.
—Nun? Schloss er und erwartete meine Antwort mit einer allzu deutlichen Unruhe.
—Ganz ebenso war es mit mir! Erwiderte ich.
—Und wie haben Sie Heilung gefunden?
War es Feigheit, oder gehorchte ich einer Stimme in meinem Innern, als ich antwortete:
—Ich nahm Sufonal.
Sein Gesicht bekam einen Ausdruck der Enttäuschung, aber ich konnte nichts bei der Sache tun.
Nach drei Monaten sehr strengen Winters machen sich die ersten Frühlingszeichen bemerkbar. Die erstarrten Menschensinne tauen auf, und die ausgesäten Samen unter dem Schnee beginnen zu keimen. Es ist so vieles geschehen, und, statt die unleugbaren Tatsachen als Zufälle und zufälliges Zusammentreffen von sich zu schieben, beobachtet man sie, sammelt sie und zieht daraus seine Reflexionen. Anfangs tat man es, um über seinen eigenen Aberglauben lachen zu können, später erlischt das Lächeln, und man weiss nicht mehr, was man glauben soll. Es geschehen Wunder, und zwar alle Tage, aber man tut nicht Wunder nach Belieben.
Eines Tages zur Mittagsstunde gehe ich über den Markt, der für den Augenblick geräumt ist. Seit langen an Platzfurcht leidend, fürchte ich mich vor leeren Räumen, und mit einer schlecht verhehlten Ängstlichkeit gehe ich über offene Plätze. Dieses Mal, da ich müde von der Arbeit und äusserst nervös bin, macht der Anblick des öden Marktes einen so quälenden Eindruck auf mich, dass ich eine Verlangen empfinde, "mich unsichtbar zu machen", um mich neugierigen Augen zu entziehen; ich senke den Kopf, hefte den Blick auf das Steinpflaster und habe ein Gefühl, als ob ich mich in mich selbst zusammenrolle, die äusseren Sinne zuschliesse und die Berührung mit der Aussenwelt abschneide; als ob ich aufhöre, den Einfluss des umgebenden Milieus zu vernehmen. Und ohne davon zu wissen, bin ich über den Markt gekommen.
Im nächsten Augenblick werde ich aus einer Gasse hinter mir von zwei bekannten Stimmen angerufen. Ich bleibe stehen.
—Welchen Weg kamst du?
—Über den Markt!
—Nein! Wie wäre das zugegangen? Wir standen hier ja Posten, um dich zu treffen und zusammen Mittag zu essen!
—Ich versichere euch....
—Dann hast du dich unsichtbar gemacht?
—Nichts ist unmöglich!
—Für dich wenigstens nicht. Und man erzählt die unglaublichsten Sachen, die mit dir geschehen sein sollen.
—Ich argwöhne so etwas, da man mich an der Donau gesehen hat, als ich in Paris war.
Das war wirklich der Fall, aber zu dieser Zeit glaubte ich, es gebe Visionen ohne eine wirkliche Grundlage.
Und ich warf die Äusserung mehr als einen lustigen Einfall hin.
Am selben Tage nahm ich mein Abendessen allein im kleinen Speisesaal der Kneipe ein. Ein Mann, den ich nicht kannte, trat herein, augenscheinlich, um jemand zu suchen. Er bemerkt mich nicht, obgleich er an allen Tischen nachguckt; und überzeugt, dass er allein im Zimmer ist, fängt er laut an zu fluchen und laut mit sich selbst zu sprechen. Um ihn auf die Gegenwart eines Gastes aufmerksam zu machen, klopfe ich mit der Gabel an ein Glas. Der Fremde macht sofort eine Bewegung und ist überrascht, jemand im Zimmer zu sehen; er schweigt plötzlich und hat Eile, sich fort zu begeben.
Von Stund an beginne ich, über die Frage der Dematerialisation zu grübeln, welche die Okkultisten anerkennen. Und die Beweise folgen Schlag auf Schlag.
Eine Woche später wird meine Aufmerksamkeit von einem neuen, sonderbaren Ereignis geweckt. Es war ein Mittwoch, wo der Speisesaal infolge des Wochenmarktes mit Landleuten vollgepfropft ist. Um dem Gedränge und der Unbehaglichkeit auszuweichen, hat mein gewöhnlicher Tischkamerad ein besonderes Zimmer bestellt; da er früher als ich gekommen ist, erwartet er mich im Vestibül und bittet mich hinauf zu gehen. Um aber Zeit zu gewinnen, kommen wir überein, den allgemeinen Butterbrottisch im Saale in Anspruch zu nehmen. Widerwillig marschiere ich hinter meinem Freund hinein, weil ich die betrunkenen Bauern und deren Verunglimpfungen scheue. Wir kamen durch den Haufen an den Butterbrottisch heran, wo sich nur ein, übrigens sehr friedliches, Individuum befand.
Nachdem wir dort etwas zu uns genommen hatten, wobei ich kein Wort mit meinem Freunde wechselte, zogen wir uns in unser Zimmer zurück, ich hinter ihm. An der Tür zeigt sich mein Freund sehr erstaunt, mich zu sehen.
—Was? Wo kommst du her?
—Vom Butterbrottisch natürlich.
—Ich habe dich dort nicht gesehen; darum glaubte ich, du seist hier geblieben!
—Hast du mich nicht gesehen? Wir haben ja die Hände über den Schüsseln gekreuzt.... Kann ich mich denn unsichtbar machen?
—Komisch ist es jedenfalls!
Wenn ich in meiner Erinnerung grabe, bringe ich jetzt geheime Fonds an den Tag, die bisher ohne Wert für einen Zweifler waren, dessen Gemüt unter der Beschäftigung mit den exakten Wissenschaften steril geworden ist. So erinnere ich mich des Morgens meines ersten Hochzeitstages. Es war ein Wintersonntag, eigentümlich still und unangenehm feierlich für mich, der sich bereitete, das unreine Junggesellenleben zu verlassen und sich mit der Frau, die ich liebte, am ehelichen Herd niederzulassen. Ich fühlte eine Lust, mein Frühstück, das letzte in meinem Junggesellenleben, ganz allein einzunehmen; zu diesem Zweck ging ich in ein unterirdisches Café, das in einer unansehnlichen Gasse lag. Es war ein Kellerraum, mit Gas erleuchtet. Als ich Kaffee-Frühstück bestellt habe, bemerke ich, dass ich den Blicken einer Gesellschaft Männer ausgesetzt bin, die augenscheinlich seit dem Abend um die Flaschen sitzen, gespensterhaft bleich, unmanierlich, nachlässig gekleidet, heiser und garstig, wie sie nach einer in Ausschweifungen zugebrachten Nacht sind. Unter der Gesellschaft erkannte ich zwei Jugendfreunde wieder, die so heruntergekommen waren, dass sie jetzt weder Haus noch Heim noch eine Beschäftigung besassen, notorische Taugenichtse, die vielleicht sogar ans Verbrechen streiften.
Es war nicht Hochmut, der mir Ekel davor einflösste, die Bekanntschaft wieder anzuknüpfen; es war die Furcht, in den Schmutz zurückzufallen; ich wollte mich nicht in meine Vergangenheit versetzen lassen, denn ich hatte in ähnliches Stadium durchgemacht. Schliesslich, als der verhältnismässig Nüchternste von ihnen, zum Abgesandten erwählt, aufstand, um sich meinem Tisch zu nähern, wurde ich von Entsetzen ergriffen; fest entschlossen, meine Identität zu verleugnen, wenn es nötig wäre, messe ich meinen Angreifer mit den Augen; ohne dass ich weiss, wie es zuging, bleibt er ein kleines Stück vor meinem Tisch stehen; mit einem albernen Gesichtsausdruck, den ich nie vergessen kann, bittet er um Entschuldigung und zieht sich auf seinen Platz zurück. Er würde sicher darauf geschworen haben, dass ich es war, und doch erkannte er mich nicht wieder.
Dann fängt man an mein Alibi zu erörtern:
—Er ist es, ganz sicher!
—Nein, hol mich der Teufel, er ist es!
Ich räume das Feld, voll Scham über mich selbst, voll Mitleid mit den Unglücksvögeln, aber in der Tiefe meines Herzens glücklich, einem solch abscheulichen Dasein entronnen zu sein. Entronnen?!
Abgesehen von der moralischen Seite der Sache bleibt noch das Wunderbare bestehen, dass man seinen Gesichtsausdruck so verändern kann, dass man für einen alten Bekannte unerkenntlich wird, dem man das Jahr über auf der Strasse begegnet und zunickt.
Vor fünf Jahren hatte mir in Berlin ein junges Mädchen aus guter Familie das Versprechen abgenommen, ihr eines Abends im Theater Gesellschaft zu leisten. Der Vorschlag gefiel mir nicht, weil ich vermeiden wollte, die junge Dame zu kompromittieren, und ausserdem lange Theaterabende mich ermüden. Da es indessen nicht möglich war, davon loszukommen, begab ich mich zur Zusammenkunft auf ein verabredetes Trottoir. Ich muss jedoch gestehen, dass ich die hundert Schritte hin und zurück auf der anderen Seite der Strasse ging, die indessen ganz schmal war. Ich ging dort eine halbe Stunde, ohne jemand anzusehen, und fest entschlossen, die Begegnung zu verfehlen. Der Streich gelang, und ich schlich mich davon.
Am Tage darauf war ich es, der einen Brief mit Vorwürfen absandte. Das Fräulein antwortete mir verwundert und beteuerte, es sei gekommen und habe gewartet. Die Sache wurde nicht aufgeklärt.
Früher pflegte ich oft allein auf Jagd zu gehen, ohne einen Hund mitzunehmen und oft ohne Flinte. Ich wanderte aufs Geradewohl dahin, es war in Dänemark; als ich auf einer Waldblösse stehen bleibe, taucht ein Fuchs ganz nah bei mir auf. Er sieht mir ins Gesicht, bei klarem Sonnenschein, auf zwanzig Schritt Entfernung. Ich stehe unbeweglich und der Fuchs fährt fort den Boden zu durchschnüffeln, auf Jagd nach Mäusen. Ich bücke mich, um einen Stein aufzunehmen. Da ist er an der Reihe, sich unsichtbar zu machen, denn im Nu, ist er verschwunden, ohne so zu verschwinden, dass ich es sah. Als ich den Boden untersuche, fand ich keine Spur eines Schlupfloches, auch keinen Busch, der ihn verbergen konnte. Er war verschwunden, ohne die Läufe zu Hilfe zu nehmen!
Hier und dort auf den sumpfigen Wiesengründen am Ufer der Donau bauen oft Reiher ihre Nester, und die Reiher sind äusserst scheue Vögel. Trotzdem geschah es oft, dass ich sie überraschen konnte, ohne mich zu verstecken. Und so lange ich mich unbeweglich verhielt, konnte ich dastehen und sie ansehen. Es kam sogar vor, dass sie über meinen Kopf flogen. Niemand wollte mir glauben, wenn ich dies erzählte, am allerwenigsten die Jäger. Daraus schloss ich, dass die Sache ein wenig übernatürlich sei.
Als ich schliesslich diese Abenteuer meinem Freund, dem Theosophen in Lund, erzählte, erinnerte er sich einer Begebenheit, zu der er nie den Schlüssel finden konnte. Ein Arbeiter, den er kannte, besucht ihn und behauptet, ein antiker Kunstgegenstand sei irgendwo zu verkaufen, und bittet um einen Vorschuss von fünf Kronen. Nachdem der Mann den Betrag bekommen hat, ist er wie verschwunden und lässt sich während dreier Monate nicht wieder treffen.
Eines Sonntagabends ging der Theosoph mit seiner Frau durch eine Hinterstrasse, als er den Mann ein Stück vor sich auf demselben Trottoir erblickte. Da habe ich den Burschen endlich!
Der Theosoph lässt den Arm seiner Frau los und beeilt seine Schritte, als plötzlich der andere verschwunden, verdunstet ist. Da war keine Tür, kein Fenster, keine Kellerluke, um hineinzuschlüpfen und sich zu verbergen. Wie gewöhnlich, glaubte der Theosoph das Opfer einer Hallucination gewesen zu sein, zumal sich keine lebende Seele auf der Strasse befand; ein Irrtum der Person war also ausgeschlossen.
Dies ist die nackte Tatsache. Eine Erklärung für das Unerklärliche zu verlangen, ist ein Widerspruch. Wenn man bei einem lebenden Wesen die Fähigkeit anerkennt, die sichtbaren Lichtstrahlen dazu zu bringen, von ihrer Richtung abzuweichen, das heisst, die Amplitude der Refraktion zu verändern, ist etwa in diesem Haufen Worte eine Lösung des Problems zu finden, dessen Hauptpunkt sich in einem Warum und einem Wie verbirgt?
Bleibt nur übrig, dass es ein Wunder war! Mag es denn für ein Wunder gelten, bis man besseren Bescheid erhält; und während wir warten, lasst uns Tatsachen sammeln, ohne sie zu widerlegen zu suchen.
Grosse Verlegenheit empfinde ich, da ich daran soll, meines Freundes Abenteuer darzustellen, aber ich habe ihn im voraus um Verzeihung gebeten, und er weiss, wie uneigennützig meine Zwecke sind. Übrigens, da er selbst seine Verdriesslichkeiten jedem, der sie hören wollte, erzählt hat, ohne sie als ein Geheimnis unter Siegel zu legen, habe ich nur den unparteiischen Chronisten zu spielen; wenn man mich deshalb scheel ansieht, so bin ich es, der darunter zu leiden hat.
Mein Freund ist Atheist und Materialist, aber liebt das Leben, das er verachtet, und ist bange vor dem Tode, den er nicht kennt.
Er ist toll nach Frauen, und als Freischütze nimmt er sein Wildbret sowohl auf verbotenen Jagdgründen wie auf Gemeindeland.
Im Anfang unserer Bekanntschaft, als er mir eine Zuflucht in seiner Wohnung anbot, behandelte er mich mit brüderlicher Freundschaft und pflegte mich wie einen Kranken, das heisst, mit dem rücksichtsvollen Mitleid eines seelenfrischen Freidenkers, der sich auf die Gemütskrankheiten versteht und die Nachsicht übt, die sie fordern.
Nun kann aber auch ein Freidenker seine dunklen Stunden der Traurigkeit haben, für die er keine Ursache weiss, und eines Abend, ganz spät, als die Dämmerung sich im Zimmer ausgebreitet hatte und die angezündeten Lampen nicht genügten, um die Ecken zu erhellen, wo die Schatten ihr Spiel treiben, anvertraute mir mein Freund, zur Antwort auf meinen Dank, dass die Verpflichtung ganz auf seiner Seite sei. Er habe nämlich ganz kürzlich ein Leid erlebt, da ihm sein bester Freund vom Tod entrissen sei. Seitdem werde er von unruhigen Träumen verfolgt, in die sich stets sein abgeschiedener Freund mische.
—Auch du?
—Auch?—Du verstehst doch, dass ich von Träumen spreche, die man nachts träumt....
—Ja, gewiss!
—Schlaflosigkeit, Alpdrücken und so etwas.... Du weisst wie es ist, vom Alp geritten zu werden; das kommt ja von deiner Affektion der Brust, die eine durch Exzesse gestörte Verdauung verursacht. Hast du nie Alpdrücken gehabt?
—Ja, gewiss! Man isst Krebse am Abend, und dann ist es fertig! Hast du es mit Sulfonal versucht?
—Ja, freilich! Aber sich auf die Ärzte verlassen. Du weisst vielleicht selbst....
—Ich kenne sie aus dem Grunde.... Aber lass uns mehr von deinem Kameraden sprechen, der gestorben ist. Offenbart er sich also auf eine beunruhigende Weise, ich meine im Traum?
—Er ist es nicht, der vor mir spukt, das brauche ich dir wohl nicht erst zu sagen. Es ist seine Leiche, und es betrübt mich, sagen zu müssen, dass er unter aufregenden Umständen starb. Denke dir, ein junger talentvoller Mann, der ein vielversprechendes Debut in der Literatur gemacht hat, muss an einer Krankheit sterben, die sehr wenig bekannt ist, Tuberkulosis miliaris; durch die sein Körper eine solche Auflösung durchmachte, dass nichts anderes von ihm übrig bleibt, als ein Hirsesack.
—Und nun spukt seine Leiche vor dir?
—Du willst nicht begreifen, was ich meine; lassen wir die Sache——
Mit schwankender Gesundheit und einer Natur, die ebenso launenhaft wie das Aprilwetter ist, scheint mein Freund an weitvorgeschrittener Nervosität zu leiden; und als ich im Februar von ihm wegziehe, will er nach Sonnenuntergang niemals allein nach Haus gehen.
Da trifft ihn ein Missgeschick von wesentlich ökonomischer Art; ein Prozess soll angestrengt werden, und wir fürchten, dass er sich das Leben nehmen wird, nach gewissen Äusserungen zu urteilen, die er von Zeit zu Zeit fallen lässt!
Neuverlobt, wie er ist, sieht er der Zukunft mit recht düsteren Aussichten entgegen. Aber satt gegen die Widerwärtigkeiten zu reagieren, unternimmt er eine Erholungsreise, um die Sorgen zu betäuben; und nach seiner Rückkehr versammelt er die Kameraden um sich und gibt Festessen. Mitten im Feiern gerät sein Körper in Unordnung, ihm wird verordnet, sich zu Bett zu legen, und er kann nicht darin bleiben infolge einer Diarrhöe, die zwei ganze Tage dauert.
Erst am zweiten Tag davon unterrichtet, begebe ich mich zu ihm. Ein Leichengeruch erfüllt das Haus; der Kranke ist schwarz im Gesicht geworden, so dass man ihn kaum wiedererkennt. Er liegt ausgestreckt auf dem Bett und wird von einem Freund und einer Krankenwärterin gepflegt, deren Hände er nicht einen Augenblick los lässt. Er ist aufgeschreckt, da er von den anhaltenden Plagen geschwächt ist.
Später, als er wieder gesund war, erzählte er mir, er habe eine Vision gehabt von fünf Teufeln in Gestalt roter Affen mit schwarzen Augen, die aufgekrochen auf dem Bettrand sassen und den Schwanz auf und ab bewegten.
Als er seine Kräfte wiedergewonnen hat und es ihm gelungen ist, die Geldsachen zu ordnen, erzählt er seinen Traum jedem, der ihn anhören will, und man amüsiert sich sehr darüber!
Von Zeit zu Zeit drückt er seine Verwunderung darüber aus, dass das Schicksal, das ihn bisher begünstigt hat, nun anfängt, ihn zu verfolgen: nichts will mehr gelingen, alles geht schief.
Mitten in diesen Betrachtungen, die von fröhlichem Leben unterbrochen werden, bekommt der Unglückliche, der bei den Mächten in Ungunst geraten zu sein scheint, einen neuen Stoss, der zu fühlen ist. Ein Kaufmann, der zu seinem Kreis gehört, hat sich ertränkt, Schulden hinterlassend; mein Freund hat für ihn auf eine ansehnliche Summe gebürgt und ist in grosser Verlegenheit.
Die Verdriesslichkeiten beginnen nun, und zwar gehörig. Der Körper des Toten spukt in der Küche meines Freundes, und dieser beredet einen jungen Doktor, die Nächte in seiner Wohnung zuzubringen, um das Gespenst zu verscheuchen. Aber die Unsichtbaren nehmen auf nichts Rücksicht, und eines Nachts erwacht mein Freund, um das ganze Zimmer voller Mäuse zu sehen. Von deren Wirklichkeit überzeugt, nimmt er einen Stock und schlägt nach ihnen, bis sie verschwinden.
Das war ein Anfall von Fieberphantasie, aber einer zu zweien, denn am nächsten Morgen erzählt der Kamerad, der im Zimmer nebenan lag, er habe in dem Zimmer, wo der andere schlief, Mäuse piepen gehört.
Wie soll man eine Hallucination erklären, die der eine durch den Gesichtssinn und der andere mit dem Gehör wahrgenommen hat?
Als man indessen am hellen Tage und bei Sonnenschein dieses Abenteuer erzählt, wird es in Lächeln gewendet. Und darauf unterfängt sich mein Freund, die Erscheinung, die er von dem Kaufmann, dem Selbstmörder, gehabt hat, im einzelnen zu erläutern, und er begleitet seine Darstellung mir ausgesucht cynischen Bemerkungen.
—Könnt ihr euch denken, er war ganz schwarz und die weissen Maden wimmelten aus dem Rumpfe hervor.... Als Augenzeuge kann ich berichten, dass er im selben Augenblick, als er diese Worte ausgesprochen hatte, erbleichte, vom Tisch aufstand und mit einer Gebärde des Ekels auf etwas deutete, das auf seinem Teller lag. Es war eine weisse Made, die an einer Sardine entlang kroch!
Am folgenden Tage wird mein Freund genötigt, seine Abendmahlzeit abzubrechen, weil er weisse Maden an einem Stück Küken findet.
Er vermag nichts zu essen, obgleich er sehr hungrig ist, und wird ängstlich, aber nur für einen Augenblick.
—Was bedeutet das? Was bedeutet das?
—Man soll nicht schlecht von den Toten sprechen. Denn sie rächen sich.
—Die Toten? Aber die sind ja tot!
—Gerade deshalb sind sie lebendiger als die Lebendigen.
Mein Freund hat sich wirklich angewöhnt, offen von den Schwächen des Verstorbenen zu sprechen, der ihm trotz allem ein guter Freund gewesen war.
Einige Tage später, als wir auf der Gartenveranda des Restaurants bei Tische sitzen, ruft einer von den Tischgästen aus:
—Seht, die Maus, so eine grosse Maus!
Keiner hat sie gesehen, und man macht sich lustig über den Visionär.
—Wartet nur, ihr werdet sie schon sehen, sie ist dort unter den Brettern! Eine Minute vergeht und eine Katze kommt unter den Brettern hervor.
—Ich glaube, wir haben bald genug von Mäusen! ruft mein Freund aus, augenscheinlich peinlich berührt.
Nach Verlauf einiger Zeit kommt eines Abends jemand und klopft an meine Tür, nachdem ich zu Bett gegangen bin. Ich öffne und befinde mich von Angesicht zu Angesicht mit meinem Freunde, der entstellt aussieht und erregt ist. Er bittet, bei mir auf einem Sofa bleiben zu dürfen, weil ... eine Frau die ganze Nacht hindurch schreit in dem Hause, wo er wohnt.
—Ist es eine richtige Frau oder ein Gespenst?
—Oh, es ist eine Frau, die den Krebs hat und nichts besseres verlangt, als sterben zu dürfen.—Man kann verrückt werden von dem all dem! Und wenn ich meine Tage nicht im Irrenhaus beschliesse, wäre es wunderbar!
Es ist nur ein sehr kurzes Sofa da, und als ich den hochgewachsenen Mann auf einem solchen Ding und zwei daneben gestellten Stühlen ausgestreckt sehe, ist mir, als sähe ich einen Galeerensträfling auf der Folterbank.
Aus seiner hübschen Wohnung und seinem bequemen Bett verjagt, des einfachen Genusses, sich auskleiden zu dürfen, beraubt, flösst er mir Mitleid ein, und ich biete ihm als Zeichen meiner Dankbarkeit mein Bett an. Aber er sagt nein dazu.
Die Lampe muss angezündet sein, er will es, und der Schein fällt dem Unglücklichen gerade ins Angesicht. Ihm ist bange vor dem Dunkel, und ich verspreche ihm, als Nachtwache aufzubleiben.
—Es leidet keinen Zweifel! Es ist eine kranke Frau, aber merkwürdig ist es jedenfalls.
So liegt er und murmelt, bis der Schlaf sich seiner erbarmt!
Ganze zwei Wochen lang musste er nachts auf fremden Sofas Ruhe suchen.
—Das ist ja die Hölle selbst! ruft er aus.
—Ganz mein Gedanke! gebe ich zur Antwort.
Und ein anderes Mal, als sich die "weisse Frau" in der Nacht gezeigt hat, stellt er selbst die Möglichkeit auf, es könne eine Strafe sein. Meiner Rolle getreu, beschränke ich mich auf ein skeptisches Schweigen. Ich will übergehen die Begebenheiten mit dem schreienden Mädchen, die Dazwischenkunft des Polizeiagenten, der als alter Mitschuldiger in einer berüchtigten Sache erkannt wurde; ich verweile auch nicht bei dem Auftreten des Butterhändlers und seiner Tochter, sondern setze ein mit der Erzählung von der Madonna und der Vision, die man auf telepatischem Wege von einer Person in dem Augenblick hatte, als sie starb. Sie ist ganz kurz.
Bei einem Ausflug ins Grüne befindet mein Freund sich in einer kleinen Gesellschaft, die am Ufer eines Sees versammelt ist. In einem Ausbruch guter Laune vergisst er die angstvollen Stunden, die er auszustehen gehabt hat, und wirft folgenden Einfall hin:
—Hier müsste man eine Offenbarung der heiligen Jungfrau in Szene setzen! Es würde ein gutes Geschäft sein, einen Wallfahrtsort anzulegen.
Im selben Augenblick erbleichte er, und zur grossen Verwunderung seiner Begleiter rief er fast in Ekstase aus:
—Jetzt starb er!
—Wer?
—Leutnant X. Ich sah ihn im Todeskampf liegen, das Zimmer, die Anwesenden darin, alles!
Man amüsierte sich!
Als man aber in die Stadt zurückkehrt, begegnet man der Nachricht von Leutnant X's Hinscheiden. Und der Tod war plötzlich eingetroffen, genau um halb acht Uhr, im selben Augenblick, als der Visionär davon Botschaft bekam.
Die Spottvögel wurden von dem Eindruck überwältigt, so dass sie unwillkürlich Tränen vergossen, nicht aus Trauer, da der Tode ihnen ganz gleichgültig war, sondern aus Gemütsbewegung über das Wunder.
Die Zeitungen machen ein Wesen aus dem Geschehnis; die ehrlichen unter ihnen leugnen die Tatsache nicht, die unehrlichen lassen durchblicken, die Zeugen seien Betrüger. Die Folge ist ein Protest meines Freundes, des Ketzers, der den Sachverhalt anerkennt, ihn aber als zufälliges Zusammentreffen auslegt.
Ich gebe zu, dass sich eine gewisse Bescheidenheit in dieser Art verrät, der Mächte Eingreifen in unsere kleinlichen Angelegenheit auszuscheiden, aber dahinter verbirgt sich auch "der Unbussfertigen Verhinderung"; was aus folgender Stelle bei Claude de Saint-Martin hervorgeht:
"Vielleicht hat diese unrichtige Ideenverbindung (dass die Erde nur ein Punkt im Weltall ist) den Menschen zu der noch unrichtigeren Vorstellung geführt, dass er der Blicke seines Schöpfers nicht würdig sei; er hat geglaubt, nur den Mahnungen der Demut zu gehorchen, wenn er sich zuzugeben weigert, dass diese Erde und alles, was das Universum enthält, nur seinetwegen entstanden sei; er hat sich gestellt, als fürchte er zu sehr seinem Hochmut zu gehorchen, wenn er sich diesem Gedanken hingäbe. Aber er hat nicht die Trägheit und Feigheit gefürchtet, die von dieser erheuchelten Bescheidenheit unvermeidlich erzeugt werden; und wenn der Mensch sich heute nicht mehr für den König des Universums halten will, ist die Ursache die, dass er nicht den Mut hat zu arbeiten, um sich die rechtmässigen Ansprüche darauf zu erwerben; dass die Pflichten dabei ihm zu mühsam erscheinen, dass er nicht so sehr fürchtet, auf seine Stellung und alle ihre Rechte verzichten, als sich daran machen zu müssen, um sie in ihrer geltenden Kraft wiederherzustellen."
Zwischen den beiden blinden Klippen, Hochmut und falscher Demut, wer kann wohl das Kanoe finden, das zum Hafen führt?
Indessen habe ich alle Schwächen meines Freundes so vollständig kennen gelernt, dass ich seine nächtlichen oder täglichen Drangsale voraussagen kann, indem ich nur sein Betragen beobachte; was mich zu dem Schlusssatz geneigt macht, dass alle Krankheiten, die ihn treffen, von der Moral herrühren. Aber Moral ist ein Wort, das jetzt herabgesetzt und in den Bann getan ist, und ich bin nicht der rechte Mann, es auszusprechen.
Bei einer einzigen Gelegenheit, als der Unglückliche gar zu sehr bedrückt war, äusserte ich zu ihm, aus Mitleid und um einen Wegweiser aufzustellen:
—Wenn du vor deinem letzten nächtlichen Anfall Swedenborg gelesen hättest, würdest du in die Heilsarmee gegangen oder Krankenpfleger geworden sein!
—Wieso? Was sagt denn dieser Swedenborg?
—Er sagt so viel, und er ist es, der mich davor gerettet hat, verrückt zu werden. Er hat mir den Schlaf wieder geschenkt durch einen einzigen Satz in vier Worten!
—Sag den, ich bitte dich darum!
Der Mut entsank mir, und er hat mir jedes Mal gefehlt, wenn der Besessene mich gebeten hat, diese Losung mitzuteilen.
Hier schreibe ich die vier Worte nieder, die gegen alle Verordnungen der Ärzte aufgekommen sind:
"Tue dieses nicht mehr!"
Es steht einem jeden frei, nach bestem Wissen und Gewissen das kleine Wort dieses auszulegen.
Ich Unterzeichneter erkläre hiermit, dass ich durch Befolgung des obigen Rezeptes Gesundheit und ruhigen Schlaf wiedergewonnen habe.
Der Verfasser.
Das ist ein Bekenntnis! Keine Ermahnung!
Keiner ist vom Schicksal so geprüft worden, wie der Doktor, von dem ich im ersten Kapitel als dem Haupt des revoltierenden Jugendschwarmes gesprochen habe. Nachdem er unzählige Male umgesattelt hat, ist er Freund der Mässigkeit geworden, mit fast religiösen Grillen. Er gibt zu, vollständig bankerott zu sein, glaubt an nichts und misstraut den Menschen, entblösst wie er ist von den Sinnen, die uns in Stand setzen zu geniessen und zu leiden, gleichgültig gegen alles. Denn er begann damit, dass er sich für die Freiheit des Individuums, für die Befreiung des Volkes und der Frau begeisterte; und er hat die Konsequenzen davon gesehen, die seine Illusionen vollständig zu Fall gebracht haben. Er, der besonders das Ideal vom freien Weibe verwirklichen wollte, hat seine Braut, die er selbst hochachtete, als literarische Mätresse eines jeden Mannes enden sehen, als eine Art prostituierten Bohême-Weibes.
Er ist nun dreissig Jahre alt. Während seines jahrelangen Aufenthaltes im Ausland hat er alle Leiden eines Einsiedlers durchgemacht: Armut, Hunger und Kälte, schäbige Kleider; die Verdriesslichkeiten, die ein schuldenbeladener Mann auszustehen hat. Er hat nachts in Wäldern und offenen Parks geschlafen, aus Mangel an fester Wohnstätte; er hat sich mit Stärke und Gelatine ernährt, die dazu bestimmt waren, in dem Labor gebraucht zu werden, an dem er angestellt war.
Der Hunger aber hat mangelnde Widerstandskraft gegen Alkohol zur Folge, und obwohl nicht Alkoholiker, erlag er den Wirkungen der geringen Menge starker Getränke, die er in der Lage war sich zu verschaffen.
Von seinen Verwandten Wind und Wellen überlassen, kann er sich in einer Heilanstalt für Nervenkrankheiten in Pension geben, dank einem Manne, der ihm so gut wie unbekannt ist und welcher der Swedenborgischen Sekte angehört. (!)
Nach einigen Monaten wurde er als geheilt entlassen und kehrte nach der Universität in Schweden zurück, jedoch weiter zu Enthaltsamkeit verurteilt.
Er war es, der mir Swedenborgs "Arcana Coelestia" lieh, und später "Apocalypsis revelata", Arbeiten, die er selbst nicht kannte, die sich aber in der Büchersammlung seiner Mutter befanden; sie war nämlich Swedenborgianerin. (!)
Noch etwas ist überraschend für mich, der ich bis zu meinem achtundvierzigsten Jahr nie auf Arbeiten von Swedenborg gestossen bin, für die man in den gebildeten Klassen Schwedens offene Verachtung zeigt—dass er jetzt überall auftaucht: in Paris, an der Donau, in Schweden, und zwar im Laufe nur eines halben Jahres.
Mein desillusionierter Freund verhält sich indessen indifferent, trotz den Streichen, die ihm das Schicksal zu wiederholten Malen spielt. Er kann sich nicht beugen und glaubt, es sein eines Mannes unwürdig, vor unbekannten Mächten zu knien; die könnten sich eines Tages als Versucher enthüllen, deren Versuchungen nur Prüfungen sind, denen man bis zum äussersten widerstehen muss.
Ich verberge ihm nicht meine neuen religiösen Ansichten, jedoch ohne auf ihn einwirken zu wollen.
—Siehst du, die Religion ist etwas, das man auf sich selbst anwenden muss; die ist nichts zum Predigen!
Oft lauscht er meinen Worten mit scheinbarer Aufmerksamkeit, und oft lächelt er. Zwei Wochen lässt er sich nicht sehen, als sei er geärgert worden, dann aber kommt er wieder und sieht aus, als habe er über einen Gedanken gebrütet.
In der Absicht, ihm zu Hilfe zu kommen, werfe ich von ungefähr ein Wort hin mit einem Fragezeichen dahinter:
—Es geschieht sicher etwas?
—Ich weiss nicht; aber es ist wirklich zu ungereimt, um mit rechten Dingen zugehen zu können.
—Was ist es denn?
—Jeden einzigen Morgen, wenn ich ins Laboratorium komme, sind meine Sachen in Unordnung gebracht—du kannst nicht glauben, wie es da aussieht!—und der Tisch ist besudelt. Und zwar obgleich ich auf das sorgfältigste dort Sauberkeit zu halten suche.
—Ein Übelgesinnter?
—Unmöglich; denn ich bin der letzte, der den Saal verlässt und der Schuldige würde sogleich entdeckt werden.
—Dann ist es?
—Ja, wer?
—Die Unsichtbaren!
—Nicht dass ich es behaupten will, aber jetzt in letzter Zeit scheint es, als ob mich jemand überwache und meine geheimsten Gedanken zu lesen verstehe. Und im selben Augenblick, wenn ich auf irgend eine Weise über die Stränge geschlagen habe, fasst man mich auf frischer Tat.
—Bist du jemals früher Vorfällen von ungewöhnlicher Beschaffenheit ausgesetzt gewesen?
—Nicht ich, aber meine Mutter und meine Schwester, die Swedenborgianer sind.—Doch warte, ich auch, ein Mal in Berlin vor genau zwei Jahren.
—Erzähle!
—Es war so: ich ging eines Abends in der Nähe von Linden in eine Bedürfnisanstalt; da erblickte ich an meiner Seite einen barhäuptigen Mann von unbestimmten und sonderbarem Aussehen; er hatte einen Knoten hinten im Nacken, und zu meiner Verwunderung jodelte er wie ein Tiroler. Den unangenehmen Eindruck, den dieser Mensch mit seiner Leichenbitterphysiognomie auf mich machte, konnte ich nicht loswerden; um ihn von mir abzuschütteln, verlängerte ich meinen Spaziergang und ging aus der Stadt heraus; schliesslich befand ich mich auf dem Lande. Müde und hungrig trat ich in ein Wirtshaus, wo ich am Ladentisch ein Frankfurter Würstchen und ein Seidel Bier bestellte. "Ein Frankfurterwürstchen und ein Seidel Bier", wiederholt jemand an meiner Seite; und als ich mich umwende, erblicke ich den Mann mit dem Nackenknoten. Vollständig verwirrt, und unfähig zu sagen, warum, ging ich meines Weges, ohne auf das zu warten, was ich bestellt hatte. Ich habe nie näher an diesen bedeutungslosen Vorfall gedacht, aber ich besitze noch einen lebendigen Eindruck davon, und er kommt gerade jetzt in meine Erinnerung zurück.
Als er geendet hatte, bedeckte er die Augen mit beiden Händen, als wolle er das Bild auswischen, indem er den Augapfel rieb, der noch das Porträt der Gestalt festhielt.
An dieser Stelle, während der Leser sich noch des oben Erzählten im Detail erinnert, will ich ein anderes Abendteuer einschalten, das dadurch, dass es mit dem Vorhergehenden in Verbindung gesetzt wird, uns vielleicht dem guten Hafen einen Schritt näher führen wird.
Am ersten Mai ging ich recht zeitig nach dem Park, um zu Mittag zu essen, zusammen mit einem Gymnasiallehrer. Als wir uns an einem Tisch niedergelassen hatten, auf dem grossen offenen Balkon, wo kein Mensch war, empfand ich plötzlich ein Gefühl des Unbehagens, und als ich mich auf dem Stuhle umdrehte, bemerkte ich einen Mann von recht unbestimmten Aussehen, der einen unstäten, unschlüssigen Ausdruck im Blick hatte.
—Wer ist das? Fragte mich mein Begleiter, der alter Lundenser war und die ganze Bevölkerung kannte.
—Ein Fremder, ganz sicher!
Der Fremde, barhäuptig und schweigsam, kam näher, indem er gerade vor mir stehen blieb, betrachtete er mich auf eine so durchdringende Art, dass ich einen brennenden Schmerz in der Brust fühlte.
Wir nahmen einen andern Platz ein. Der Mann folgte uns, ohne sein Schweigen zu brechen. Seine Blicke waren weder böse noch scharf, vielmehr äusserst wehmütig, und ausdruckslos wie die eines Nachtwandlers. Da wurde ich von einer Erinnerung ergriffen, die allzu entfernt war, um bewusst zu sein, und stellte an meinen Tischkameraden die Frage:
—Der Mann gleicht einem unserer Freunde, aber welchem?
—Ja, wahrhaftig es ist ganz offenbar unser Freund Martin mit fünfundvierzig Jahren.
In diesem Augenblick taucht aus dem Chaos meines Innern: die Gestalt von der Bedürfnisanstalt in Berlin und Freund Martin (so hiess der unglückliche Doktor, der mir Swedenborgs Arbeiten geliehen hatte) verfolgt von einem Unbekannten.
Nun hatte der Mann neben uns Platz genommen, aber so, dass er uns den Rücken zukehrte.
Wie gross war meine Verwunderung, als ich einen Knoten im Nacken dieses Menschen bemerkte. Um aber ganz sicher zu sein, fragte ich meinen Kameraden:
—Kannst du den Auswuchs am Hinterkopf dieses Mannes sehen?
—Ganz recht! Ich sehe ihn deutlich. Nun und?
Ich antwortete nicht, weil die Erzählung zu lang geworden wäre, auch war der Lehrer ein erbitterter Gegner des Okkultismus.
Am selben Abend erblicket ich Freund Martin mitten in einem Schwarm Studenten. Ohne Umschweife stellte ich diese Frage an ihn:
—Wo hast du dich mittags zwischen eins und halb zwei aufgehalten?
—Wieso? Warum fragst du das?
Und er sieht verlegen aus, als er das sagt.
—Antworte nur auf die Frage!
—Ich lag und schlief! Und das pflege ich sonst nicht mitten am Tage zu tun, deswegen bin ich verlegen.
—Und du gehst während des Schlafes fort?
—Das sieht so aus, da ich vor einigen Tagen, während ich schlief, das Feuer sah, das im Museum ausgebrochen war. Das ist die reine Wahrheit!
Nach diesem Bekenntnis schilderte ich ihm die Erscheinung im Park und verglich sie mit der Offenbarung in Berlin.
Aber er war zu aufgeräumt, und obwohl dieser Knoten im Nacken ihm schaudern machte, rief er aus:
—Es stimmt, er ist mein Doppelgänger!
Das war ein Gelächter!
Ich halte mich hier einen Augenblick auf, um die üblichen Theorien darzulegen von der Erscheinung, die unter der Benennung Doppelgänger bekannt ist.
Die Theosophen nehmen sie als eine Tatsache an, indem sie zugeben, dass die Seele, oder der Astralleib, das Vermögen besitzt, den Körper zu verlassen und sich in eine quasi-materielle Gestalt zu kleiden, die unter günstigen Umständen für manche sichtbar wird. Alle sogenannten telepathischen Erscheinungen werden dadurch erklärt. Die Schöpfungen der Einbildungskraft haben keine Realität, aber die Visionen, die Hallucinationen besitzen eine Art Materialität. In derselben Weise unterscheidet man in der Optik zwischen virtuellen und wirklichen Bildern, von denen die letzten auf einen Schirm projiziert oder auf einer empfindlichen photographischen Platte fixiert werden können.
Angenommen, ein Abwesender erinnert sich meiner, indem er sich meine Persönlichkeit in seinem Gedächtnis hervorruft: dem Hervorrufenden gelingt es nur, ein virtuelles Bild von mir zustande zu bringen, und zwar durch eine freiwillige und bewusste Anstrengung. Angenommen, eine alte Tante von mir im fremden Lande sitzt am Piano, ohne an mich zu denken, und sieht mich dann persönlich hinter dem Instrument stehen: die Alte hat ein virtuelles Bild von mir gesehen. Und dies hat sich tatsächlich zugetragen, im Herbst 1895. Ich erinnere mich, dass ich damals in der französischen Hauptstadt eine furchtbare Krisis durchmachte, als meine Sehnsucht, im Schosse meiner Familie zu sein, bis zu dem Grad acht über mich bekam, dass ich das Innere des Hauses sah und für einen Augenblick meine Umgebung vergass, indem ich das Bewusstsein, wo ich mich befand verlor. Ich war dort, hinter dem Pianino, in welcher Gestalt es nun geschah, und die Einbildung der alten Frau spielte keine Rolle dabei.
Da sie übrigens in diese Art Erscheinung eingeweiht war und deren Tragweite kannte, sah sie darin einen Vorboten des Todes und schrieb, um zu erfahren, ob ich krank geworden sei!
Um dieses Problem besser zu beleuchten, will ich hier einen Aufsatz von mir einrücken, der 1896 in der "Initiation" stand und Berührungspunkte mit oben angeführten Vorfall hat.
"Ausser sich sein" und "sich sammeln" sind zwei allgemein übliche Wendungen, die gut die Fähigkeit der Seele ausdrücken, sich auszudehnen und sich wieder zurückzuziehen.
Die Seele schrumpft zusammen vor Furcht und schwillt auf vor Freude, Glück, Erfolg.
Steig allein in einen vollbesetzten Eisenbahnwagen. Keiner kennt den andern, alle sitzen still da. Alle empfinden je nach dem Grad ihrer Empfindlichkeit ein grosses Unbehagen. Da geht ein mannigfaltige Kreuzung verschiedener Bestrahlungen vor sich, die allgemeine Beklemmung erzeugt. Es ist nicht warm, aber man glaubt zu ersticken: die Geister, die zum Übermass mit magnetischen Fluida geladen sind, fühlen ein Bedürfnis zu explodieren; die Intensität der Ströme, verstärkt die Influenz und Condensation, vielleicht sogar von Induktion, hat ihr Maximum, erreicht.
Da nimmt einer das Wort: Die Entladung hat stattgefunden, und die Neutralisation ist eingetreten, wenn sich alle in ein Gespräch ohne Inhalt eingelassen haben, um ein kurz gesagt physisches Bedürfnis zu befriedigen.
Der Einsiedler zieht sich in seine Ecke zurück, schliesse sein inneres Auge und Ohr und vertieft sich in sich selbst, um sich gegen eine neue Influenz zu wehren.
Oder er betrachtet auch die Landschaft durch das Fenster und lässt seine Gedanken umher irren, indem er heraustritt aus dem magischen Kreis für ihn gleichgültiger Menschen, die mit ihm eingeschlossen sind.
Das Geheimnis des grossen Schauspielers liegt in der angeborenen Eigenschaft, seine Seele ausstrahlen zu lassen; dadurch tritt er in Verbindung mit dem Publikum.
Es leuchtet, strahlt um den geistigen Redner in grossen Augenblicken, und sein Antlitz verbreitet einen Schein, der sogar für die sichtbar ist, die nicht gläubig sind.
Der Schauspieler von träumerischer Natur, der eine tiefe Intelligenz besitzt, der viel studiert, aber nicht die Fähigkeit hat, aus sich selbst herauszugehen, wird sich niemals auf der Bühne geltend machen können. In sich selbst verschlossen, wird sein Geist nicht in die Gemüter der Zuschauer eindringen.
Bei den grossen Krisen im Leben, wenn das Dasein selbst bedroht ist, erwirbt die Seele übersinnliche Eigenschaften. Es scheint, als ob die Furcht vor dem Elend die gemarterte Seele treibt, zu entfliehen, um anderswo ein Leben zu suchen, das leichter zu leben ist. Nicht umsonst übt der Selbstmord seine Anziehung auf den Unglücklichen, da er verspricht, die Pforten des Gefängnisses zu öffnen.
Folgendes ist mir passiert vor einigen Jahren.
Ich sass eines Herbstmorgens an meinem Schreibtisch vor dem Fenster, das auf die düstere Strasse einer kleinen Industriestadt Mährens blickte.
Im angrenzenden Zimmer, zu dem die Tür angelehnt war, ruhte meine Frau in kränklichem Zustande, ihr Erstgeborenes erwartend.
Indem ich schrieb, träumte ich mich fort in eine Landschaft, die mehr als tausend Kilometer nördlich lag und die ich wohl kannte.
Während es Herbst war, und hier beinahe Winter, befand ich mich mitten im Sommer unter einer grünen Eiche, von der Sonne beschienen; der kleine Garten, den ich in meiner Jugend selbst bebaut hatte, war dort; die Rosen—ich konnte sie beim Namen nennen—die Syringen, die Jasmine atmeten wahrnehmbar ihre besonderen Düfte aus; ich las Raupen von meinen Kirschbäumen ab, ich beschnitt die Johannisbeerbüsche.... Plötzlich höre ich einen heiseren Schrei, ich finde mich auf dem Fussboden stehen, ein Krampf dreht schraubenförmig mein Rückgrad um, und bewusstlos falle ich auf einen Stuhl nieder, einen unerträglichen Schmerz im Rücken.
Ich erwache zum Bewusstsein und es wird mir klar, dass meine Frau von hinten gekommen war, um mir guten Morgen zu sagen, und ganz leise ihre Hand auf meine Achsel gelegt hatte.
—Wo bin ich?
Das war meine erste Frage, und ich sprach sie aus in der Sprache meiner Heimat, die meine Frau als Ausländerin nicht verstand.
Der Eindruck, den ich von diesem Vorfall bewahrte, war der, dass sich mein Geist ausgedehnt und den Körper verlassen hatte, ohne die Verbindung der unsichtbaren Fäden abzubrechen; ich bedurfte einer gewissen, wenn auch noch so kurzen Zeit, um mich einigermassen zu erinnern, dass ich mich bewusst und unversehrt in dem Zimmer aufhielt, wo ich soeben sass und arbeitete.
Wenn nach den alten Erklärungen meine Seele in sich selbst versunken gewesen, noch in den Grenzen des Körpers geblieben wäre, hätte sie sich mit grösster Leichtigkeit und Schnelligkeit wieder entfalten können, und dies Gefühl der Überraschung während meiner Abwesenheit hätte mich nicht in so hohem Grade gequält.
Nein, ich war abwesend, und die Rückkehr meiner Seele ging auf so plötzliche Weise vor sich, dass ich darunter litt. Aber die Schmerzen waren in der Rückengegend zu merken und durchaus nicht in den Gehirnhalbkugeln: das erinnert mich an die überwiegende Rolle, die man dem plexus solaris zulegte, als ich in meiner Jugend Medizin studierte.
Ein anderes Abenteuer, das mir vor drei Jahren in Berlin passierte, ist für mich ein Beweis, dass die Exteriorisation oder Auswanderung der Seele unter aussergewöhnlichen Umständen stattfinden kann.
Nach erschütternden Krisen, Sorgen und unregelmässigem Leben sitze ich eines Nachts zwischen eins und halb zwei bei einem Weinhändler an einem Tisch, der jederzeit für meinen Kreis bereit stand. Man hatte seit sechs Uhr gegessen und getrunken und ich hatte die ganze Zeit so gut wie allein das Gespräch führen müssen. Es handelte sich für mich darum, einen jungen Offizier, der im Begriff stand, die militärische Laufbahn gegen die des Künstlers zu vertauschen, einen verständigen Rat zu geben. Da er sich zu gleicher Zeit in ein junges Mädchen verliebt hatte, befand er sich in einem äusserst überspannten Zustand; und nachdem er im Lauf des Tages von seinem Vater einen Brief mit Vorwürfen erhalten hatte, war er geradezu ausser sich. Ich vergass meine eignen Wunden, während ich die eines andern pflegte. Es war eine schwere Arbeit, bei der mein Geist sich infolge einer Reflexbewegung erhitzte. Nach endlosen Beweisführungen und Berufungen wollte ich ihn an ein vergangenes Begebnis erinnern, das auf seinen Entschluss einwirken konnte.
Er hatte den fraglichen Auftritt vergessen, und, um sein Gedächtnis zu unterstützen, fange ich an, ihn zu schildern.
—Sie erinnern sich doch jenes Abends im Augustiner-Bräu....
Und ich fahre fort, in dem ich den Tisch bezeichne, wo wir unser Kuvert verzehrt hatten; beschreibe den Schenktisch, die Tür, durch die man herein kam, die Möbel, die Bilder....
Auf einmal schwieg ich ... hatte halb das Bewusstsein verloren, ohne ohnmächtig zu sein, und sass noch auf dem Stuhle. Ich war im Augustiner-Bräu und hatte vergessen, zu wem ich sprach, als ich so wieder anfing:
—Warten Sie! Ich bin im Augustiner, aber ich weiss sehr wohl, dass ich an einem andern Ort bin; sagen Sie nichts ... ich erkenne Sie nicht, aber ich weiss, dass ich Sie kenne. Wo bin ich?—Sagen Sie nichts, das ist äusserst interessant....
Ich mache eine Anstrengung, um die Augen zu erheben—weiss nicht, ob sie geschlossen waren—und ich sah einen Nebel, einen Hintergrund von unbestimmtem Farbenton, und oben an der Decke herab senkte es sich wie ein Theatervorhang: das war die Scheidewand, besetzt von Regalen und Flaschen.
—So! äusserte ich erleichtert, wie nach einem überstandenen Schmerz, ich bin ja bei Herrn F. (so hiess der Weinhändler).
Das Gesicht des Offiziers hatte sich vor Schreck zusammengezogen und er weinte.
—Was, Sie weinen? sagte ich zu ihm.
—Das war unheimlich, antwortete er.
—Was denn?...
Wenn ich diese Geschichte andern Personen erzählt habe, hat man eingewendet, es sei eine Ohnmacht oder ein Rausch gewesen, zwei Worte, die nicht viel sagen und nichts erklären.
Erstens und vor allem wird eine Ohnmacht von dem Verlust des Bewusstseins begleitet, ebenso der Rausch; zweitens von einer Muskellähmung; was hier nicht der Fall war, da ich auf meinem Stuhl sitzen blieb und bewusst über meine partielle Unbewusstheit sprach.
Zu diesem Zeitpunkt kannte ich weder die Erscheinung noch den Ausdruck: Exteriorisation des Empfindungsvermögens. (A. de Rochas, l'Extériorisation de la sensibilité. Paris, Chamuel.) Jetzt da ich sie kenne, bin ich überzeugt, dass die Seele die Fähigkeit besitzt, sich auszudehnen; dass sie sich während des gewöhnlichen Schlafes sehr ausdehnt, um zum Schluss, im Tode, den Körper zu verlassen, keineswegs ausgelöscht zu werden.
Vor einigen Tagen, als ich ein Trottoir hinunterging, sah ich, wie ein Gastwirt vor seiner Tür mit einem Scherenschleifer, der auf der Strasse hielt, laute und böse Worte wechselte. Es war mir unangenehm, die Linie zu durchschneiden, die diese beiden Individuen verband, aber es war nicht zu vermeiden; und ich versichere, dass ich ein starkes Unbehagen empfand, als ich den Raum zwischen den beiden zankenden Männern überschritt. Es war, als zerrisse ich ein zwischen ihnen ausgespanntes Seil, oder vielmehr ginge über eine Strasse, die man von beiden Seiten mit Wasser bespritzt.
Das Band, das Freunde, Verwandte und in höchstem Grad Gatten aneinander bindet, ist ein wirkliches Band, und zwar von einer greifbaren Wirklichkeit.
Wir beginnen ein Weib zu lieben, indem wir bei ihr Stück für Stück unserer Seele niederlegen. Wir verdoppeln unsere Persönlichkeit, und die Geliebte, die bisher gleichgültig, neutral war, beginnt sich in unser anderes Ich zu kleiden, und sie wird unser Doppelgänger. Wenn es ihr einfällt, mit unserer Seele fortzugehen, ist der Schmerz darüber vielleicht der heftigste, den es gibt, nur vergleichbar mit dem der Mutter, die ihr Kind verloren hat. Ein leerer Raum entsteht, und wehe dem Mann, der nicht über die Kraft verfügt, seine Zweiteilung wieder zu beginnen und ein anderes Gefäss zum Füllen zu finden.
Die Liebe ist ein Akt, durch den der Mann sich selbst befruchtet, weil es der Mann ist, der liebt; es ist eine süsse Illusion, das er von seiner Frau geliebt wird, seinem zweiten Ich, seiner eigenen Schöpfung.
Zwischen liebenden Gatten offenbart sich oft das unsichtbare Band auf eine mediumartige Weise: man kann einander aus der Ferne rufen, die Gedanken des andern lesen, Suggestion auf einander ausüben. Man fühlt nicht mehr das Bedürfnis, mit einander zu sprechen; man freut sich über die blosse Gegenwart des geliebten Wesens; man wärmt sich an der Strahlung, die von der Seele des andern ausgeht. Wenn man getrennt ist, dehnt sich das Band: das Vermissen, die Sehnsucht wächst mit der Entfernung, kann das Band zerreissen und damit den Tod bringen.
Seit mehreren Jahren habe ich Aufzeichnungen über alle meine Träume gemacht, und ich bin zu der Überzeugung gekommen: dass der Mensch ein doppeltes Leben lebt, dass die Einbildungen, die Phantasien, die Träume eine Wirklichkeit besitzen. Wir sind alle geistige Schlafwandler und begehen im Traume Handlungen, die uns im wachen Zustande je nach ihrer Natur mit dem Gefühl der Befriedigung, dem bösen Gewissen, der Furcht vor den Folgen erfüllen. Und aus Gründen, die ich ein ander Mal darlegen will, glaube ich dass die sogenannte Verfolgungsmanie oft einen guten Grund hat, nämlich in der Gewissensqual nach schlechten Handlungen, die man im "Schlaf" begangen hat und von denen neblige Erinnerungen bei uns spuken.
Die Phantasien des Dichters, die beschränkte Seelen so verachten, sind Wirklichkeiten.
Und der Tod? fragt ihr.
Dem Mutigen, der nicht zu grossen Wert auf das Leben legt, hätte ich früher folgendes Experiment empfohlen, das ich mehrere Male wiederholt habe, nicht ohne unangenehme, aber jedenfalls ohne schwer heilbare Folgen.
Nachdem Türen, Fenster und Ofenklappen geschlossen sind, stelle ich eine geöffnete Flasche mit Cyankalium auf den Nachttisch und lege mich aufs Bett.
Die Kohlensäure der Luft macht in kurzem die Blausäure frei, und die bekannten physiologischen Erscheinungen geben sich zu erkennen. Ein gelindes Zusammenschnüren der Kehle, ein unbeschreiblicher Geschmack, den ich aus Analogie "blau" nennen möchte, Lähmung der Armmuskeln, Schmerzen im Magen.
Die tödliche Wirkung der Blausäure ist noch immer ein Geheimnis. Verschiedene Autoritäten geben verschiedene Wirkungsarten dieses Giftes an. Einer sagt: Gehirnlähmung; ein anderer: Herzlähmung; ein dritter: Erstickung als sekundäre Wirkung davon, dass das verlängerte Mark angegriffen wird, usw.
Da sich indessen die Wirkung augenblicklich zeigen kann, ehe ein Verzehren stattgefunden hat, muss sie vielmehr als ... seelisch betrachtet werden; wird doch die Blausäure in der Medizin als beruhigendes Mittel in sogenannten nervösen Krankheiten gebraucht.
Alles, was ich von dem Seelenzustand, der sich nun zeigt, sagen möchte, ist dies:
Es ist nicht ein langsames Erlöschen, es ist vielmehr eine Auflösung, in der das Angenehme die unbedeutenden Schmerzen überwiegt.
Der innere Sinn gewinnt an Klarheit, im Gegensatz zum Herannahen des Schlafes, der Wille herrscht, und ich kann das Experiment abbrechen, indem ich den Kork in die Flasche stecke, das Fenster öffne, Chlor oder Ammoniak einatme.
Nicht dass ich darauf bestehe, wenn aber der temporäre Todeszustand der Fakire durch einen Beweis bestätigt werden soll, würde das Experiment ohne Gefahr fortgesetzt werden können. Und im Fall eines Unglücks müsste man die verschiedenen Arten versuchen, mit denen man einen Scheintoten zum Leben zurückruft. Die Fakire wenden warme Umschläge auf den Gehirnhalbkugeln an; die Chinesen wärmen die Magengrube und rufen ein Niesen hervor. In seinem ausgezeichneten Buche "Le Positif et le Négatif" (Paris, Lemerre, 1890) erzählt Vial nach Trousseau und Pidoux: "Carrero erstickte und ertränkte 1825 eine grosse Anzahl Tiere, die er nachher ins Leben zurückrief, sogar lange nach ihrem Tode, indem er ihnen ganz einfach Nadeln ins Herz steckte." (Akupunktur.)
A. E. Badaire zitiert in "La Joie de mourir" (Paris, Chamuel. 194) mehrere bekannte Todesfälle, wie den des berühmten Richet, 1892, und den Hallers, bei welchen der Augenblick vor Eintritt des Todes unmöglich zu bestimmen war.
Chisac; ein Arzt in Montpellier, verdoppelt sich vor dem Tode, betrachtet sich als einen andern, stellt sich die Diagnose, fühlt sich den Puls und gibt Befehle. Darauf schliesst er die Augen, "um sie nicht mehr zu öffnen".
In "Inferno" habe ich von meinem Unglücksbruder, dem deutsch-amerikanischen Maler, erzählt, dessen Doppelgänger, der deutsch-amerikanische Arzt Francis Schlatter sein sollte. Jetzt ist der Augenblick gekommen, da ich genötigt bin, meinen Freund blosszustellen, in der einzigen Absicht, zur Erforschung des wahren Sachverhalts beizutragen.
Mein Freund hiess H.; gleichviel ob es sein wirklicher Name war oder ob er den angenommen hatte.
Nachdem ich im August 1897 nach Paris zurückgekehrt war, blätterte ich eines Tages in der Revue spirite von 1859. Da stiess ich auf einen Aufsatz mit der Überschrift: Mein Freund H.
Unter demselben Titel hatte ein Herr H. Lugner im Feuilleton des Journal des Debats vom 26. November 1858 eine Geschichte veröffentlicht, die er als tatsächlich hinstellt und der er selbst persönlich beigewohnt haben will, da er, wie er äussert, dem Helden dieses Abenteuers in Freundschaft verbunden war. Der Held war ein fünfundzwanzigjähriger junger Mann von untadeligen Sitten und unerschütterlicher Herzensgüte.
H. konnte nicht wach bleiben, sobald die Sonne untergegangen war. Eine unüberwindliche Mattigkeit beschlich ihn und er sank allmählich in einen festen Schlaf, den nichts abwenden konnte.
Kurz: H. lebte ein doppeltes Dasein; nachts war er in Melbourne als Verbrecher unter dem Namen William Parker tätig, der auch seiner Zeit hingerichtet wurde. Gleichzeitig fand man H. in Deutschland tot in seinem Bett.
Mag sie nun wahr oder nur eine Ausgeburt der Einbildung sein, diese Geschichte interessiert mich, weil der Name H. darin vorkommt und die Umstände auf eine offenbare Weise zusammenfallen.
Die Literatur der Gegenwart hat sich bereits mit der Erscheinung des Doppelgängers befasst: in dem bekannten Roman "Trilby" und in einem Stück von Pauls Lindau. Es wäre interessant zu wissen, ob die Verfasser nach der Natur gearbeitet haben oder nicht.
Wir kehren zu unserm Freund Martin zurück.
Nach einem langen Winter näherte sich der Frühling mit fehlgeschlagenen Hoffnungen. Der arme Doktor, der sich auf das Versprechen seiner Vorgesetzten verliess, das man ihn zum Dozenten berufen werde, erhielt einen schweren Stoss, als die Ernennung aufgeschoben wurde. Er musste bis zum Herbst warten, obwohl er wissenschaftliche Verdienste genug besass. Das war eine Schmach die ihn zur Verzweiflung brachte; indem er sein Pech verfluchte, stürzte er sich in Ausschweifungen, ohne jedoch sein Nüchternheitsgelübde zu brechen.
Genug, er ist Junggeselle, und eines Abends sucht er ein Mädchen, das einen Burschen sucht. Und er verlässt sie. Die Dirne war ihm unbekannt und wohnte in einem zweideutigen Viertel am Aussenrand der Stadt. Die Sache war durchaus nicht verwickelt, und er erwartete keine weiteren Folgen davon.
In der Dämmerung des nächsten Abends ist er in seinem Elternhaus mit seinen Arbeiten beschäftigt, als ein Lärm von draussen seine Aufmerksamkeit erregt.
Er öffnet das Fenster und gewahrt unten in seinem Garten eine Stiege Jungen zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren. Da nichts zum Stehlen da ist, kann er sich die Anwesenheit einer Menge Leute in diesem Ort und zu so ungeeigneter Stunde nicht erklären. Die Schlingel trampeln dort unten herum, ohne dass die Veranlassung zu erkennen wäre. Er glaubt einem Blendwerk ausgesetzt zu sein, aber da ruft ihn seine Mutter. Als er herunterkommt, wird er von seiner Mutter gebeten, hinauszugehen und sich nach den Absichten der Eindringlinge zu erkundigen.
Als er auf den Hof tritt, erblickt er ein junges Weib, das wie ein Spalier an der Wand steht. Er geht näher, um den Zusammenhang zu ermitteln, der nach der schlimmen Seite zu neigen scheint. Vor dem Weibe angelangt, erkennt er das Mädchen von gestern; da er das Opfer eines Erpressungsversuchs zu sein glaubt, ruft er wütend:
—Was haben Sie hier zu tun? Gehen sie Ihrer Wege!
Ohne ein Wort zu sagen, begibt sich das Mädchen zur Pforte, und ohne irgendwie zu zeigen, dass sie den erkannt hat, der mit ihr gesprochen hat. Sie war offenbar nicht gekommen, um ihn zu schikanieren.
Aber im selben Augenblick und in Gegenwart seiner Mutter stürzen die zwanzig Strassenjungen aus dem hinteren Teile des Hofes hervor, umringen den Doktor und das Mädchen und zeigen mit den Fingern auf die beiden Unglücklichen, überhäufen sie mit groben Schimpfworten und lassen verstehen, dass sie die beiden in einer gewissen Situation überrascht haben.
Der Doktor, vernichtet vor Scham, sich in Gegenwart seiner Mutter skandalisiert zu sehen, beteuert ihr, dass er unschuldig sie, obgleich er auf frischer Tat ergriffen zu sein scheint.
Welche peinliche Szene für einen Sohn!
Als er mir dies Abenteuer erzählte, das mir wie ein böser Traum vorkam, unwahrscheinlich in seiner ungerechten Grausamkeit, sah der arme Doktor erbärmlich aus.
—Das ist ja der Teufel selbst, nicht wahr! Unschuldig an einer Sache sein, die übrigens keinen etwas angeht, und dann öffentlich auf diese Weise hingerichtet werden!
—Ja, der Vorfall erscheint mir dunkel. Das ist ja unglaublich! Zwanzig Jungen, die auf einen Hof kommen, ein liederliches Weib, dem nichts an der Ehre gelegen sein kann und das sich nicht zu rächen sucht! Was bedeutet das? Eine Lektion! Es ist deutlich, dass die Mächte in der Sittlichkeit strenger werden. Und wie modern sie geworden sind! Keine Träume, keine Geschichte, da die Leute sich an so etwas nicht mehr kehren. Nein, statt dessen ganze Inszenierungen von vollendeten Realismus, Dinge zum Anschauen ausgebreitet, bei denen man mit Räsonnement nicht weit kommt.
—Du glaubst also, dass es ein Verweis war. Aber, wenn ich dir sage, dass ich ohne Schuld war, wirklich unschuldig.
—Unschuldig gestern, ja, aber nicht am Tage vorher!
—Jedenfalls war es kein Komplott, da das Mädchen mich ja nicht erkannte. Ein teuflischer Zufall....
—Ja, aber ein Zufall, dessen Fäden von einer Meisterhand geflochten waren!
Um sich etwas Zerstreuung zu verschaffen, unternahm mein Freund Martin eine Rundreise nach Norrland und Norwegen; er erwartete davon ein wirkliches Gefühl von Freiheit und viel Vergnügen.
Nach einigen Wochen begegnete ich Freund Martin auf einer Strasse in Lund.
—Hast du eine schöne Reise gehabt?
—Eine teuflische Reise! Jetzt weiss ich nicht mehr, was man glauben soll. Es gibt ganz gewiss jemand, der mich herausfordert, und der Streit ist ungleich. Höre nur! Ich kam nach Stockholm, um mich auf der grossen Ausstellung zu amüsieren, und obgleich ich in der Stadt fast hundert Freunde habe, traf ich nicht einen einzigen. Alle waren auf dem Lande! Allein!—Ich wohne einen Tag in meinem Zimmer und werde dann von einem andern hinausgeworfen, dem mein Bruder aus Versehen ein älteres Versprechen gegeben hat. Das Pech macht mich so stumpfsinnig, dass ich nicht in die Ausstellung gehe, und als ich mich—auf den Strassen herumtreibe, schliesse ich mich einem Mädchen an. In diesem Augenblick fällt eine schwere Hand auf meine Schulter nieder, und ein Onkel, sehr ernst angelegt, den ich nicht mehr als zweimal in meinem Leben gesehen habe, dem ich zuletzt von allen hätte begegnen mögen, ladet mich ein, den ganzen Abend mit ihm—und seiner Frau zusammen zu sein!
Alles, vor dem mir ekelt, muss ich schlucken! Das ist verhext!—Weiter, tausend Kilometer—allein!—in einem Eisenbahnwagen durch eine tödlich langweilige Landschaft.
Am Oreskutan, dem hauptsächlichen Ziel meiner Exkursion, gab es nur ein einziges Hotel, und in diesem Hotel hatten alle meine Antipathien sich zusammengefunden. Der Chef der Freikirchlichen weidete die Herde, und man sang Psalmen morgens, mittags und abends. Man hätte wütend werden können, aber es ging ganz natürlich zu. Nur eine Sache erscheint mir immer noch etwas wunderbar—hm! okkult! Nämlich dass man in diesem ruhigen und geordneten Hotel des Nachts Warenkisten zunagelte!
—Über deinem Kopf?
—Ja! Und sonderbar war, dass dieses Nageln mich nach Norwegen verfolgte. Wenn ich eine Erklärung vom Hotelwirt verlangte, behauptete er nichts gehört zu haben.
—Das ist ja ganz wie mit mir!
—Ja, es ist wie mit dir! Was mir aber in Christiania passierte, übertrifft alles, was meine schlimmsten Feinde hätten ausfindig machen können. Ich kenne viele Leute in Christiania, sie waren noch in der Stadt und ich konnte doch nicht einen einzigen treffen! Allein, immer allein!
Wie ich im Café des Grand Hotel so allein sitze, werde ich von einem jungen Mann angesprochen, der an einem Nebentisch sitzt. Glücklich, eine Gelegenheit zu finden, meine eigene Stimme wieder hören zu können, antworte ich, gegen meine Gewohnheit in solchen Fällen. Da er wohlerzogen aussah und es sich mit ihm sprechen liess, lud ich ihn schliesslich ein, mir Gesellschaft zu leisten.
Wir bringen den Abend zusammen zu. Ich muss zugeben, dass mir der junge Mann nach einigen Stunden den unbestimmten Argwohn einflösste, er sei nicht der, für den er sich ausgab. Er widersprach sich selbst und redete ohne Zusammenhang, und ich wusste nicht, wo ich ihn unterbringen sollte.
Schliesslich gegen Nacht, blieb ein norwegischer Freund, den ich drei Jahre nicht gesehen hatte, vor unserm Tisch stehen; er begrüsst mich mit einer pfiffigen Miene, die diesem ernsten Charakter ganz fremd war, und schielt nach meinem Begleiter. Darauf lacht er und schleudert mir eine Beschimpfung ins Gesicht, indem er sich stellt, als glaube er, mein Kamerad stehe in einem Verhältnis unnatürlicher Intimität zu mir. Auf meine Proteste antwortet er nur, indem er wiederholt:
—Genieren Sie sich nicht! genieren Sie sich nicht! Hier ist man wie bei sich zu Hause und braucht sich nicht zu genieren.
Was sollte ich sagen? Was sollte ich tun?
Der junge Mann wurde nicht böse, und da warf der norwegische Freund, der wohl ein Glas zu viel im Kopfe hatte, folgenden Einfall hin, vielleicht ganz ohne Hintergedanken:
—Übrigens ist nichts Böses dabei; das ist ein verkleidetes Weib.
Da steht der junge Mann auf und macht, mitten im Café, das vollgepfropft von Leuten war, eine Gebärde, wie um das Gegenteil zu beweisen.
—Das geht über alle Grenzen!
—Es ist ungeheuerlich, und es ist Wahrheit! Und niemand erhebt dagegen Protest; man lacht nur! Aber es ist noch nicht zu Ende! Im selben Augenblick, wie ich aufbrechen will, bittet der unbekannte Jüngling mich, ihm Geld zu leihen. Beschimpft, kochend vor Entrüstung, kann ich jedoch nicht nein sagen, da ich aber kein Wechselgeld habe, gehe ich ans Büffet, von dem Fremden begleitet. Stelle dir die Szene vor, wie ich diesem verdächtigen Schlingel, der aussieht, als bekomme er seine Bezahlung, Geld gebe. Ein alter Lehrer aus Lund, der hinter uns beiden stehen geblieben ist, fixiert mich mit einem Blick, der Gewissheit über den abscheulichen Argwohn ausdrückt. Das ist schön!
—Weisst du was: Ich muss bei dem, was du eben erzählt hast, an gewisse Märchen von Hoffmann denken. Und als ich neulich wieder einmal die "Elixiere des Teufels" las, kam es mir vor, als beruhten die Phantasien des deutschen Dichters auf erlebten Begebenheiten.
—Bald kann man alles Mögliche glauben!—Aber nun die moralische Seite der Sache? Ist eine Vernunft darin, mich vor einem Freund, vor einem ganzen Publikum in falsches Licht zu stellen! Was sollte denn bestraft werden?
—Man darf nicht auf die Mächte böse werden, weil sie sich solcher Massregeln bedienen. Glaubst du, ich tat Schritte, die falschen Gerüchten zu dementieren, die von einem deutschen Schriftsteller verbreitet wurden, als er mich unnatürlicher Instinkte beschuldigte: Nein! Ich verfluchte ihn damals, aber seitdem überwache ich meine Sinnlichkeit. Übrigens hat Swedenborg mich gelehrt, dass solche Bestrafungen, die ohne Unterschied zugefügt werden zu dem Zweck auferlegt werden, uns die Märtyrerschaft schmecken zu lassen, die wir selbst unschuldigen Menschen durch schändliche Verleumdungen und leichtsinnige Äusserungen verursacht haben.
—Mag sein, aber ich werde in den Gedanken meines Freundes immer mit dem Stempel des Lasters gezeichnet sein, und ich werde niemals diese seine Ansicht ausroden können.
—Das ist unangenehm, aber es ist nun einmal so!
Diese banalen und an sich widerwärtigen Geschichten hätte ich wahrhaftig nicht erzählt, wenn sie nicht durch ihre Ungereimtheit den Gedanken auf das Dasein einer Realität leiteten, die nicht reell ist und nicht Vision, sondern eine Phantasmagorie, hervorgerufen von den Unsichtbaren in dem bestimmten Zweck, zu warnen, zu lehren, zu strafen.
Dieser Zustand, von den Theosophen die Astralebene genannt, wird von Swedenborg, Arcana, letzter Teil, also geschildert:
"Visiones und Visa."
"Es gibt zwei Arten Gesichte, die ausserordentlich sind, in welche ich versetzt worden bin, bloss um zu wissen, wie es sich mit ihnen verhält, und was darunter zu verstehen ist, was man im WORT liest: dass sie vom Körper entzückt wurden und dass sie vom Geist fortgeführt wurden nach einem anderen Ort.
1. Der Mensch wird in einen Zustand versetzt, der mitten zwischen Schlaf und Wachen ist; und wenn er in diesem Zustand ist, kann er nicht anders wissen, als dass er vollkommen wach sei. Das ist der Zustand, von dem gesagt wird: entzückt werden vom Körper, und in dem man nicht weiss, ob man im Körper ist oder ausserhalb des Körpers.
2. Durch die Strassen einer Stadt und über Feld wandernd, auch da in Gespräch mit Geistern, wusste ich nicht anders, als dass ich so wach und sehend war, wie bei andern Gelegenheiten; so wanderte ich, ohne vom Wege abzuweichen, und inzwischen war ich in einem Gesicht und sah Haine, Flüsse und Paläste, Häuser, Menschen und anderes; nachdem ich aber so einige Stunden gewandert, war ich plötzlich in dem Gesicht des Körpers, und wurde gewahr, dass ich mich höchlich wunderte, und ich merkte, dass ich in einem solchen Zustand gewesen war wie die, von denen gesagt wird, dass sie vom Geist fortgeführt wurden an einen andern Ort."
Freund Martin wohnt nach der Rückkehr von seiner Vergnügungsreise allein im Elternhaus, weil die Familie sich nach verschiedenen Seiten zur Sommerfrische zerstreut hat. Ich will nicht behaupten, dass er ängstlich ist, aber er fühlt sich unbehaglich. Zuweilen hört er Schritte und andere Laute von dem Zimmer seiner abwesenden Schwester, bisweilen Niesen.
Vor einigen Tagen hörte er mitten in der Nacht einen knirschenden Laut, wie von einer Sense, die geschärft wird.
—Alles in allem, schloss er, es gehen sonderbare Dinge vor, aber im selben Augenblick, in dem ich mich mit den Mächten in Unterhandlungen einlassen würde, wäre ich verloren.
Das war sein letztes Wort, und da näherte sich der Herbst mit grossen Schritten.
Während sich dieses im täglichen Leben zutrug, setzte ich meine Schwedenborgstudien fort. Seine Arbeiten, deren schwer habhaft zu werden ist, fielen mir in die Hände, eine nach der andern, in recht grossen Zwischenräumen.
In den "Arcana Coelestia" ist es die Hölle für ewige Zeit, ohne Hoffnung auf ein Ende, von jedem Wort des Trostes entblösst. "Apocalypsis revelata" führt die Bussordnung aus, und zwar mit der Wirkung, dass ich bis zum Frühling unter ihrem Banne lebte. Bisweilen schüttelte ich ihn ab, indem ich mir eine Hoffnung einrede, dass der Prophet sich in den Einzelheiten getäuscht hat, und dass der Herr des Lebens und des Todes sich barmherziger erweisen wird. Was sich aber nicht verhehlen lässt, ist die in die Augen fallende Übereinstimmung zwischen Swedenborgs Visionen und allen grossen oder kleinen Begebenheiten, die mich und meine Freunde während dieses Schreckensjahres betroffen haben.
Erst im März finde ich bei einem Antiquar die "Wunder des Himmels und der Hölle" und nachher "Von der ehelichen Liebe". Erst dann werde ich von dem Alp befreit, der mich seit der ersten Offenbarung der Unsichtbaren heimgesucht hat.
Gott ist die Liebe; er regiert nicht über Sklaven, und deshalb hat er die Sterblichen sich eines freien Willens erfreuen lassen. Es gibt keine Mächte der Bosheit, sondern ein Diener des Guten versieht das Amt eines Zuchtgeistes. Die Strafen sind nicht ewige, es steht einem jeden frei, geduldig zu sühnen, was er verbrochen hat.
Die Leiden, die uns auferlegt werden, haben die Besserung des Ichs zum Zweck.
Die Verfahren, welche die Vorbereitung zu einem geistlichen Leben bilden, beginnen mit Verwüstung (vestatio) und bestehen aus Brustbeklemmungen, Atemnot, Erstickungssymptomen, Herzstörungen, Angstanfällen, Schlaflosigkeit, Alpdrücken. Diese Prozedur, der Swedenborg in den Jahren 1744 und 45 ausgesetzt war, wird in den "Träumen" geschildert.
Und die Diagnose dieses Krankheitszustandes entspricht in jedem Punkt den jetzt üblichen Affektionen, so dass ich nicht vor dem Schlusssatz zurückschrecke: wir befinden uns vor einer neuen Ära, in der "die Geister erwachen und es eine Lust ist zu leben". Diese angina pectoris, der Fall der Schlaflosigkeit, all die nächtlichen Schauder, die den Gemütern Schrecken einjagen und welche die Ärzte gern als Epidemien bezeichnen wollen, sind weiter nichts als die Arbeit der Unsichtbaren. Wie kann man das für eine epidemische Krankheit erklären wollen, dass gesunde Menschen systematisch von unvorhergesehenen, sonderbaren Begebenheiten, von Unruhe und Verdriesslichkeiten verfolgt werden? Eine Epidemie zusammentreffender Umstände? Das ist ja ein Unsinn!
Swedenborg ist mein Vergil geworden, der mich durch die Hölle geleitet, und ich folge ihm blind. Wohl ist er ein furchtbarer Strafer, aber er versteht auch ebenso gut zu trösten, und er kommt mir weniger streng vor als die protestantischen Pietisten.
"Ein Mann kann Reichtümer häufen, wenn er es nur auf ehrliche Weise tut und ebensolchen Gebrauch von ihnen macht; er kann sich kleiden und wohnen nach seinen Verhältnissen; mit Leuten von gleicher gesellschaftlicher Stellung verkehren, des Lebens unschuldige Freuden geniessen, froh und zufrieden aussehen und nicht wie ein mürrischer Mensch mit blassem Gesicht; er kann mit einem Wort leben und auftreten wie ein reicher Mann in dieser Welt und nach seinem Tode gerade hinein in den Himmel gehen, wenn er nur in seinem Innern Glauben an Gott und Liebe zu ihm besitzt und sich seinem Nächsten gegenüber so benimmt, wie es seine Pflicht ist."
"Ich habe mich mit mehreren von denen unterhalten, die, ehe sie starben, der Welt entsagt und sich in die Einsamkeit zurückgezogen hatten, um dort ein Leben zu leben, das der Betrachtung der himmlischen Dinge gewidmet war, und so sich einen sicheren Weg zum Himmel zu bahnen; beinahe alle hatten ein düsteres und schwermütiges Aussehen, schienen verdriesslich darüber zu sein, dass die anderen ihnen nicht glichen und dass sie selbst nicht mit grösserer Ehre und einem glücklicheren Los belohnt worden waren; sie wohnen an verborgenen Orten und leben dort als Einsiedler beinahe auf gleiche Weise, wie sie in unserer Welt gelebt hatten. Der Mensch ist geschaffen, in Geselligkeit zu leben; in der Gemeinschaft und nicht in der Einsamkeit findet er zahlreiche Gelegenheiten, Christenmilde gegen den Nächsten zu üben...."
"Im einsamen Leben sieht man nur sich selbst, man vergisst alle anderen; daher kommt es, dass man bloss an sich selbst denkt, an die Welt nur, um sie zu fliehen oder sie zu vermissen, was das Gegenteil von christlicher Liebe ist."
Was die sogenannten ewigen Strafen betrifft, so tritt der Seher im letzten Augenblick als Erlöser auf, indem er uns einen Strahl von Hoffnung aufschimmern lässt.
"Die unter ihnen, für die man auf Erlösung hoffen kann, werden an verwüsteten Stellen ausgesetzt, die nur ein Bild von Trostlosigkeit bieten; und man lässt sie dort zurückbleiben, bis ihre Trauer darüber, sich dort zu befinden, sie auf die Höhe der Verzweiflung gebracht hat, weil das die einzige Art ein dürfte, das Böse und Falsche, das sie beherrscht, zu meistern. So weit gelangt, schreien sie, dass sie nicht besser sind als Tiere, dass sie voll sind von Hass und allerhand Greuel und dass sie Verdammte sind; man verzeiht ihnen das als Schreie der Verzweiflung, und Gott mildert ihren Sinn, damit sie sich nicht in Vorwürfen und Schmähungen ergiessen über die Grenzen hinaus, die festgestellt sind. Wenn sie alles gelitten haben, was gelitten werden kann, so dass ihr Körper gleichsam tot ist, bekümmern sie sich nicht darum, und man bereitet sie zur Erlösung. Ich habe einige von ihnen zum Himmel fortführen sehen, nachdem sie mit all den Leiden, von denen ich gesprochen habe, geprüft worden waren. Als sie dort eingelassen wurden, legten sie eine grosse Freude an den Tag, dass ich davon bis zu Tränen gerührt wurde."
Was die Katholiken conscientia scrupulosa, Gewissenszartheit, nennen, leitet seine Herkunft von böswilligen Geistern her, welche die Gewissensqual um nichts und wieder nichts erwecken. Es macht ihnen Freude, so eine Last auf das Gewissen zu legen, und dieses Verhalten hat nichts mit der Besserung des Sünders zu tun.
Ebenso gibt es ungesunde Versuchungen. Böswillige Geister rufen in der Tiefe der Seele all das Böse hervor, das sie seit der Kindheit begangen hat, und zwar so, dass es nach der schlimmen Seite verdreht wird. Aber die Engel entschleiern, was sich von Gutem und Wahrem bei dem Gemarterten findet. Das ist der Streit, der sich unter dem Namen Gewissensqual offenbart.
Ich bleibe hier stehen, weil ich meinem Meister unrecht tun würde, wenn ich das zerrisse, was er so gut zusammengewebt hat, und die Fetzen als Probestücke vorzeigte.
Swedenborgs Werk ist unermesslich umfassend, und er hat mir auf alle meine Fragen geantwortet, wie pochend sie auch gewesen sein mögen.
Unruherfüllte Seele, leidendes Herz, nimm und lies!
Von den geheimnisvollen Verfolgungen ermattet, habe ich schon längst eine sorgfältige Prüfung meines Gewissens vorgenommen; getreu meinem neuen Programm, mir selbst dem Nächsten gegenüber unrecht zu geben, finde ich mein verflossenes Leben abscheulich, und Ekel erfasst mich vor meiner eigenen Persönlichkeit. "Es ist Wahrheit, dass ich die Jugend in Harnisch gebracht habe gegen das Bestehende, gegen Religion, Gesetze, Obrigkeit, Sittlichkeit. Es ist meine Gottlosigkeit, die jetzt bestraft worden ist, und ich nehme zurück."
Nach einer Pause im Gedankengang kehre ich dann die Frage um, indem ich das Gegenteil aufstelle, und ich frage: "Und die anderen, die Gegner meiner umstürzenden Ansichten, die frommen Verteidiger der Sittlichkeit, des Staates, der Religion, können die denn nachts schlafen, haben die Mächte denn ihnen Erfolg in ihren weltlichen Angelegenheiten geschenkt?"
Wenn ich einer Musterung der Stützen der Gesellschaft und ihrer Geschicke anstelle, bin ich genötigt zu antworten: nein!
Der tapfere Vorkämpfer für das Ideale in Poesie und Leben, ein Dichter für die zuverlässigen und guten Mitbürger, er kann des Nachts nicht schlafen, weil er von der grossen Hysterie betroffen ist; die weckt ihn mit Anfällen, die man Clownssprung und Schwibbogen nennt und in der Salpétrière bekannt sind. Auch liess ihn sein Schutzgeist im Stich, und der Dichter geriet in Schwierigkeiten, als er sich vor einigen Jahren auf geschäftliche Spekulationen einliess; die hätten ihn beinahe in eine entblösste Lage gebracht. Es ist mir keine Freude, daran zu erinnern, denn es vergrössert nur meinen Kummer, wenn ich sehe, wie die erhabenen Bestrebungen nur um Zusammenbruch führen.
Und meine Gegner in der Religion? Der mich einmal ins Gefängnis bringen wollte für Lästerungen, ist selbst in Haft genommen wegen betrügerischen Bankerotts. Glaube nun nicht, mein Leser, dass ich meine Lästerungen mit seinem Verbrechen entschuldige! Ich bin betrübt, nicht mehr an die reinigende Aufgabe des Christentums glauben zu können, angesichts eines so niederschlagenden Beispiels.
Und dann diese Frau, welche die Sittlichkeit unter den Schatten ihrer Flügel nahm, die Freundin der unterdrückten Frauen, die Prophetin, die in feurigen und aufrichtigen Vorträgen den jungen Männern das Cölibat predigte?
Wo ist sie geblieben? Niemand weiss es, aber auf ihrem Haupte lastet eine Anklage, die auf schauderhafte Dinge hinausläuft. Erbaulich, nicht wahr?
Was die anderen Stützen der moralischen und religiösen Ordnung betrifft, so übergehe ich sie, sei es, dass sie sich eine Kugel vor die Stirn geschossen oder aus Furcht vor unglücksbringendem Verhör das Feld geräumt haben.
Kurz, das Gericht scheint die Gerechten wie die Ungerechten zu treffen, ohne Unterschied, und der eine mag ebenso gut sein wie der andere!
Was ist es denn, was sich heute in der Welt zuträgt?
Ist es das Gericht, das unerbittlich über Sodom ausgesprochen wurde?
Müssen alle vergehen: gibt es keinen Gerechten? Nicht einen!
Mögen wir dann Freunde sein und gemeinsam leiden, als Mitschuldige und ohne uns über einander zu erheben.
Ich habe Abbitte getan für meine tadelnswerten Handlungen, und ich verleugne meine Vergangenheit. Lasst mich nun ein Wort zur Selbstverteidigung sagen.
Die Jugend ist zu jeder Zeit aufrührerisch, leichtfertig, ausschweifend gewesen; bin ich es da, der die Empörung, das Laster erfunden hat? Vorher war ich der Junge, der Verführte, das Kind meiner Zeit, der Schüler meiner Lehrmeister, das Opfer der Verführungen. Wer hat die Schuld, und warum hat man mich zum Sündenbock gemacht? Angenommen, es war eine Lüge, und ich bin nicht der, für den die Menschen mich halten.
Da legt die schwarze Magie sich in die Wagschale!
Aber es geschah aus Unwissenheit, dass ich sie versuchte.
Dann aber die Erhebung gegen die Unsichtbaren?
Jawohl, die Erhebung! Doch die andern, die ihr Leben auf den Knien zubrachten, unter Anbetung und Selbstverleugnung, und die alle desavouiert worden sind!
Geben wir zu, dass die Lage verzweifelt ist! Und dass wir alle dem Weltfürsten überliefert sind, um in den Staub gebeugt und erniedrigt zu werden, auf dass wir uns vor uns selber ekeln, auf dass wir Heimweh nach dem Himmel empfinden! Selbstverachtung, Entsetzen vor der eigenen Persönlichkeit, gewonnen durch die vergeblichen Anstrengungen, sich zu bessern: das ist der Weg zu einem höheren Dasein.
Und behalte noch eine Sache im Gedächtnis: der Weg nach Rom, der Kaiserweg, führte durch Canossa!
Trotz aller Marter, die ich ausgestanden habe, hält sich der Geist des Aufruhrs aufrecht und redet mir Zweifel ein, ob die Absichten meines unsichtbaren Wegführers wohlwollend sind.
Ein Zufall (?) hat mir die "Zauberflöte", Schikaneders Operntext, in die Hand gegeben. Die Prüfungen und Versuchungen des jungen Paares flössen mir den Gedanken ein, dass ich mich von den verleitenden Stimmen habe täuschen lassen; da ich die Mühen und Leiden nicht habe aushalten können, habe ich mich gekrümmt und sei unterlegen.
Sogleich erinnere ich mich an Prometheus, der immer die Götter anspeit, während der Geier seine Leber zerfleischt. Und zuletzt wird der Aufrührer, ohne öffentliche Abbitte zu leisten, in den Kreis der Olympischen aufgenommen.
Das Feuer ist jetzt angezündet, und sogleich tragen die bösen Geister Nahrung herbei.
Eine okkultistische Zeitschrift, die mit der Post gekommen ist, muntert meinen kleinmütigen Sinn auf, indem sie mir nur Umsturz-Lehren wie diese vorlegt.
"Wie man weiss, wird in den alten Vedabüchern die Schöpfung als eine einzige grosse Opferhandlung betrachtet, wo Gott, Priester und Opfer, sich selbst opfert, indem er sich teilt."
(Da haben wir ja meine Idee, die ich in dem Mysterium ausgedrückt habe, das ich "Inferno" voranstellte.)
"Alle Elemente, die zusammen das Weltall bilden, sind nichts anders als gefallene Gottheitspersonen, die durch das Stein-, Pflanzen-, Tier-, Menschen- und Engelreich wieder zu den Himmeln aufsteigen, um aufs neue herabzufallen."
Diese Idee, welche der berühmte Alexander von Humboldt wie der Historiker Cantü als erhaben bezeichneten....
(Ja, sie ist erhaben!)
"Wie man weiss, waren die Götter von Griechenland und Rom Menschen gewesen. Jupiter selbst, der grösste von allen, war auf Kreta geboren, wo er von der Ziege Amalthea gesäugt wurde. Er stiess seinen Vater vom Thron und traf alle Vorsichtsmassregeln, um nicht selbst entthront zu werden. Beim Angriff der Giganten, als die meisten der Götter ihn feige im Stich liessen und sich in Ägypten verbargen, indem sie Pflanzengestalten annahmen, hatte er das Glück, mit Hilfe der Tapfersten Sieger zu bleiben. Aber es war auch mit genauer Not."
"Bei Homer kämpfen die Götter gegen die Menschen und werden bisweilen verwundet. Unsere gallischen Vorväter stritten auch gegen den Himmel und schossen Pfeile gegen ihn ab, wenn sie sich von dort bedroht glaubten."
"Die Juden wurden von denselben Gefühlen belebt wie die Heiden. Wie sie ihren Jehova (Gott) hatten, so hatten sie auch Elohim (die Götter). Die Bibel beginnt also:
"Und er der ist, der war und der sein wird
Die Götter
Die Einheit in der Mehrzahl."
"Als Adam diese ewig gesegnete Sünde begangen hatte, die, weit entfernt ein Fall zu sein, ein erhabener Schritt nach der Höhe war, wie die Schlange vorausgesagt hatte, sagte Gott: "Siehe Adam ist geworden wie einer von uns und weiss, was gut und böse ist." Und er fügte sogleich hinzu: "Nun aber, auf dass er nicht seine Hand ausstrecke und nehme desgleichen vom Baum des Lebens, und esse, und lebe ewiglich...."
"Die Alten sahen also in den Göttern Menschen, die sich zu höchsten Machthabern aufgeschwungen hatten und durch einen Staatsstreich den Besitz der Macht zu behalten suchten, indem sie andere hinderten, sich ihrerseits aufzuschwingen. Daher kam der Streit von seiten der Menschen, um die Usurpatoren fortzujagen, und deren Widerstand, um sich die unrechtmässig angeeignete Macht zu bewahren."
Und da haben wir die Schleuse geöffnet.
—Denkt, wir sind Götter!
"Und die Söhne der Götter stiegen zur Erde nieder und ehelichten die Töchter der Sterblichen, und die gebaren Kinder. Und aus dieser Mischung stammten die Riesen her und alle berühmten Männer, Krieger, Staatsmänner, Schriftsteller, Künstler."
Das war eine gute Aussaat in ein aufsässiges Gemüt, und das Ich bläst sich von neuem auf: denkt, wir sind Götter.
Am selben Abend, als die Stimmung im Wirtshaus hoch ging, bildet man einen Kreis um einen Doktor der Musik.
Mein Freund, der Philosoph, dem ich die Entdeckung unserer Verwandtschaft mit den Göttern mitgeteilt habe, bittet Mozarts "Don Juan" hören zu dürfen, vor allem das Finale des letzten Aktes.
—Wovon handelt das? fragt einer, der nicht im klassischen Repertoire zu Hause ist.
—Der Teufel kommt und holt den Wüstling!
Und die höllischen Qualen, die Mozart so gut schildert, da er Gewissensbisse dieser Art gekannt haben dürfte, denn der Mann einer Frau, die er verführt hatte, beging seinetwegen Selbstmord,—die höllischen Qualen werden aufgerollt in jammererfüllten Tonfolgen wie eine schneidende Neuralgie. Das Lachen verstummt, die Spötteleien hören auf, und als das Stück zu Ende ist, herrscht ein ängstliches Schweigen.
—Nein, Prosit!
Man stösst an! Aber die Munterkeit ist fort, die olympische Stimmung ist erloschen, denn die Nacht ist im Anzuge, und die grauenhaften chromatischen Tonfolgen hallen wider gleich unermesslichen Wogen, die steigen und fallen
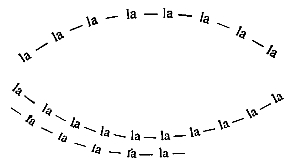
und das Menschenwrack hinauf in die Luft schleudern, um es im nächsten Augenblick zu ertränken.
Während die Abkömmlinge der Götter vergebliche Anstrengungen machen, eine ihrer hohen Geburt entsprechende Art anzunehmen, ist die Nacht hereingebrochen und das Restaurant wird geschlossen. Man muss aufbrechen und gehen ein jeder nach seinem einsamen Bett. Als man an der Domkirche vorbeiging, die in die Schatten der Nacht eingehüllt war, brach ein Blitz hervor und warf einen weissen Schein au die Fassade, wo Heilige und Verdammte vor dem Throne des Lammes knien.
—Was war das?
Denn es war kein Gewitter!
Man schauerte zusammen und blieb stehen.
Es war der Momentphotograph, der in seinem Laden bei Magnesiumblitzen arbeitete.
Man wird ärgerlich über seine Furchtsamkeit, und ich für meinen Teil kann eine Erinnerung an die Theaterblitze bei der Fortführung Don Juans nicht unterdrücken.
Als ich in mein Zimmer trat, bekam eine zugleich eisige und erhitzende Angst Macht über mich. Und als ich den Überrock ausgezogen habe, höre ich, wie sich die Garderobentür von selbst öffnet.
—Ist jemand da?
Keine Antwort! Der Mut sinkt mir, und einen Augenblick fühle ich Lust, wieder hinaus zu gehen und die Nacht auf den schmutzigen dunklen Strassen zuzubringen. Aber Müdigkeit und Verzweiflung drücken mich nieder, und ich ziehe vor, in einem schönen Bett zu sterben.
Während des Auskleidens sehe ich einer schweren Nacht entgegen, und glücklich im Bett, nehme ich ein Buch, um mich zu zerstreuen.
Da fällt meine Zahnbürste vom Waschtisch auf den Boden herab! Ohne sichtbare Ursache. Weiter und unmittelbar danach hebt sich der Deckel von meinem Eimer und fällt mit einem Knall wieder zu. Und zwar vor meinen Augen, ohne dass eine Erschütterung stattgefunden haben könnte, so vollkommen still war die Nacht.
Das Weltall hat keine Geheimnisse mehr für Riesen und Genies, und doch kommt die Vernunft zu kurz vor einem Deckel, der den Gesetzen der Schwerkraft trotzt.
Und die Furcht vor dem Unbekannten lässt einen Mann zittern, der das Rätsel der Sphinx gelöst zu haben glaubte!
Ich war bange, schrecklich bange, aber ich wollte den Walplatz nicht verlassen, sondern fuhr fort zu lesen. Da fällt ein Funke oder ein kleines Irrlicht wie eine Schneeflocke von der Decke herab und erlischt über meinem Buch.
Und ich wurde nicht toll, Leser!
Der Schlaf, der heilige Schlaft, nimmt die Form des Hinterhalts an, in dem Mörder sich verbergen.
Ich wage nicht mehr zu schlafen und habe keine Kraft übrig, mich wach zu halten. Das ist ja die Hölle! Als ich die Schlummerbetäubung mich überschleichen lasse, trifft mich ein galvanischer Stoss gleich einem Donnerschlag, ohne mich jedoch zu töten.
Schleudere deine Pfeile, stolzer Gallier, gegen den Himmel, der Himmel ruht nie!
Da aller Widerstand vergeblich ist, strecke ich die Waffen, jedoch nach Rückfällen in die Widersetzlichkeit. Während dieses letzten ungleichen Kampfes geschieht es oft, dass ich Irrlichter sogar am hellen Tage sehe, aber ich schreibe die Erscheinung einer Augenkrankheit zu.
Da erhalte ich von Swedenborg eine Aufklärung über die Bedeutung dieser Flackerflammen, die ich seitdem nie mehr gesehen habe.
"Andere Geister suchen mir das Gegenteil von dem einzureden, was die Lehrgeister mit gesagt haben. Diese Widerspruchsgeister sind auf Erden Menschen gewesen, die infolge ihrer Frevelhaftigkeit aus der Gesellschaft verwiesen sind. Man erkennt ihr Nahen an einer flackernden Flamme, die sich einem vor das Gesicht zu senken scheint; sie nehmen auf dem Rücken des Menschen Platz, von wo sie sich bis in die Glieder vernehmen lassen. Sie predigen, man solle nicht glauben, was die Lehrgeister in Übereinstimmung mit den Engeln gesagt haben; man solle seinen Wandel nicht der Unterweisung anpassen, die man von ihnen genossen hat, sondern in Ungebundenheit und Freiheit leben, nach eigenem Behagen. Gewöhnlich finden sie sich ein, wenn die anderen verschwunden sind; die Menschen wissen, was sie gelten, und kümmern sich wenig um sie; lernen aber doch durch sie, was gut und böse ist, denn man erwirbt Kenntnis von der Beschaffenheit des Guten durch dessen Gegenteil."
7. Februar.
Ein Schlagregen von Steinen gegen die Fenster in meiner neuen Wohnung die ganze erste Nacht. Am nächsten Tage klärt man mich darüber auf, dass es Eissplitter gewesen sind.
12. Februar.
Aus dem Bett gezerrt, nachdem ich eine Frauenstimme gehört habe. Der heilige Chrysostomus, der Weiberhasse, gibt mir zu verstehen:
"Was ist das Weib? Der Feind der Freundschaft, die unvermeidliche Strafe, das notwendige Übel, die natürliche Versuchung, das ersehnte Unglück, die Quelle unversieglicher Tränen, das schlechte Meisterstück der Schöpfung in blendend weisser Ausstattung."
"Da schon das erste Weib einen Vertrag mit dem Teufel einging, warum sollten seine Töchter es nicht genau so machen? Geschaffen wie es ward aus einer krummen Rippe, ist seine ganze Sinnesrichtung krumm und schief geworden, geneigt nach dem Bösen!"
Gut gesagt, Sankt Chrysostomus, Goldmund!
28. Februar.
Der Buchfink zwitschert, der blaue Streifen des Meeres in der Ferne lockt und zieht mich an, aber sobald ich nach der Reisetasche greife, werde ich von den Unsichtbaren angefallen. In der Tat ist die Flucht für mich abgeschnitten; ich bin hier interniert.
Um mich zu zerstreuen, will ich anfangen an dem Buch "Inferno" zu schreiben; aber das wird mir nicht gestattet. So wie ich die Feder anfasse, ist das Gedächtnis wie ausgelöscht, und ich kann mich an nichts mehr erinnern; oder alles erscheint als Begebenheiten ohne eine Spur von Bedeutung.
2. April.
Ein deutscher Schriftsteller bittet mich um meine Meinung über Fürst Bismarck, für Rechnung einer Zeitschrift, in welcher der Kanzler allgemeiner Abstimmung unterzogen wird.
"Ich muss einen Mann bewundern, der es verstanden hat, seine Zeitgenossen so anzuführen wie Bismarck. Sein Werk soll die Einheit Deutschlands sein, und doch hat er das grosse Reich in zwei geteilt, mit einem Kaiser in Berlin und einem in Wien."
Am Abend verbreitet sich ein Duft von Jasminblüten in meinem Zimmer, ein lieblicher Friede bemächtigt sich meines Gemüts, und ich schlafe ruhig diese Nacht. (Swedenborg sagt, dass die Gegenwart eines guten Geistes, eines Engels, sich durch balsamischen Duft verrät. Die Theosophen behaupten dasselbe, aber übersetzen Engel mit Mahatma.)
5. April.
Man erzählt mir, dass ein grosses Skulpturwerk von Ebbe, ein gekreuzigtes Weib darstellend, während des Transportes nach der Stockholmer Ausstellung zerschlagen worden ist. Ein Gegenstück: meines Freundes H. Gemälde mit dem gekreuzigten Weib, das für Schulden in Beschlag genommen und in einem Hof über dem Kehrrichtkasten aufgehängt wurde. (Siehe "Inferno".)
10. April
Las allerlei. Chateaubriands "Mémoires d'outretombe". Las Cases' Tagebuch von St. Helena. Wer war Napoleon? Von wem war er eine Reïnkarnation?
Geboren in Ajaccio, einer griechischen Kolonie, die ihren Namen von Ajax herleitet. 1. Ajax, Telamons Sohn, wurde von Odysseus besiegt; wahnsinnig vor Gram, machte er die Viehherden der Griechen nieder, im Glauben, Tod unter den Feinden zu verbreiten. Eines Tages, als einer von Trojas Schutzgöttern beide Heere in eine Wolke gehüllt hatte, um die Flucht der Trojaner zu begünstigen, rief er: Hoher Gott, schenk uns das Tageslicht wieder und kämpfe gegen uns. 2. Ajax, Sohn des Oïleus, litt Schiffbruch auf der Heimfahrt von der Belagerung Trojas, rettete sich auf eine Klippe, wo er trotzig gegen die Götter schalt; zur Strafe wurde er in die Tiefe des Meeres versenkt. Ajax, den Göttern trotzend, ist eine feststehende Wendung geworden.
Napoleon kam unvermutet zur Welt auf einem Teppich, der mit Darstellungen aus der Ilias geschmückt war.
Paola a Porta sagte eines Tages zu dem jungen Napoleon: Es ist nichts von neuer Zeit bei dir; du bist ein Mann aus Plutarch.
Rousseau hatte vor Napoleons Geburt sich mit Korsika beschäftigt, dessen Einwohner ihn zum Gesetzgeber haben wollten. "Es gibt noch ein Land in Europa, in dem es möglich ist, Gesetze zu geben: das ist die Insel Korsika ... Ich habe ein Vorgefühl davon, dass einmal diese kleine Insel Europa mit Verwunderung schlagen wird."
Nordille Bonaparte hatte 1266 seine Ehre zum Pfande gesetzt für Konradin von Schwaben, den Karl von Anjou hinrichten liess.
Der Zweig Franchini Bonaparte trug in seinem Wappen drei goldene Lilien wie die Bourbonen.
Napoleon war verwandt mit Orsini. Orsini war der Name des Mörders, der ein Attentat gegen das Leben Napoleons III. unternahm. Auf drei Inseln hatte Napoleon seine schweren Tage: Korsika, Elba und St. Helena. In einer Geographie, die er in seiner Jugend niederschrieb, erwähnt er die letzte mit den beiden Worten: "kleine Insel!" (Allzu klein, leider!) Während des Krieges mit den Engländern sandte er ohne ersichtliche Veranlassung einen Kreuzer in das Fahrwasser von St. Helena.
Napoleons Tod gibt der Einbildungskraft eines Okkultisten reichen Stoff.
"Es war ein schreckliches Wetter, der Regen fiel ununterbrochen, und der Wind drohte alles wegzufegen. Der Weidenbaum, unter dem Napoleon frische Luft zu holen pflegte, war umgebrochen worden; unsere Baumpflanzungen waren mit den Wurzeln ausgerissen, umhergestreut; ein einziger Gummibaum hielt noch stand, als ein Wirbelwind ihn ergriff, ihn aufhob und in den Schmutz legte. Nichts von dem, was der Kaiser liebte, durfte ihn überleben."
Der Kranke konnte das Licht nicht vertragen; man musste ihn in einem dunklen Zimmer pflegen. Er sprang, schon sterbend, aus dem Bett, um in den Garten zu gehen.
"Krampfhafte Zuckungen über dem Nabel und im Bauche, tiefe Seufzer, Klageschreie, konvulsivische Bewegungen, die beim Todeskampfe in ein lautes und schmerzvolles Schluchzen endigen."
Noverrez, der krank geworden war, fiel in Fieberphantasie: "Er bildet sich ein, dass der Kaiser bedroht sei, und ruft nach Hilfe."
Nachdem Napoleon den Geist aufgegeben hat, breitet sich ein friedvolles Lächeln um seine Lippen, und die Leiche behält noch nach neunzehn Jahren in der Gruft diesen Ausdruck der Ruhe bei. Als man im Jahre 1840 das Grab öffnete, war der Körper vollständig erhalten. Die Fusssohlen waren weiss. (Weisse plantae pedis bedeuten nach Swedenborg: Deine Sünden sind vergeben.)
Gut erhalten waren die Hände (die linke jedoch nicht weiss), waren weich geblieben und hatten ihre schöne Form bewahrt. Der ganze Körper mattweiss: "als sähe man ihn durch einen dichten Tüll." Im Oberkiefer fanden sich bloss drei Zähne. (Ein merkwürdiges Zusammentreffen: der Herzog von Enghien hatte nur noch drei Zähne, als er füsiliert worden war. Und in Parenthese sei hinzugefügt: der Herzog von Enghien kam zur Welt nach 48stündigen Wehen. Er war schwarzblau und ohne ein Zeichen von Leben. In eine spiritusgetränkte Binde gewickelt, wird er zu nahe an ein brennendes Licht gehalten und fängt Feuer. Da erst beginnt er zu leben!)
Napoleon war im Sarge in seine grüne Uniform gekleidet. (Zauberer kennzeichnen sich durch ihre grüngefärbten Kleider.)
Chateaubriand schreibt: Napoleons Kapitänsvollmacht ist unterzeichnet von Ludwig XVI. am 30. August 1792, und der König entsagte der Krone am 10. August.
"Erkläre das wer kann. Welcher Beschützer förderte die Unternehmungen dieses Korsikaners? Dieser Beschützer war der Herr der Ewigkeit."
18. April. Ostertag.
Auf einem Feuerbrand im Kachelofen sah ich die Buchstaben J. N. R. J. (Jesus Nazarenus Rex Judaeorum.)
2. Mai.
Ich sah den Neumond und wurde froh davon.
3. Mai.
Mithin fange ich an "Inferno" zu schreiben.
Man erzählt mir, dass eine sehr bekannter Zeitungsmann plötzlich attackiert worden ist durch nächtliche Anfälle des jetzt üblichen Schlages. Und die Okkultisten setzen das in Zusammenhang mit einem rücksichtslosen Nachruf über einen verdienten Mann, der neulich verstorben ist.
Als ich Wagners "Rheingold" lese, entdecke ich einen grossen Dichter und begreife nun, warum ich das Grosse an diesem Musiker nicht verstanden habe: dessen Musik ist allein Begleitung zu seinen Textworten. Übrigens ist "Rheingold" für meine Rechnung geschrieben:
Wellgunde.
Weisst du denn nicht,
Wem nur allein
Das Gold zu schmieden vergönnt?
Woglinde.
Nur wer der Minne
Macht versagt.
Nur wer der Liebe
Lust verjagt,
Nur der erzielt sich den Zauber
Zum Reif zu zwingen das Gold.
Wellgunde.
Wohl sicher sind wir
Und sorgenfrei:
Denn was nur lebt will lieben,
Meiden will keiner die Minne.
Woglinde.
Am wenigsten er,
Der lüsterne Alp:
Alberich.
(Die Hand nach dem Golde ausstreckend.)
Das Gold entreiss' ich dem Riff,
Schmiede den rächenden Ring:
Denn hör' es die Flut—So
verfluch' ich die Liebe!
12. Mai.
Mit dumpfer Resignation habe ich fünf Monate lang Cichorienkaffee getrunken, ohne mich zu beklagen. Ich wollte sehen, ob es eine Grenze gebe für die Kühnheit einer unehrlichen Frau (die meinem Morgenkaffee kocht). Ganze fünf Monate habe ich gelitten, jetzt will ich mich des Göttertrankes mit dem berauschenden Duft erfreuen. Zu diesem Zweck kaufe ich ein Pfund der teuersten Kaffeesorte. Das war zur Mittagszeit.
Am Abend lese ich in Peladan, L'Androgyne, Seite 107: "Er erinnert sich folgender Anekdote eins alten Missionars. Am Ende seiner Missionsreise, während einer Anfangspredigt von grosser Wichtigkeit wurde ich von Unfähigkeit getroffen, sobald ich das Wort "meine Brüder" ausgesprochen hatte; kein Gedanke in meinem Gehirn, nicht ein Wort, auf meinen Lippen. Heilige Jungfrau—bat ich in mir—ich habe nur eine Schwäche beibehalten, meine Tasse Kaffee, ich opfere sie dir; und sofort kam die Spannkraft meiner Seele wieder, ich übertraf mich selbst und tat manchen Seelen viel Gutes."
Welche Rolle als Hausfriedensstörer hat nicht der Kaffe in meiner Familie gespielt! Ich schäme mich daran zu denken, umsomehr da ein glückliches Resultat nicht vom guten Willen und Geschicklichkeit abhängt, sondern von unberechenbaren Umständen.
Morgen also der grösste Genuss oder der grösste Schmerz!
13. Mai.
Die Aufwärterin hat den elendesten Kaffee gekocht, den man sich denken kann.
Ich bringe ihn als Opfer den Mächten dar, und von diesem Tage an trinke ich Schokolade, ohne zu murren!
26. Mai.
Ausflug nach Buchenwald. Einige hundert Leute haben sich dort versammelt. Die singen Lieder aus der Zeit, da ich jung war, vor dreissig Jahren; sie spielen Spiele meiner Jugend und tanzen deren Tänze.
Die Traurigkeit bekommt Macht über mich, und mit einem Schlag rollt sich mein vergangenes Leben vor den Augen der Seele auf, ich kann die durchlaufende Bahn messen und werde wie erblindet. Ja, es ist bald zu Ende; ich bin alt, und der Weg geht abwärts, dem Grabe zu. Ich kann meine Tränen nicht zurückhalten—ich bin alt.
1. Juni.
Ein junger Arzt von weicher Natur und so empfindlicher Seelenanlage, dass er schon dadurch zu leiden scheint, dass er existiert, leistet mir abends Gesellschaft. Auch er ist bedrängt von Gewissensskrupeln; er bereut die Vergangenheit, die sich nicht bessern lässt, wenn sie auch nicht schlimmer ist als die aller anderen. Er legt mir das Mysterium von Christus aus.
—Man kann nicht ändern, was man einmal getan hat; man kann keine einzige schlechte Tat streichen: daher unsere Verzweiflung. Dann offenbart sich Christus. Er allein vermag die Schuld, die nicht bezahlt werden kann zu tilgen, das Wunder zustande zu bringen und die Last des Gewissens und der Selbstvorwürfe abzunehmen. Credo quia absurdum, und ich bin gerettet.
—Aber das kann ich nicht; und ich ziehe vor, meine Schulden selbst durch Leiden zu bezahlen. Es gibt Augenblicke, da ich mich nach einem grausamen Tod sehne, auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt werden möchte, um die Schadenfreude zu empfinden, meinem eigenen Körper, diesem Gefängnis der Seele, die zu den Höhen strebt, wehe zu tun. Und das Himmelreich ist für mich, von materiellen Bedürfnissen befreit zu werden; Feinde wiederzusehen, um ihnen zu verzeihen und ihre Hände zu drücken. Keine Feinde mehr! Kein Groll! Das ist mein Himmelreich!—Weist du, was das Leben erträglich für mich macht? Dass ich mir zuweilen einbilde, es sei nur eine Halbwirklichkeit, ein böser Traum, der uns als Strafe auferlegt ist; und dass man im Augenblick des Todes zu der wirklichen Wirklichkeit aufwacht, indem man zum Bewusstsein kommt, das es bloss ein Traum war; alles Böse, das man getan hat, nur ein Traum. So werden die Gewissensbisse ausgetilgt in und mit der Handlung, die nicht begangen worden ist! Das ist Erlösung, Errettung!
25. Juni.
"Inferno" ist jetzt fertig geschrieben. Ein Marienkäfer hat sich auf meine Hand gesetzt. Ich warte ein Wahrzeichen ab für die Reise, die ich vorbereite. Der Marienkäfer fliegt auf und nimmt den Kurs nach Süden! Südwärts also.
Von diesem Augenblick setzte ich meine Abreise nach Paris fest. Aber es scheint mir zweifelhaft, ob die Mächte mir ihre Zustimmung geben. Ein Raub innerer Kämpfe lasse ich den Juli verfliessen, und mit dem Eintritt des August erwarte ich ein Zeichen, um mich zu bestimmen. Zuweilen fällt mir ein, dass die Lenker meines Schicksals nicht unter sich einig sind, und dass ich der Gegenstand einer längeren Erörterung bin. Einer treibt mich an, und ein anderer hält mich zurück.
Schliesslich am Morgen des 24. August steige ich aus dem Bett, ziehe die Fenstergardine auf und erblicke eine Krähe, die auf dem Schornstein eines sehr hohen Hauses sitzt. Sie nimmt sich ganz so aus wie der Hahn auf dem Turm der Kirche Notre-Dame-des-Champs (siehe "Inferno"), stellt sich, als fliege sie ihres Weges, mit den Flügeln schlagend und nach Süden gewandt.
Ich öffne das Fenster. Da erhebt sich der Vogel, laviert, fliegt gerade auf mich zu und verschwindet.
Ich nehme das Wahrzeichen an und packe meine Sachen.
Noch ein Mal—ob es das letzte ist?—steige ich auf dem Nordbahnhof aus. Ich frage jetzt nicht: was habe ich hier zu tun, da ich mich zu Hause fühle in der Hauptstadt Europas. In mir ist allmählich der Entschluss gereift, nicht ganz klar, das gestehe ich ein, im Benediktinerkloster zu Solesmes eine Zuflucht zu suchen.
Aber erst gehe ich und besuche die alten Stellen mit ihren schmerzlichen und doch so lieben Erinnerungen. So sehe ich wieder den Luxemburg-Garten, Hotel Orfila, den Kirchhof von Montparnasse, den Jardin des Plantes. In der Rue Censier bleibe ich einen Augenblick stehen, um einen verstohlenen Blick in das Gärtchen meines Hotels an der Rue de la Clef zu werfen. Gross ist meine Gemütsbewegung, als ich den Pavillon mit meinem Zimmer sehe, wo ich dem Tode entging in jener schrecklichen Nacht, als ich mit dem Unsichtbaren rang, ohne es zu wissen. Man kann sich meine Gefühle denken, als ich meine Schritte nach dem Jardin des Plantes lenke und die Spuren der Wasserhose sehe, die gerade meine Allee verheert hat, die vor den Bären und Bisonochsen.
Auf dem Rückweg die Strasse Saint-Jacques hinuntergehend, entdeckte ich die Buchhandlung der Spiritisten und kaufe das "Buch der Geister" von Allan Kardec, das mir bisher unbekannt war.
Ich nehme und lese. Das ist ja Swedenborg und vor allem die Blavatzky, und als ich überall meinen eigenen "Casus" wiederfinde, kann ich mir nicht verhehlen, dass ich Spiritist bin. Ich Spiritist! Hätte ich gewusst, dass ich als Spiritist enden würde, als ich mich über meinen früheren Chef an der Königl. Bibliothek in Stockholm lustig machte, weil er Anhänger des Spiritismus war! Man weiss nie, in welchen Hafen man schliesslich einläuft!
Während ich meine Studien in Allan Kardec fortsetze, bemerke ich ein stufenweise geschehendes Wiederauftreten der beunruhigenden Symptome von früher. Das Gepolter über meinem Kopfe beginnt, ich werde von Beklemmung angefochten, eine Furcht vor allem zeigt sich. Aber ich lasse mir nicht beikommen und fahre fort, die spiritistischen Zeitschriften zu lesen, während ich genau meine Gedanken und Handlungen überwache.
Da werde ich nach ganz unzweideutigen Warnungen eines Nachts genau um zwei Uhr von einer Herzaffektion geweckt.
Ich habe den Wink verstanden: Es ist verboten, in den Geheimnissen der Mächte zu forschen. Ich schleudere die unerlaubten Bücher weg, und sogleich kommt der Friede zurück; ein hinreichender Beweis für mich, das der höhere Wille befolgt worden ist.
Am folgenden Sonntag gehe ich in Notre-Dame und wohne der Vesper bei. Von der Ceremonie ergriffen, obwohl ich kein Wort davon verstehe, zerfliesse ich in Tränen und gehe mit der Überzeugung fort, dass sich hier in der Mutterkirche der erlösende Hafen befindet.
Doch nein, es war nicht so! Denn am Tage danach lese ich in La Presse, dass der Abt des Solesmes-Klosters soeben wegen Sittlichkeitsvergehens abgesetzt ist.
Bin ich denn immer ein Spielball, ein Gelächter für die Unsichtbaren! rief ich aus, von einem so gut gerichteten Stoss getroffen. Danach schweige ich und unterdrücke die ungebührliche Kritik, fest entschlossen, abzuwarten!
Das nächste Buch, das mir zufällig in die Hand fällt, lässt mich die Absichten meines Lenkers hervorschimmern sehen. Es ist die "Versuchung des heiligen Antonius" von Flaubert. "Alle diejenigen, die von Sehnsucht nach Gott gemartert werden, habe ich verschlungen", sagt die Sphinx.
Dieses Buch macht mich krank, und ich werde bange, wenn ich darin die Gedanken erkenne, die ich in meinem Mysterienspiel ausgedrückt habe: das Einsetzen des bösen in die Rechte des guten Gottes. Und ich werfe es nach dem Durchlesen von mir als eine Versuchung des Teufels, der es verfasst hat. "Antonius macht das Zeichen des Kreuzes und versinkt wieder in Gebet." So schliesst der Verfasser sein Buch, und ich folge seinem Beispiel.
Danach und zu rechter Stunde bekomme ich "En Route" von Huysmans. Warum ist dieses Bekenntnis eines Okkultisten mir nicht früher in die Hände gefallen? Weil es notwendig war, dass zwei analoge Geschicke sich parallel entwickelten, damit das eine mittelst des andern gestärkt werden könnte.
Ein Neugieriger, der die Sphinx herausfordert und von dieser verschlungen wird, damit seine Seele am Fusse des Kreuzes erlöst werde.
So, nun mag meinetwegen ein Katholik zu den Trappisten gehen und vor dem Priester beichten, für mein Teil aber dürfte es genügen, dass ich mea culpa schriftlich coram populo bekannt habe. Übrigens können die acht Wochen, die ich in Paris zugebracht habe, während ich dieses Buch schrieb, gegen den Eintritt in das Kloster und mehr noch aufgehen, weil ich vollständig wie ein Eremit gelebt habe.
Eine kleine Kammer, nicht grösser als eine Klosterzelle, mit Gitterfenstern oben unter der Decke, hat mir zu Wohnung gedient. Durch das Gitter in der Fensteröffnung, die nach einem tiefen Hof zu geht, kann ich ein Stück vom Himmel sehen und eine graue Wand mit Efeu, der hinaufklettert dem Lichte zu.
Die Einsamkeit, die an und für sich schrecklich ist, wird noch düsterer im Restaurant unter einer lärmenden Schar Leute, zwei Male am Tage. Dazu die Kälte, ein beständiger Zug quer durchs Zimmer, von dem ich eine fressende Neuralgie bekommen habe; Sorgen, binnen kurzem ohne Hilfsmittel dazustehen, die Rechnung, die beständig wächst. Möchte glauben, dass das verschlägt!
Und dann die Gewissensbisse! Früher, als ich mich selbst für verantwortlich ansah, war es nur die Erinnerung an begangene Dummheiten, die mich peinigte. Jetzt ist es das Böse selbst, meine schlechten Handlungen, die meine Geissel ausmachen. Und zum Überfluss erscheint mir mein vergangenes Leben als ein einziges Gewebe von Verbrechen, wie ein Gewirr von Gottlosigkeiten, Bosheiten, Missgriffen, Grobheiten in Wort und Handlung. Ganze Szenen aus meiner Vergangenheit rollen sich vor meiner Anschauung auf. Ich sehe mich in der einen und der andern Situation, und immer ist es eine abgeschmackte. Ich wundere mich, dass jemand mich hat lieben können. Ich klage mich alles Möglichen an; keine Niedrigkeit, keine widrige Handlung, die nicht mit schwarzer Kreide auf dem weissen Schleier steht. Ich werde von Entsetzen vor mir selbst erfüllt und möchte sterben.
Es gibt Augenblicke, da die Schamröte das Blut in meine Wangen jagt, bis in meine Ohrläppchen. Selbstsucht, Undankbarkeit, Groll, Neid, Hochmut, all die Todsünden führen ihren Gespenstertanz vor meinem erwachten Gewissen aus.
Und während mein Gemüt sich martert, verschlechtert sich mein Gesundheitszustand, vermindern sich die Kräfte, und mit dem Hinschwinden des Körpers beginnt die Seele ein Vorgefühl von ihrer Befreiung aus dem Schmutz zu bekommen.
Ich lese gegenwärtig Töpffers "Presbytere" und Dickens' Weihnachtserzählungen, und die schenken mir eine unsägliche innere Ruhe und Freude. Ich kehre zu den Idealen meiner besten Jugendzeit zurück und nehme von neuem die Kapitale, die ich im Spiel des Lebens verloren habe, in Besitz. Der Glaube kommt zurück, das Vertrauen zu der natürlichen Güte der Menschen, der Glaube an die Unschuld, die Uneigennützigkeit, die Tugend!
Die Tugend! dieses Wort ist verschwunden aus den modernen Sprachen, es ist verworfen worden als durch und durch lügenhaft!
(In diesem Augenblick ersehe ich aus den Zeitungen, dass mein Schauspiel "Frau Margit" in Kopenhagen aufgeführt worden ist. In diesem Stück siegen Liebe und Tugend, ganz wie im "Geheimnis der Gilde". Das Schauspiel hat nicht gefallen, ebenso wenig jetzt wie bei der ersten Aufführung im Jahre 1882. Warum nicht? Weil man findet, es sei veraltetes Geschwätz, diese Geschichte von der Tugend!)
Ich habe soeben wieder Maupassants "Horla" gelesen. Das ist ja das Finale aus dem "Don Juan", nicht wahr? Jemand kommt, unsichtbar, mitten in der Nacht ins Schlafzimmer hinein. Er trinkt Wasser und Milch und schliesst damit, Blut aus dem armen Don Juan zu saugen, der, zu Tode gejagt, gezwungen wird, Hand an sich selbst zu legen.
Dies ist etwas wirklich Erlebtes: ich kenne mich darin wieder, und ich leugne nicht, dass eine Geistesstörung vorhanden ist, aber ich sehe jemand dahinter.
Meine Gesundheit verschlechtert sich immer mehr, da Risse in den Wänden sind, so dass Rauch und Kohlendunst in mein Zimmer eindringen. Als ich heute auf der Strasse ging, bewegte sich das Pflaster unter den Füssen gleich einem Schiffsdeck in langen Schwankungen. Nur mit merkbarer Schwierigkeit kann ich die Höhe zum Luxemburggarten hinaufgehen. Der Appetit wird immer geringer, und ich esse nur, um die Schmerzen im Magen zu stillen.
Eine Erscheinung, die sich oft wiederholt nach meiner Ankunft in Paris, hat mir verschiedenes zu denken gegeben. Im Innern meines Rockes, auf der linken Seite, gerade da wo das Herz sitzt, hört man nämlich ein regelmässiges Klopfen; es erinnert an den Tick-tack-Laut, der in Wänden von dem Käfer hervorgebracht wird, der in Schweden "Zimmermann" genannt wird, aber auch "Totenuhr"; es soll jemandes Tod ankündigen. Ich glaube erst, es sei meine Taschenuhr, aber das hielt nicht Stich, da das Klopfen fortfuhr, nachdem ich die Uhr weggelegt hatte. Es sind auch nicht die Federn meiner Tragbänder oder das Futter der Weste. Ich nehme die Deutung der Totenuhr an, weil die mir am meisten behagt.
Vor einigen Nächten hatte ich einen Traum, der aufs neue meine Sehnsucht weckte, sterben zu dürfen, indem er mir die Hoffnung auf ein besseres Dasein wiedergab, wo man keine Gefahr läuft, einen Rückfall in die Qual des Lebens zu tun.
Als ich auf einem Vorsprung, der von einer jähen in Dunkel gehüllten Tiefe begrenzt wurde, zu weit vorgetreten war, fiel ich mit dem Kopf voran in einen Abgrund. Aber ich fiel eigentümlicher Weise hinauf statt hinunter. Und unmittelbar umgeben wurde ich von einem blendendweissen Lichtschimmer, und ich sah——
Was ich sah, flösste mir zwei gleichzeitige Vorstellungen ein: ich bin tot, und ich bin erlöst! Und ein Gefühl der höchsten Seeligkeit umhüllte mich bei dem Bewusstsein, dass das andere nun zu Ende sei. Licht, Reinheit, Freiheit erfüllten mein Gemüt, und indem ich ausrief: Gott!, empfand ich die Gewissheit, dass ich Vergebung bekommen habe, dass die Hölle hinter mir liege, dass sich der Himmel öffne.
Seit dieser Nacht fühle ich mich noch heimatloser als vorher hier in der Welt, und gleich einem müden, schläfrigen Kinde verlange ich, "heim gehen" zu dürfen, den schweren Kopf an einen mütterlichen Busen zu legen, im Schoss einer Mutter zu schlafen, der keuschen Gattin eines unermesslich grossen Gottes, der sich mein Vater nennt und dem ich nicht zu nahen wage.
Aber dieser Wunsch verbindet sich mit einem andern: nämlich die Alpen zu schauen und genauer bestimmt die Dent du Midi im Kanton Wallis. Ich liebe diesen Berg mehr als die andern Alpen, ohne erklären zu können weshalb. Vielleicht dass es die Erinnerung an meinen Aufenthalt am Genfersee ist, wo ich die "Utopien in der Wirklichkeit" (Schweizer Novellen) schrieb, und an die Landschaft dort, die mich an den Himmel "erinnerte".
Dort habe ich die schönsten Stunden meines Lebens gelebt, dort habe ich geliebt! Geliebt Frau, Kinder, die Menschheit, das Weltall, Gott!
"Ich hebe meine Hände auf zu Gottes Berg und Haus!"
Paris, Oktober 1897.
Als ich Ende August 1897 nach Paris zurückkehrte, fand ich mich plötzlich isoliert. Mein Freund der Philosoph, dessen tägliche Gesellschaft für mich eine moralische Stütze geworden war, und der versprochen hatte, mir nach Paris zu folgen, um dort den Winter zuzubringen, hat sich in Berlin verzögert. Er ist nicht imstande, zu erklären, was ihn in Berlin zurückhält, da Paris das Ziel seiner Reise ist und er vor Verlangen brennt, die Lichtstadt zu schauen.
Ich habe nun drei Monate auf ihn gewartet und bekomme den Eindruck, dass die Vorsehung unter vier Augen mit mir hat sein wollen, um mich von der Welt los zu machen, mich in die Wüste zu treiben, auf dass die Zuchtgeister dort meine Seele recht schütteln und sieben könnten. Und darin hat die Vorsehung recht getan, denn die Einsamkeit hat mich erzogen, indem sie mich zwang, auf die mässig zugenommenen Freuden des Verkehrs zu verzichten, und mich jeder Stütze eines Freundes beraubte. Ich habe mich gewöhnt, zum Herrn zu sprechen, mich nur ihm anzuvertrauen, und habe so gut wie aufgehört, Bedürfnis nach Menschen zu empfinden; was mir stets vorgeschwebt hat als das Ideal von Unabhängigkeit und Freiheit.
Selbst dem Kloster, in dem ich den Schutz der Religion und der Geselligkeit für mich erwartete, muss ich entsagen. Das Leben des Eremiten war mir auferlegt, und ich habe es hingenommen als eine Strafe und eine Erziehung, trotzdem es einem hart ankommt, im Alter von achtundvierzig Jahren seine eingewurzelten Gewohnheiten gegen neue vertauschen zu müssen.
Ich wohne in einer kleinen Kamme, eng wie eine Klosterzelle, mit einem vergitterten Fensterloch oben unter der Decke, das auf einen Hof und eine Steinwand mit ungeheurem Efeu geht.
Dort sitze ich nach meinem Morgenspaziergang, bis halb sieben Uhr abends; das Frühstück lasse ich auf einem Tablett herauftragen.
Abends gehe ich aus, um zu Mittag zu speisen, und gehe direkt, ohne mir erst einen Appetit-Likör zu verschaffen, der mir jetzt zuwider ist. Warum ich das kleine Restaurant am Boulevard St. Germain ausgewählt habe, würde mir schwer fallen zu erklären. Vielleicht ist es eine Erinnerung an die beiden schrecklichen Abende, die ich im vorigen Jahre mit meinem okkulten Freund, dem Deutsch-Amerikaner, dort verbrachte, die mich dort fest hext, bis zu dem Grad, dass jeder Versuch, nach einem andern Ort zu gehen, mit einem Unbehagen schliesst, das ich tendenziös nennen möchte und das mich zurück nach dieser Kneipe treibt, die ich verabscheue. Und die Gründe dafür: mein früherer Freund hat hier Schulden hinterlassen, und man hat mich als seinen Begleiter erkannt. Aus dieser Ursache und weil man uns hat deutsch sprechen hören, werde ich als Preusse behandelt, das heisst, sehr schlecht bedient. Es hilft nicht, dass ich stille Proteste einlege, indem ich meine Visitenkarte zurücklasse oder mit Absicht Briefumschläge, die in Schweden abgestempelt sind, vergesse. Ich sehe mich genötigt, für den Schuldigen zu leiden und zu bezahlen. Kein anderer als ich sieht die Logik in diesem Sachverhalt ein, dass es eine Sühne ist für ein Vergehen.... Es ist ganz einfach eine Rechtsübung in untadeliger Form, und zwei Monate lang kaue ich das entsetzlich schlechte Essen, das nach der Anatomie riecht.
Die Wirtin, die bleich wie eine Leiche an der Kasse thront, grüsst mich mit einer triumphierenden Miene, und ich übe mich in mir zu sagen:
Arme Alte, sie hat wohl 1871 während der Belagerung von Paris Ratten essen müssen!
Aber es scheint, als ob sie Mitleid mit mir empfinde, als sie meine dumpfe Ergebenheit und meine Ausdauer wahrnimmt. Es gibt Augenblicke, da sie mir noch bleicher zu werden scheint, wenn sie mich so allein kommen sieht, immer allein, und immer magerer. Es ist nur die nackte Wahrheit: als ich mir nach zwei auf diese Weise verlaufenen Monaten neue Halskragen anschaffte, musste ich an Stelle der Kragen von 47 Zentimeter solche von 43 kaufen, was 4 Zentimeter Unterschied macht. Die Wangen sind hohl geworden und die Kleider hängen in Falten.
Da zeigt man sich auf einmal bemüht, mir besseres Essen vorzusetzen, und die Wirtin lächelt mich an. Im selben Augenblick hörte die Verhexung auf, und ich ging meiner Wege, ohne Groll und wie von einer Last befreit, mit der Gewissheit, dass die Sündenbusse für meinen Teil erfüllt sei und vielleicht auch für den meines abwesenden Freundes. Falls es eine Einbildung von mir war, dass ich schlecht behandelt worden sei, und falls die Wirtin ohne Schuld daran war, bitte ich sie um Verzeihung; dann war ich es, der sich selbst gestraft hat, indem er sich eine wohlverdiente Züchtigung gab.
"Die Zuchtgeister nehmen die Einbildungskraft des Strafwürdigen in Besitz und wirken durch dieses Mittel zu seiner Besserung von der Schlechtigkeit, indem sie ihn alles in entstellter Form wahrnehmen lassen." (Swedenborg.)
Wie oft ist es mir nicht passiert, wenn ich mir eine wirklich feine Mahlzeit hatte leisten wollen, dass alle Gerichte mir Ekel einflössten, als ob sie faul wären, während meine Tischkameraden sich einstimmig in Lobreden über das gute Essen ergossen!
Der "beständig Unzufriedene" ist ein Unglücklicher unter der Geissel der Unsichtbaren, und mit allem Grund weicht man ihm aus, denn er ist dazu verurteilt, ein Freudenstörer zu sein, der, zur Einsamkeit und deren leiden verurteilt, verborgene Versehen sühnt.
So bleibe ich denn mit mir allein, und als ich, nachdem ich ganze Wochen lang nicht Gelegenheit gehabt habe, meine eigene Stimme zu hören, jemand aufsuche, überhäufe ich diesen Unglücklichen so mit meinem Redefluss, dass er sich ermüdet aus dem Spiele zieht und, ohne es zu wollen, zu verstehen gibt, dass er das Zusammensein nicht zu erneuern wünscht.
Es gibt andere Augenblicke, wo die Verlockung, ein menschliches Wesen zu sehen, mich dazu treibt, schlechte Gesellschaft aufzusuchen. Dann geschieht es, dass mitten im Gespräch ein Gefühl des Unbehagens, das von Kopfschmerzen begleitet wird, mich ergreift; ich werde stumm, bin unfähig, ein Wort hervorzubringen. Und ich sehe mich genötigt, den Kreis zu verlassen, der nie zu zeigen versäumt, wie zufrieden man ist, eine unerträgliche Figur, die nichts dort zu tun hatte, los zu werden.
Zur Isolierung verurteilt, unter den Menschen in Acht erklärt, nehme ich meine Zuflucht zu dem Herrn, der für mich ein persönlicher Freund geworden ist; oft ist er zornig auf mich, und dann leide ich; oft scheint er abwesend zu sein, von anderer Seite in Anspruch genommen, und dann ist es noch viel schlimmer. Aber wenn er gnädig ist, wird mir das Leben süss, besonders in der Einsamkeit.
Ein eigentümlicher Zufall hat es gefügt, dass ich mich in der Rue Bonaparte, der katholischen Strasse, niedergelassen habe. Ich wohne gerade der Ecole des beaux-arts gegenüber, und wenn ich ausgehe, wandre ich durch eine Allee von Schaufenstern, wo Puvis de Chavannes' Legenden, Botticellis Madonnen, Raffaels Jungfrauen mich zum oberen Teil der Rue Jacob begleiten; von dort folgen mir die katholischen Buchhandlungen mit ihren Gebetbüchern und Missalen bis zur Kirche St. Germain des Pres. Die Läden mit ihren Andachtsgegenständen bilden von dort ein Spalier von Erlösern, Madonnen, Erzengeln, Engeln, Dämonen und Heiligen, all den vierzehn Stationen in Christi Leiden, der Weihnachtskrippe; dies alles zur Rechten; und linker Hand fromme Bilderbücher, Rosenkränze, Gottesdienstgewänder und Altargefässe, bis zum Saint-Sulpice-Markt, wo die vier Löwen der Kirche, mit Bossuet an der Spitze, den göttlichsten Tempel in Paris bewachen.
Nachdem ich dieses Repertorium der Heiligen Geschichte musternd durchgangen bin, trete ich oft in die Kirche, um mich an Eugène Delacroix' Gemälde "Jakob ringt mit dem Engel" zu stärken. Die Sache ist die, dass diese Szene mir stets etwas zu denken gibt, indem sie gottlose Vorstellungen bei mir weckt, trotz dem Orthodoxen im Gegenstande. Und wenn ich durch die Knienden wieder hinausgehe, bewahre ich die Erinnerung an den Ringer, der sich aufrecht hält, obgleich seine Hüftsehne gelähmt worden ist.
Danach gehe ich am Jesuitenseminar vorbei, einer Art furchtbaren Vatikan, das unermessliche Fluten seelischer Kraft ausdünstet; deren Wirkungen machen sich von weitem fühlbar, wenn man den Theosophen glauben darf. Ich bin nun an meinem Ziel angekommen, dem Luxemburg-Garten.
Schon seit meinem ersten Besuch in Paris 1876 hat dieser Park eine geheimnisvolle Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Es war mein Traum, in seiner Nähe wohnen zu dürfen. Dieser Einfall wurde 1883 Wirklichkeit. Von der Zeit an, jedoch mit Unterbrechungen, ist dieser Garten meinen Erinnerungen einverleibt worden, in meine Persönlichkeit übergegangen. Obgleich in Wirklichkeit nur mässig ausgedehnt, ist er in meiner Einbildung unermesslich gross. Ganz wie die heilige Stadt im Buch der Offenbarung hat er zwölf Tore, und, um die Ähnlichkeit voll zu machen, "nach Osten drei Tore, nach Norden drei Tore, nach Süden drei Tore, nach Westen drei Tore" (Offenbarung, 21, 13). Und jeder Eingang schenkt mir einen verschiedenen Eindruck, der auf Anordnung der Pflanzungen, der Gebäude, der Statuen beruht, oder, auch auf persönlichen Erinnerungen, die damit verknüpft sind.
So fühle ich mich herzensfroh, wenn ich durch das erste Tor von der Rue de Luxembourg eintrete, wo man vom Saint-Sulpice kommt: die efeubewachsene Hütte des Wärters erzählt mir ein nicht herausgegebenes Idyll mit Ententeich und Paulownien. Weiterhin liegt das Museum für die Gemälde lebender Künstler in klaren, sonnigen Farben. Der Gedanke, dass meine Jugendfreunde Carl Larsson, der Bildhauer Ville Vallgren, Fritz Thaulow dort Stücke ihrer Seele niedergelegt haben, stärkt und verjüngt mich; ich fühle die Strahlung ihres Geistes durch die Mauern dringen und mich einladen, Mut zu fassen, da ich Freunde ganz nahe habe.
Weiter hin haben wir Eugène Delacroix, dessen Lorbeeren von Zeit und Nachwelt in Frage gestellt werden.
Das zweite Tor von denen, die nach der Rue des Fleurus gehen, führt mich auf die Rennbahn, die breit wie ein Hippodrom ist und mit einer Blumen-Terrasse endet, wo der Sieg in Marmor als Malpfeiler steht und von wo in der Ferne das Pantheon mit dem Kreuz zu sehen ist.
Das dritte Tor bildet die Fortsetzung der Rue Vanneau und führt mich in eine dämmerige Allee, die sich links in eine Art elysäisches Feld verliert. Dort haben die Kinder ihre Spielplätze und erfreuen sich an den Holzpferden, die mit Löwen, Elefanten und Kamelen zusammengehen, ganz wie im Paradies; weiter hin das Ballspiel und das Kindertheater zwischen Blumenquadraten, das goldene Zeitalter, Noahs Arche: der Frühling des Lebens begegnet mir dort im Herbste meines Lebenslaufes.
Auf der Südseite, nach der Rue d'Assas, geben mir der Obstgarten und die Baumschule ein Bild des Hochsommers; die Blütezeit ist aus! Es ist die Jahreszeit der Früchte; und die Bienenstöcke daneben mit ihren bürgerlich angelegten Einwohnern, die Goldstaub für den Winter sammeln, verstärken den Eindruck des reifen Alters.
Das zweite Tor gerade gegenüber dem Lyzeum Louis le Grand tut eine paradiesische Landschaft auf. Sammetgleiche Grasmatten mit beständig jungem Grün; hier und dort ein Rosenbusch und ein einziger Pfirsichbaum; ich werde nie vergessen, wie dieser eines Frühlings, mit seinen Blüten in der Farbe der Morgenröte geschmückt, mich verlockte, eine ganze halbe Stunde im Anschauen oder richtiger in Anbetung vor seiner kleinen schmächtigen, jugendlichen, jungfräulichen Gestalt zu verweilen.
Die Avenue de l'Observatoire schliesst am Tor des Haupteingangs, das mit seinen vergoldeten Fasces wirklich königlich ist. Da dieses zu majestätisch für mich ist, bleibe ich gewöhnlich draussen stehen: morgens bewundere ich den Palast, abends betrachte ich die Lichtlinien des Montmartre über den Dachstuben und bei klarem Wetter den Grossen Bären und den Polarstern; die kreisen über dem grossen Gittertor, das mir bei meinen astrologischen Betrachtungen zum Mauerquadranten dient.
Die östliche Seite versucht mich nur mit dem Tor von der Rue Soufflot. Von dort habe ich meinen Garten entdeckt, dieses Meer von Grün mit den entzückend feinen Linien der Riesenplatanen und in blauender Ferne voll von Geheimnissen; damals kannte ich die Rue de Fleurus noch nicht, die mir später als Propyläe zu einem neuen Leben so lieb wurde. Dort pflege ich einen Rückblick über die zu Ende gelaufene Bahn zu werfen, die vom Teich unterbrochen wird und auf dieser Seite von dem kleinen David mit dem zerbrochenen Schwert.
Eines Morgens im vorigen Herbst zeigte die Wasserkunst das Schauspiel eines Regenbogens. Das brachte mir den Färbereiladen der Rue de Fleurus wieder in Erinnerung, wo mein Regenbogen ausgespannt war als ein Zeichen meines Bundes mit dem Herrn der Ewigkeit. (Siehe "Inferno".) Wenn ich an den Abhang der Terrasse trete, habe ich an der Statuenreihe von Frauen vorbeizugehen, die mehr oder minder Königinnen oder Missetäterinnen gewesen sind; und ich bleibe an der grossen Treppe stehen, die zur Frühlingszeit von blühenden Rotdorn gekrönt ist, einer Einrahmung zu diesem ausgedehnten Blumenzirkus. Im Herbst bekomme ich von den Granatbäumen und den Rosenlorbeeren (Nerium), hundertjährigen, fast historischen Exemplaren, wie den Fächerpalmen, welche die ungeheuren Chrysanthemum-Rabatten einfassen, um die sich Schmetterlinge tummeln, Turteltauben girren, Kinder lachen, Illustrationen zu den Feenmärchen.
Und oben über den Sykomoren und den Spitzen Klein-Luxemburgs die Zwillingstürme von Saint-Sulpice, die keinen andern gleichen und nicht einmal sich gegenseitig.
Die Nordseite gibt Zutritt durch drei Tore, aber ich mache nur von zweien Gebrauch, weil das dritte von einem Soldaten bewacht wird. Das Tor vom Odeon bildet eine Opernouvertüre: das antike und einzigdastehende Haus, in dem sich alle Göttinnen des Gesanges unter den Arkaden zusammengefunden haben, stimmt zu der soliden Freude des Herzens, das nach Schönheit und Wissen begehrlich ist. Die Ecke der Jugenddichter Murger und de Banville ladet unmittelbar zu jugendlichen Schwärmereien ein, den Träumen des zwanzigjährigen Studenten.
Die Medici-Fontaine, ein ovidianisches Gedicht in weissem Marmor, befindet sich in einer neuen Auflage am Teiche; da bleiben die Raben stumm stehen angesichts der jungen Liebe, die sich ohne Scham vor den Augen des schwarzen Zyklopen (er hat zwei) entfaltet, während das Ganze von jungem Weinlaub umkränzt und von den schönsten Platanen in Frankreich überschattet ist.
Das ist schön! Das ist ein Fest! Ein heidnisches! Orpheisch! Und trauervoll zugleich, wehmütig wie die Elegie von einer Liebe, die eine unglückliche Wendung für Galatea nehmen wird, denn deren Akis wird durch einen Felsblock, den ein Polyphem schleudert, zermalmt werden.
Das letzte Tor, das beim Museum, behält den gemischten Eindruck von dem Geier, der ohne sichtbaren Grund auf das Haupt der Sphinx herabgestossen ist, und von Heros Kuss auf Leanders Stirn, als er von vorzeitigem Tod geerntet wird, infolge eines Unglücksfalls, der leicht vorherzusagen gewesen wäre. Danach nehme ich noch ein wenig Landkennung, indem ich am Museum für zeitgenössische Meister vorbeistreife, und vertiefe mich in die Rosengartenallee mit ihren Zehntausenden von Rosen.
Das ist mein Morgenspaziergang; und indem ich das Eingangstor wähle, stimme ich meinem Gemütszustand nach der Tonweite, die ich wünsche. Für den Rückweg benutzte ich den Boulevard Saint-Michel und fasse die Turmspitze der Sainte-Chapelle ins Auge; die leitet mich zwischen den Blindschären der Eitelkeit hindurch, die in den Ladenfenstern ausgebreitet und den Trottoiren in Form von Freudenmädchen und Kindern der Welt ausgestellt ist. Wenn ich am Saint-Michel-Markt ankomme, fühle ich mich beschützt von dem erhabenen Erzengel, der die Schlange tötet. Nicht der Eidechsenschwanz macht, dass man in diesem Kunstwerk den bösen Geist offen zutage hat; auch nicht die Widderhörner oder die erhobenen Augenbrauen, sondern der Mund, der in den Mundwinkeln nicht schliesst, während die Lippen vorn zusammengekniffen werden, um die vier Vorderzähne zu verbergen. Die Eckzähne können nicht versteckt werden, und das grausame Lächeln, das sich gleichsam abseits Luft macht, enthüllt das unsterbliche Böse, das mit der Speerspitze im Herzen noch höhnisch grinst.
Drei Male in meinem Leben bin ich diesem Munde begegnet: bei einem Schauspieler, einer Malerin und noch einer Frau, und ich habe mich nie darin betrogen.
Der Augustiner-Quai führt mich, nachdem ich einen Blick auf Notre-Dame geworfen habe, durch eine Allee von Büchern und Platanen zur Mündung der Rue Dauphine bei deren Zusammenfluss mit dem Pont-neuf.
Das ist der farbenreichste offene Platz, und er macht mich so froh, dass ich die Lust fühle, mich auf der Terrasse des Weinhändlers niederzulassen und dort das Ende meiner Tage zu erwarten. Eine Landschaftsecke mit den schönsten Platanen; Heinrich IV., diese Inkarnation von Frankreich; und die Naturalienhändler, die hier den Platz der Antiquare mit ihren Kästen einnehmen, in denen man Schmetterlinge, Schnecken, edle oder wenigstens funkelnde Steine sieht; ferner all diese Schilder in lebhaften Farben, Weinflaschen, Gemüse; und vor allem der Gedanke, dass dies der Pont-neuf ist, die schönste Brücke von Europa mit ihren Masken von Waldgöttern, Dryaden, Satyrn, zaubert mich an diesem Platz fest. Oder vielleicht, weil verschiedene frohe Begebenheiten in der Zeit, die vergangen ist, diesen Kreuzweg zum Treffpunkt gewählt haben und weil das Lachen noch in der Luft weht, abgeprallt vom Boden und den Mauern, die seine Wellenbewegungen bewahrt haben.
Das Münzhaus, vornehm, feierlich und schweigsam, ein Palast so gut wie einer, verschlossen, gibt einem keine Ahnung von dem kleinlichen Gold, das in den Kellern angehäuft liegt.
Das Institut, das die Arme dem Louvre zustreckt, gleicht dem Sonnenlustschloss eines Riesen, so hoch sind die Fenster. Und der Palast auf der anderen Seite des Flusses, das ist nicht ein Gebäude, das ist eine ganze Bergkette, wo ein Riese wohnt, ein Nachkomme der Atlantiden, der noch im Schlaf versenkt ist, auf dass er seine Kräfte für den Tag der Auferstehung sammle. Vor einigen Abenden, als ich am Palais Mazerin vorbeiging, war die Sonne hinter den Höhen von Passy untergegangen, aber ihre letzten Strahlen spiegelten sich in den Fensterscheiben des Louvre wieder; und als ich ein Stück weiter gekommen war, sah ich die Fenster der Tuilerien aufglänzen, eins nach dem andern, bis zum Pavillon der Flora. Die magische Wirkung liess mich daran denken, dass Frankreichs Barbarossa erwacht sei, dass Ludwig der Heilige seinen Krönungstag mit einem Galafeste feiere, zu dem alle Monarchen der Erde in Büsserkuttte eingeladen seien, kniend bei der Tafel zu bedienen.
Ich habe nun die mächtige Flutmündung der Rue Bonaparte erreicht. Dieser Hohlweg bildet einen Abfluss für die Viertel Montparnasse, Luxembourg und teilweise Faubourg Saint-Germain. Man muss geschickt manövrieren, um in den Ausfluss hinein zu dringen, versperrt wie er ist von Fussgängern und Fuhrwerken, wo der feste Boden aus einem meterbreiten Trottoir besteht. Indessen bin ich vor nichts so bange, wie vor diesen Omnibussen, die mit drei weissen Pferden bespannt sind, weil ich sie in Träumen gesehen habe; übrigens erinnern diese weissen Pferde vielleicht an ein gewisses Pferd, von dem im Buch der Offenbarung erzählt wird. Besonders abends, wenn sie aufeinander folgen, je drei mit der roten Laterne darüber, bilde ich mir ein, dass sie die Köpfe mir zuwenden, mich mit boshaften Augen ansehen und mir zurufen: Warte nur, wir werden dich schon fassen.
Mit einem Wort, das ist mein Circulus vitiosus, den ich zweimal am Tage durchlaufe. Mein Leben ist in den Rahmen dieser Umlaufbahn so vollständig eingefasst, dass, nehme ich mir einmal die Freiheit, einen andern Weg einzuschlagen, ich in die Irre gerate, als habe ich Stücke meines Ichs, meine Erinnerungen, meine Gedanken, sogar meine Ergebenheitsgefühle verloren.
Eines Sonntagnachmittags im November begab ich mich nach dem Restaurant, um zu essen, allein. Zwei kleine Tische sind auf das Trottoir am Boulevard St. Germain gestellt, zu ihren Seiten stehen zwei grüne Töpfe mit Oleandern und zwei Bastmatten, die Schutzwände bilden, beschatten sie. Die Luft ist weich und still, die angezündeten Laternen beleuchten das lebensvollste kinematographische Bild, da Omnibusse, Kaleschen, Droschken von den Waldparks festlich gekleidete lustige Menschen heimfahren, die singen, Horn blasen und die Fussgänger anrufen.
Als ich mit der Suppe beginne, kommen meine beiden Freunde, zwei Katzen, und nehmen ihre gewöhnlichen Plätze zu beiden Seiten von mir ein, auf das Fleischgericht wartend. Da ich meine eigne Stimme mehrere Wochen lang nicht gehört habe, halte ich eine kleine Rede an sie, ohne Antwort zu bekommen. Zu dieser stummen und hungrigen Gesellschaft verurteilt, wie ich schlechter Gesellschaft ausgewichen bin, in der mein Ohr von gottloser und plumper Rede verletzt wurde, fühle ich eine Empörung in mir gegen eine solche Ungerechtigkeit. Ich verabscheue nämlich Tiere, Katzen wie Hunde, wie es mein Recht ist, das Tier in meinem Innern zu hassen.
Wie kommt es, dass die Vorsehung, die sich Umstände mit meiner Erziehung macht, mich immer an schlechte Gesellschaft verweist, während eine gute eher geeignet sein würde, mich durch die Macht des Vorbildes zu bessern?
Im selben Augenblick kommt ein schwarzer Pudel mit rotem Halsband und jagt meine Freunde vom Katzengeschlecht fort; nachdem er ihre Bissen verschlungen hat, zeigt er seine Erkenntlichkeit, indem er meinen Stuhlfuss nässt; dann nimmt der undankbare Cyniker eine sitzende Stellung auf dem Asphalt ein und dreht mir den Rücken. Aus der Asche ins Feuer! Sich zu beklagen, lohnt nicht, denn es könnte ja geschehen, dass statt dessen Schweine kämen und mir Gesellschaft leisteten, wie sie mit Robert dem Teufel oder Franz von Assisi taten. Man darf so wenig vom Leben verlangen. So wenig! Und doch ist es zu viel für mich.
Eine Blumenverkäuferin bietet mir Nelken an. Warum gerade Nelken, die ich verachte, weil sie rohem Fleisch gleichen und nach der Apotheke riechen! Schliesslich nehme ich, um ihr zu Willen zu sein, ein Büschel, das nach Belieben zu bezahlen ist; da ich die Entschädigung reichlich zumesse, belohnt die Alte mich mit einem: Gott segne den Herrn, der mir so hübsches Handgeld heute abend gegeben hat! Obwohl ich den Kniff kenne, klingt der Segen lange und angenehm nach, denn ich habe ein grosses Bedürfnis danach nach so vielen Flüchen.
Um halb acht machten die Zeitungsverkäufer mit Notrufen La Presse bekannt, und das ist für mich ein Signal aufzubrechen. Wenn ich sitzen bleibe, um noch ein Dessert zu schmausen und ein extra Glas Wein zu trinken, bin ich gewiss, auf die eine oder andere Weise gepeinigt zu werden, sei es von einem Trupp Kokotten, die sich mir gegenüber niederlassen, oder von herumstreichenden Strassenjungen, die mich beschimpfen. Ganz gewiss bin ich auf Diät gesetzt, und wenn ich drei Gerichte und eine halbe Flasche Wein überschreite, findet sich die Strafe ein. Nachdem die ersten Versuche, bei den Mahlzeiten unmässig zu sein, auf diese Weise abgeschnitten sind, wage ich keine Ausschweifung mehr und befinde mich zuletzt wohl dabei, auf halben Sold gesetzt zu sein.
Ich stehe also vom Tisch auf, um mich nach der Rue Bonaparte zu begeben und von dort hinauf nach dem Luxemburg-Garten.
An der Ecke der Rue Gozlin kaufe ich Zigaretten; gehe am Restaurant "Goldfasan" vorbei. An der Ecke der Rue du Four halte ich mich bei einem Christusbild von schlagendem Naturalismus auf. Die Kunst der geistlich Gesinnten hat sich während ihrer Feldzüge gegen die Zola-Literatur der Geister des Realismus nicht erwehren können, und mit Hilfe dieses Beelzebub soll der andere aus getrieben werden. Unmöglich, an diesen Bildern vorbei zu gehen, ohne sie zu betrachten, gemacht wie sie sind nach lebenden Modellen und versehen mit den schreienden Farben des Impressionisten.
Der Laden ist geschlossen, in Schatten gehüllt, und der Erlöser steht da in seiner kaiserlichen Tunika, von den Gaslaternen beleuchtet, sein blutendes Herz zeigend und die Dornenkrone ums Haupt. Seit mehr als einem Jahre werde ich von dem Erlöser verfolgt, den ich nicht verstehe und dessen Hilfe ich überflüssig machen möchte, indem ich mein Kreuz selber trage, wenn es möglich ist. Das ist der Rest eines männlichen Stolzes, der etwas Widriges in der Feigheit findet, seine Vergehen auf die Schultern eines Unschuldigen zu werfen.
Ich habe den Gekreuzigten überall gesehen: in den Spielsachenläden, bei den Bilderhändlern, in den Buchhandlungen, besonders auf den Kunstausstellungen, im Theater, in der Literatur. Ich habe ihn auf meinem Kissenbezug gesehen, auf den Feuerbränden im Kachelofen, im Schnee oben in Schweden und auf den Klippen an der Küste der Normandie. Bereitet er seine Wiederkunft vor oder ist er schon angelangt? Was will er?
Hier im Fenster in der Rue Bonaparte ist er nicht mehr der Gekreuzigte; er kommt von seinem Himmel als Siegesherr, von Gold und Edelsteinen glänzend. Ist er Aristokrat geworden wie das niedere Volk? Ist er es, der "gute Tyrann", den die Jugend sich träumt, ein friedenstiftender, erleuchteter Heros?
Er hat sein Kreuz weggeworfen und das Zepter wieder genommen; zur selben Stunde, wie sein Tempel auf dem Mont de Mars (früher Mont des Martyres genannt) fertig ist, wird er kommen und selbst die Welt regieren; wird vom Thron stossen den ungetreuen Stellvertreter, der es zu eng findet in den elftausend Zimmern, die man in "infamia Vaticani loca" gezählt hat; der sich über seine luxusgefüllte Gefangenschaft beklagt und die Zeit mit kleinen Ausschweifungen auf das Feld der Poesie tötet.
Den Erlöser verlassend, wundere ich mich, als ich zum Saint-Sulpice-Markt komme, dass die Kirche so sehr entfernt zu liegen scheint. Sie hat sich mindestens ein Kilometer zurückgezogen, und die Fontäne im Verhältnis dazu. Habe ich den Sinn für Distanzmessen verloren? An den Mauern des Seminars entlang gehend, meine ich, es nimmt nie ein Ende, so unermesslich kommt es mir diesen Abend vor. Ich wende eine halbe Stunde an, um dieses Stückchen der Rue Bonaparte zu gehen, das sonst nur fünf Minuten erfordert. Und vor mir her schreitet eine Figur, deren Gang und Art mich an jemand erinnern, den ich kenne. Ich beschleunige meine Schritte, ich laufe, aber der Unbekannte setzt seinen Weg mit so genau übereinstimmender Schnelligkeit fort, dass es mir nicht gelingt, den Abstand, der uns trennt, zu verkürzen.
Schliesslich habe ich das Gittertor des Luxemburg erreicht. Der Garten, der bei Sonnenuntergang geschlossen wird, liegt in Ruhe und Einsamkeit, die Bäume sind nackt und die Rabatten von Frost und Stürmen des Herbstes verwüstet. Aber er riecht gut, er dunstet einen Duft von trocknen Blättern und frischem Humus aus.
Der Einhegung folgend, gehe ich die Rue de Luxembourg hinauf und sehe immer vor mir den Unbekannten, der mich zu interessieren beginnt. In eine Pilgerkutte gekleidet, die meiner gleicht, aber von opalweisser Farbe, und schlanker und grösser als ich, geht er vorwärts, wenn ich es tue, bleibt stehen, wenn ich stehen bleibe; er scheint von meinen Bewegungen abzuhängen, und es sieht aus, als sei ich sein Wegweiser. Aber ein Umstand zieht ihm ganz besonders meine Aufmerksamkeit zu, nämlich, dass sein Mantel in einem heftigen Wind flattert, von dem ich nichts merke. Um darüber ins klare zu kommen, zünde ich eine Zigarette an; da ich wahrnehme, wie der Rauch gerade aufsteigt, ohne nach der Seite abzuweichen, wird meine Überzeugung, dass es nicht windig ist, bestätigt. Übrigens rühren sich die Bäume und Büsche drinnen im Garten nicht.
Nachdem wir zur Rue Vavin gekommen sind, biege ich rechts ab und im selben Augenblick finde ich mich vom Trottoir mitten in den Garten versetzt, ohne zu verstehen, wie es zugegangen ist, da die Pforten geschlossen waren.
Vor mir, zwanzig Schritte entfernt, steht mein Begleiter, mir zugewendet, und sein bartloses, blendendweisses Gesicht breitet einen leuchtenden Dunstkreis in Form einer Ellipse, deren Mittelpunkt von dem Unbekannten eingenommen wird. Nachdem er mir ein Zeichen gegeben hat, ihm zu folgen, geht er weiter und führt seinen Strahlenkranz mit sich, so dass der düstere, kalte und schmutzige Garten hell wird, wo er geht. Und noch mehr, die Bäume, die Büsche, die Kräuter grünen und kleiden sich in Blüten, und zwar in einer Ausdehnung, die mit dem Bereich seiner Strahlenglorie übereinstimmt, erlöschen aber wieder, wenn er vorbei ist. Ich kenne die grossen Cannagewächse mit Blättern wie Elefantenohren oberhalb der Statuengruppe Adam und seine Familie wohl wieder, wie das Beet von Salvia fulgens, der feuerroten Salbei, den Pfirsichbaum, die Rosen, die Bananenpflanze, die Aloen, alle meine alten Bekannten und jeder auf seinem Platz. Das einzige ist, dass die Jahreszeiten durcheinander gemischt zu sein scheinen, so dass die Frühlingsblumen gleichzeitig sind mit den Herbstblumen.
Was mich aber am allermeisten verwundert, ist, dass nichts von all dem mich verwundert, sondern dass alles erscheint, als sei es ganz natürlich und wie es sein soll. So, als ich am Bienengarten vorbeigehe, schwärmt ein Bienenschwarm um die Stöcke und nimmt die Blumen daneben in Angriff, aber auf einem so genau abgesteckten Umkreis, dass die Insekten im selben Augenblick, wie sie in den Schatten hineinfliegen, verschwinden, und dass der beleuchtete Teil einer Salbei mit Blättern und Blüten bedeckt ist, während der beschattete Teil welk und vom Reif schwarzgebrannt bleibt.
Unter den Kastanienbäumen wird das Schauspiel hinreissend schön, als unter dem Laubwerk ein leeres Waldtaubennest auf einmal von girrenden Gatten eingenommen ist.
Schliesslich sind wir am Fleurus-Tor angelangt, wo mein Wegweiser mir ein Zeichen gibt, stehen zu bleiben, und in einer Sekunde ist er an das andere Ende des Gartens, ans Gay-Lussac-Tor, versetzt; eine Entfernung, die mir unermesslich erscheint, obgleich sie nur ein halbes Kilometer umfasst; und trotz der Entfernung kann ich den Unbekannten von seinem ovalen Lichtrand umgeben sehen. Ohne ein Wort hervorzubringen, befiehlt er mir mit kleinen Bewegungen der Mundmuskeln, mich zu nähern. Ich glaube seine Ansicht zu begreifen, in dem ich die endlose Allee zurücklege, den Hippodrom, den ich seit Jahren wohl kenne; in der Ferne begrenzt ihn das Kreuz des Pantheon, das sich in blutroter Farbe auf dem schwarzen Himmel abzeichnet.
Der Weg des Kreuzes, und vielleicht die vierzehn Stationen! wenn ich nicht irre. Ehe ich beginne mache ich Zeichen, dass ich sprechen, fragen, Aufklärung erhalten will; und mein Wegweiser antwortet mit einer Neigung des Hauptes, dass er bereit sei, zu hören, was ich vorzubringen habe.
Im selben Augenblick ändert der Unbekannte den Platz, ohne die kleinste Bewegung oder das geringste Rascheln vernehmen zu lassen; das einzige, was ich merke, ist, dass er, als er mir näher kommt, einen balsamischen Duft verbreitet, der mein Herz und meine Lungen schwellen lässt und mir Mut einflösst, den Strauss zu wagen.
Und ich beginne mein Verhör.
—Du bist es, der mich seit zwei Jahren verfolgt; was wünschest du von mir?
Ohne den Mund zu öffnen, antwortet mir der Unbekannte mit einer Art Lächeln voll übermenschlicher Güte, Nachsicht und Bildung:
—Warum fragst du mich, da du die Antwort selbst kennst? Und wie in meinem Innern höre ich eine Stimme widerklingen:
—Ich wünsche dich zu einem höheren Leben zu erheben? Dich aus dem Schmutz zu ziehen.
—Geboren aus dem Schmutz, geschaffen für das Niedrige, mich vom Moder nährend, wie soll ich anders von der Grobheit befreit werden als durch den Tod? Nimm denn mein Leben!—Du willst nicht! Die auferlegten Strafen sollen also die Mittel zur Erziehung ausmachen. Aber ich versichere dir, die Demütigungen machen mich hochmütig, der Verzicht auf die kleinen Genüsse des Lebens erzeugt Verlangen, Fasten ruft Schwelgerei hervor, was nicht meine Haussünde ist; die Keuschheit verschärft die Begierde des Fleisches, die aufgezwungene Einsamkeit erzeugt Liebe zur Welt und ihren ungesunden Vergnügungen, Armut gebiert Geiz; und die schlechte Gesellschaft, auf die ich angewiesen bin, flösst mir Menschenverachtung ein und erregt in mir den Argwohn, dass die Gerechtigkeit schlecht gehandhabt wird. Ja, in gewissen Augenblicken scheint es, als sei die Vorsehung ungenügend unterrichtet von ihren Satrapen, denen sie die Regierung über die Menschenwelt anvertraut hat; dass ihre Präfekten und Unterpräfekten sich Unterschleife, Fälschungen, unbegründete Anzeigen zu schulden kommen lassen. So ist es mir geschehen, dass ich bestraft worden bin, wo andere gesündigt haben; Prozesse gehalten worden sind, bei denen ich nicht nur unschuldig war, sondern noch dazu Verteidiger der Billigkeit und Ankläger des Verbrechens; und gleichwohl hat die Strafe mich getroffen, während der Schuldige triumphierte. Gestatte eine offene Frage: sind etwa Frauen zu Mitregentinnen angenommen worden? Die gegenwärtige Regierungsart scheint mir so reizbar, so kleinlich zu sein, so ungerecht, ja ungerecht! Jedes Mal, wenn ich eine gerechte und gesetzliche Sache gegen eine Frau geführt habe, ist sie, wie gemein sie auch gewesen sein mag, freigesprochen und ich bin verurteilt worden! Du willst nicht antworten! Und da forderst du von mir, dass ich die Verbrecherischen lieben soll, die Seelenmörder, die das Gemüt vergiften und die Wahrheit verfälschen, die Meineidigen! Nein, tausendmal nein! "Ewiger, sollte ich nicht die hassen, die dich hassen? Sollte mir nicht grauen vor denen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie aus dem Grunde: ich halte sie für meine Feinde." So spricht der Psalmist, und ich füge hinzu: ich hasse die Bösen, so wie ich mich selbst hasse! Und mein Gebet ist dieses: Strafe, o Herr, die mich verfolgen mit Lügen und Bosheiten, wie du mich gestraft hast, wenn ich boshaft und lügnerisch gewesen war! Habe ich nun gelästert, habe ich nun den Ewigen beschimpft, Jesu Christi Vater, den Gott des Alten und Neuen Testamentes? Ehemals hörte er auf die Einwürfe der Sterblichen und erlaubte den Angeklagten, sich zu verteidigen. Höre nur, wie Moses seine Verteidigungsrede vor dem Herrn formte, als die Israeliten Ekel vor dem Manna bekommen hatten: "Warum bekümmerst du deinen Diener? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du so die ganze Last des Volkes auf mich legst? Habe ich nun alles dieses Volk empfangen und geboren, dass du zu mir sagst: Trage sie auf deinen Armen, wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Väter zugeschworen hast? Woher soll ich nun Fleisch nehmen, das ich allen diesem Volk gebe? Denn sie weinen vor mir und sprechen: Gib uns Fleisch, dass wir essen. Ich vermag nicht allein zu tragen alles dieses Volk, denn es ist mir zu schwer." Ist das nicht Freimütigkeit von einem Sterblichen? Ist sie ganz gebührlich, diese Rede eines zornigen Dieners? Und sein Herr erschlägt den Aufrührerischen nicht mit dem Donnerkeil, sondern lässt sich belehren und nimmt ihm seine Last ab, indem er siebzig Anführer auswählt, die mit Moses die Bürde des Volkes teilen. Des Ewigen Art, das Volk zu erhören, da es ihm um Fleisch zum Essen anruft, ist nur ein bisschen verächtlich, wie die eines gutmütigen Vaters, der sich den Wünschen seiner unverständigen Kinder fügt: "Darum wird euch der Herr Fleisch geben, auf dass ihr esset: Nicht einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang; sondern einen Monat lang, bis dass es euch zur Nase ausgehe und euch ein Ekel werde." Das ist ein Gott nach meinem Ideal, und er ist derselbe, den Hiob anruft: "O, dass es dem Menschen erlaubt wäre, mit Gott zu rechten, so wie ein Mann tut mit seinem vertrauten Freund!" Aber ohne diesen Zustand abzuwarten, nimmt der mit Unglück Geschlagene sich die Freiheit, Erklärungen von dem Herrn zu verlangen über die schlechte Behandlung, der er ausgesetzt worden ist. "Ich werde zu Gott sagen: Verdamme mich nicht; zeige mir, warum du gegen mich ins Gericht gegangen bist. Kann es dir gefallen, mich niederzudrücken, deiner Hände Werk zu verwerfen und die Absichten der Boshaften zu fördern?" Das sind doch Vorwürfe und Beschuldigungen, die der gute Gott ohne Groll hinnimmt, und auf die er antwortet, ohne sich des Donners zu bedienen. Wo ist er, der himmlische Vater, der zu den Torheiten der Kinder gutmütig lächeln und verzeihen konnte, nachdem er gestraft hatte? Wo verbirgt er sich, der Hausherr, der das Haus in guter Ordnung hielt und die Aufseher überwachte, um Ungerechtigkeiten zu hindern? Ist er vom Sohn abgesetzt worden, dem Idealisten, der sich nicht mit weltlichen Dingen befasst? Oder überlieferte er uns dem Fürsten dieser Welt, der Satan genannt wird, als er nach dem Fall der ersten Menschen seinen Fluch über die Erde schleuderte?
Während dieser meiner unzusammenhängenden Verteidigungsrede betrachtete der Unbekannte mich mit demselben nachsichtigen Lächeln, ohne Ungeduld zu verraten; als ich aber zu Ende gekommen war, war er verschwunden, eine erstickende Atmosphäre von Kohlenoxyd um mich zurücklassend, und ich fand mich einsam stehend auf der düsteren, schmutzigen, herbstschauerlichen Rue Medicis.
Während ich den Boulevard St. Michel hinunterging, war ich auf mich selbst ärgerlich, dass ich die Gelegenheit versäumt hatte, alles rund heraus zu sagen. Ich hatte noch viele Pfeile im Köcher, wenn nur der Unbekannte geruht hätte, zu antworten oder eine Anklage gegen mich zu richten.
Aber im selben Augenblick, wie sich jetzt die Menschenmenge um mich drängt, im starken Schein der Gaslaternen, und alle Realitäten der ausgestellten Handelswaren mich wieder an das Leben in seiner ganzen Kleinlichkeit erinnern, erscheint mir die Szene im Garten wie ein Wunder, und ich eile erschreckt nach meiner Wohnung, wo Meditationen mich in einen Abgrund von Zweifel und Angst versenken.
Etwas trägt sich zu in der Welt, und die Menschen warten auf etwas Neues, das sich in Schimmern hat wahrnehmen lassen. Es ist das Mittelalter, die Zeit des Glaubens und der Glaubenslehre, das in Frankreich wieder im Anzuge ist, nachdem es durch den Sturz eines Kaisertums und eines Miniatur-Augustus eingeleitet worden, ganz wie beim Verfall der Römermacht und den Einfällen der Barbaren; und man hat Paris-Rom in Flammen stehen und die Goten sich im Kapitol-Versailles krönen sehen. Die grossen Heiden Taine und Renan sind zur Vernichtung hinabgestiegen und haben ihren Skeptizismus mit sich genommen; aber Jeanne d'Arc ist wieder zum Leben erwacht. Die Christen werden verfolgt, ihre Prozessionen von Gendarmen auseinander getrieben, während an den Karnevalstagen Saturnalien gefeiert werden und ihre Schändlichkeiten auf offener Strasse ausbreiten, unter dem Schutz der Polizei und mit dem Gelde der Regierung, die den Unzufriedenen zum Trost Circenses bietet, mit oder ohne durch Gladiatoren gefällte wilde Tiere. Panem et circenses, (teures) Brot und Zirkusspiel! Alles ist feil für Geld; Ehre, Gewissen, Vaterland, Liebe, Rechtsprechung: wahrhaftig beweisende und regelrechte Symptome des Auflösungsprozesses einer Gesellschaft, bei der das Wort und die Sache Tugend seit dreissig Jahren in den Bann getan ist.
Das ist doch Mittelalter, Tracht und Haar des Primitiv-Weibes. Die jungen Männer kleiden sich in Mönchskutten, schneiden das Haar mit Tonsur und träumen von Klosterleben; schreiben Legenden und führen Mirakelspiele auf, malen Madonnen und schnitzen Christusbilder, Eingebung aus der Mystik des Magiers holend, der sie mit Tristan und Isolde, Parcifal und Gral verzaubert hat. Die Kreuzzüge beginnen von neuem, gegen Türken und gegen Juden; die Antisemiten und Philhellenen sorgen für die Sache. Die Magie und Alchemie haben sich schon eingenistet, und man wartet auf den ersten beweisbaren Fall von Verhexung, um den Scheiterhaufen zu errichten als Folge der Hexenprozesse. Mittelalter! Die Wallfahrten nach Lourdes, Tilli-sur-Seine, Rue Jean Goujon! Und selbst der Himmel gibt der dumpf und stumpf gewordenen Welt Zeichen, sich bereit zu halten; der Herr spricht durch Wasserhosen, Cyklone, Überschwemmungen, Donnerschläge.
Mittelalter ist der Aussatz, der von neuem auftritt und gegen den die Ärzte von Paris und Berlin soeben ein Bündnis geschlossen haben.
Das schöne Mittelalter, als die Menschen zu geniessen und zu leiden verstanden, als die Kraft und die Liebe, die Schönheit in Farbe, Linienspiel und Harmonie sich zum letzten Mal offenbarten, ehe sie durch die Renaissance des Heidentums, die man Protestantismus nennt, ertränkt und niedergesäbelt wurden.
Der Abend ist da, und ich brenne vor Sehnsucht, die Begegnung mit dem Unbekannten zu erneuern, wohl vorbereitet, wie ich jetzt bin, alles zu gestehen, und mich zu verteidigen, ehe ich verurteilt werde.
Nachdem ich mein tristes Mittagessen eingenommen habe, gehe ich also den Calvarienweg die Rue Bonaparte hinauf. Niemals ist mir diese Strasse so gross vorgekommen, wie jetzt am Abend, und die Ladenfenster gähnen wie Abgründe, in denen Christus in vielfacher Gestalt auftritt, bald gemartert, bald triumphierend. Und ich gehe und gehe, während mir der Schweiss in grossen Tropfen rinnt und die Stiefelsohlen gegen die Füsse brennen, ohne dass ich doch einen Schritt vorwärts komme. Bin ich Ahasver, der dem Erlöser einen Trunk Wasser verweigert hat, und bin ich jetzt, da ich ihm zu folgen und ihm nachzueifern wünsche, unfähig, mich ihm zu nähern?
Schliesslich und ohne selbst zu wissen wie, befinde ich mich vor dem Fleurus-Tor und im nächsten Augenblick im Garten, der dunkel, feucht und still da liegt. Sofort setzt ein Windstoss das Gerippe der Bäume in Zittern, und der Unbekannte nimmt eher Stellung, als dass er sich nähert, in seiner Hülle von Licht und Sommer.
Mit demselben Lächeln wie das vorige Mal, ladet er mich mit einem Zeichen ein, zu sprechen.
Und ich spreche!
—Was verlangst du von mir, und warum plagst du mich mit deinem Christus? Vor einigen Tagen legtest du mir auf unverkennbare Weise "Christi Nachfolge" in die Hand, und ich las das Buch wie in meiner Jugend, als ich die Welt verachten lernte. Wie kann ich recht haben, des Ewigen Schöpfung und die schöne Erde zu verachten? Und wohin hat deine Weisheit mich geführt? Dazu meine Angelegenheiten zu versäumen, dass ich für meine Mitmenschen eine Last geworden bin, dass ich als Bettler geendet habe. Dieses Buch, das Freundschaft verbietet, das den Verkehr mit der Welt in den Bann tut, das Einsamkeit und Entsagung fordert, ist für einen Mönch geschrieben und ich habe nicht das Recht, Mönch zu werden und mich der Gefahr auszusetzen, dass meine Kinder aus Mangel umkommen. Sieh, wohin die Liebe zu einsamen Leben mich geführt hat! Auf der einen Seite befiehlst du ein Eremitenleben, und sobald ich mich von der Welt zurückziehe, werde ich von den Dämonen der Verrücktheit angegriffen, meine Angelegenheiten geraten in Unordnung, und in meiner Isolierung besitze ich keinen Freund mehr, von dem ich Hilfe begehren könnte. Auf der anderen Seite, sobald ich Menschen aufsuche, treffe ich die Schlimmsten, die mich mit ihrem Hochmut quälen, und zwar nach dem Mass meiner Demut; denn ich bin demütig und behandle alle als gleiche, bis sie mich unter ihre Füsse treten; dann benehme ich mich wie der Wurm, der den Kopf erhebt aber nicht zu beissen vermag. Was verlangst du denn von mir? Mich um jeden Preis martern zu können, ob ich deinen Willen tue oder ihn verachte! Willst du mich zum Propheten machen? Das ist zu grosse Ehre für mich, und ich ermangele der Berufung. Übrigens kann ich die Haltung eines solchen nicht anlegen, weil alle Propheten, die ich gekannt habe, schliesslich entlarvt worden sind, halb als Charlatane, halb als verrückte Gesellen, und ihre Prophezeiungen sind nie eingetroffen. Und noch mehr, wenn du mir eine Berufung vorbehalten hast, müsste ich mit der Gnade der Auserwählung beschenkt worden ein; müsste befreit sein von allen verderblichen Leidenschaften, die erniedrigend für einen Prediger sind; meine Lebensbahn müsste von Anfang an unterstützt worden sein, statt dass ich jetzt von der Armut beschmutzt worden bin, die den Charakter verdirbt und einem die Hände bindet. Es ist wohl wahr, und ich gebe es zu, dass die Weltverachtung mich dazu geführt hat, mich selbst zu verachten und meinen Ruf durch Geringschätzung der Ehre zu schädigen; und ich gestehe ein, dass ich mich meiner Person schlecht angenommen habe, aber das ist infolge der Überlegenheit meines besseren Ichs geschehen, das sich aus dem unreinen Futteral erhob, in das du meine unsterbliche Seele gesteckt hast. Schon von den Kinderjahren an habe ich Reinheit und Tugend geliebt, ja das habe ich. Und doch hat mein Leben sich durch Unsauberkeit und Laster geschleppt, so dass ich oft glaube, die Sünden seien als Strafen auferlegt worden, und in der Absicht, dauernden Ekel vor dem Leben selbst zu erzeugen. Warum hast du mich zur Undankbarkeit verurteilt, die ich am meisten von allen Lastern verabscheue? Mir, der von Natur erkenntlich ist, hast du Schlingen gelegt, um mich zu zwingen, in Verbindlichkeit zu dem ersten Besten zu geraten. So bin ich in Abhängigkeit und Sklaverei verwickelt worden. Da die Wohltäter als Entgelt die Gedanken, Wünsche, Neigungen und Ergebenheitsgefühle verlangen, mit einem Wort die ganze Seele, bin ich immer gezwungen worden, mich schuldbeladen und undankbar zurückzuziehen, um meine Persönlichkeit und meine menschliche Würde zu retten; gezwungen worden, die Bande zu zerreissen, die meine unsterbliche Seele zu erwürgen drohten. Und zwar mit der Seelenqual und den Gewissensbissen eines Diebes, der mit fremdem Eigentum seiner Wege geht.
Und jetzt, da ich anfange meine Seele zu pflegen nach den Geboten in "Christi Nachfolge", ist es billig, von einem Menschen zu fordern, dass er sich Gott selbst zum Muster nehmen und sich einbilden soll, imstande zu sein, sich die Vollkommenheit des Vollkommenen zu erwerben? Das heisst ihm Grössenwahn einblasen. Aber wenn er nun durch die Unmöglichkeit, dem Erlöser nachzueifern, zur Einsicht über das Unsinnige seiner Absichten kommt, versinkt er in Verzweiflung und endet damit, in der Erfüllung seiner weltlichen Pflichten und in geistigen Genüssen Trost zu suchen. Wenn die Weisheit dieser Welt der Verachtung wert ist, warum lässt du uns in Schulden erziehen, in denen man Prügel bekommt, um die grossen Gelehrten verehren, die Heroen der Literatur, Künste, Wissenschaft lobpreisen zu lernen? Nein, dem Ewigen nachzueifern ist gottlos, und wehe dem, der sich die Fähigkeit zutraut. Da ist es bescheidener Mensch zu bleiben und sich nach den Besten unter den sündigen Sterblichen zu formen suchen, als davon zu träumen, den Göttern gleich zu werden. In diesem Fall sündigt man wenigstens nicht durch Hochmut, der die Todsünde ist. Jesu Christi Nachfolge macht mich zu einem Heuchler. Indem ich meinen Hass gegen die Bösen unterdrücke, lerne ich Nachsicht gegen die Bosheit und damit gegen mich selbst, während ich in der Tiefe meines Herzens meinen gerechten Unwillen bewahre. Böses mit Gutem vergelten, heisst das Laster, den Hochmut ermuntern; und die Apostel haben mich gelehrt, dass man gegenseitig die Fehler berichtigen soll, und ich versichere, dass meine Mitmenschen mich nie geschont haben.
Genau genommen, habe ich dadurch, dass ich den Königsweg des Kreuzes wählte, mich in die Dornenhecken der Theologie verstrickt, so dass Zweifel, schrecklicher als je, sich meines Geistes bemächtigt und geradezu in mein Ohr geflüstert haben, dass alles Unglück, alle Ungerechtigkeit, das ganze Erlösungswerk nur eine ungeheure Prüfung sei, der man tapfer standhalten müsse. In manchen Augenblicken glaube ich, dass Swedenborg mit seinen grauenhaften Höllen nichts anders ist als eine Feuer-und Wasserprobe, die man durchmachen muss; und obgleich ich in einer Dankbarkeitsschuld, die nie bezahlt werden kann, zu diesem Propheten stehe, der mich vom Wahnsinn gerettet hat, fühle ich in meinem Herzen immer wieder ein brennendes Verlangen, ihn zu verwerfen, ihm zu trotzen, als dem Geist einer Bosheit, der darauf erpicht ist, meine Seele zu verschlingen, um mich zu seinem Sklaven zu machen, nachdem er mich zu Verzweiflung und Selbstmord getrieben hat. Ja, er hat sich zwischen mich und meinen Gott geschlichen, dessen Platz er hat einnehmen wollen. Er ist es, der mich durch die Schrecken der Nacht bezwingt, und mir mit Wahnsinn droht. Mag sein, dass er sein Amt vollbracht hat, mich zum Herrn zurückzuführen, auf dass ich mich vor dem Ewigen beuge! Mag sein, dass seine Höllen nur eine Vogelscheuche sind, ich nehme sie hin als solche, aber ich glaube nicht mehr an sie, und ich habe kein Recht, an sie zu glauben, ohne den guten Gott zu verunglimpfen, der fordert, dass wir vergeben sollen, weil er selbst vergeben kann. Wenn Unglück und Trübsale, die mich treffen, nicht Strafen sind, so sind sie Aufnahmeprüfungen. Ich bin geneigt sie auf diese Weise auszulegen, und Christus mag das Muster sein, da er viel gelitten hat, obwohl ich nicht begreife, wozu so viel Leiden dient, wenn es nicht einen Vordergrund bilden soll, um die Wirkung der zukünftigen Seeligkeit zu erhöhen. Ich habe gesprochen! Gib mir jetzt Antwort!
Aber der Unbekannte, der mit bewundernswerter Geduld zugehört hatte, antwortete nur mit einer Miene milden Spottes und verschwand, mich in einer Atmosphäre zurücklassend, die nach Phenol stank.
Hinaus auf die Strasse versetzt, werde ich nach meiner Gewohnheit wütend, dass ich meine besten Argumente vergessen habe, die immer auftauchen, wenn es zu spät ist; und nun rollt sich eine ganze lange Rede auf, während mir das Herz schwillt und der Mut sich aufs neue hebt. Der furchtbare und teilnehmende Unbekannte hatte mir ja auf jeden Fall zugehört, ohne mich zu zermalmen. Er hat also geruht, auf Gründe zu hören, und er wird jetzt die Ungerechtigkeit erwägen, deren Opfer ich gewesen bin. Vielleicht ist es mir geradezu gelungen, ihn zu überzeugen, da er ja stehen blieb und keine Antwort gab.
Und die alte Einbildung, dass ich Hiob sei, schleicht sich in mein Gemüt. Ich habe ja wirklich mein Eigentum verloren, man hat meine bewegliche Habe, Bücher, Existenzmittel, Frau und Kinder genommen; gejagt von einem Lande zum andern, bin ich zu einsamen Leben in der Wüste verurteilt worden. Habe ich diese Klagelieder geschrieben oder ist es Hiob? "Meine Nächsten haben mich verlassen, und meine Freunde haben mich vergessen. Mein Weib stellt sich fremde meinem Geist, und meine Bitten erreichen nicht die Söhne meiner Mutter. Verachten mich auch die kleinen Kinder. Er hat mich zum Sprichwort gemacht unter den Leuten, und ich bin ein Saitenspiel für sie geworden. Ich treffe nur Verleumder, und mein Auge steht wach die ganze Nacht, während sie meine Seele stechen. Meine Haut bricht und löst sich auf. Wenn ich sage: Das Bett soll mir Trost geben und fortnehmen etwas von er Plage, so erschreckst du mich mit Träumen und beunruhigst mich mit Gesichten."
Das trifft entschieden bei mir zu: die Risse in der Haut, die Träume und die Visionen, alles stimmt. Aber dazu kommt ein Überschuss auf meine Rechnung: ich habe die äussersten Qualen ertragen, als zwingende Umstände, die von den Mächten gelenkt wurden, mich nötigten, die einfachsten Pflichten eines Mannes unerfüllt zu lassen: seine Kinder zu unterhalten. Hiob zog sich aus dem Spiele mit rein erhaltener Ehre, für mich ging alles verloren, sogar die Ehre, und doch überwand ich die Versuchung, mich selbst zu töten: ich besass den Mut, entehrt zu leben.
Alles in allem, ich bin jedoch nicht so verwerflich, und wenn ich der Gnade nicht würdig bin, kann ich Gutes von der Barmherzigkeit geniessen. Fünfundzwanzig Jahre lang habe ich Dienst getan als Henker und mich schliesslich als ein tüchtiger erwiesen, indem ich mich selbst hinrichtete, öffentlich vor den Menschen, die diesen meinen Akt von Selbsterkenntnis mit einstimmigen Beifall begrüsst haben.
Wenn ich in den Missgeschicken und Schiffbrüchen, die mich wahllos getroffen haben, nicht Güte habe finden können, sondern Übelwollen, bin ich schlechter als der untadelige Diener des Ewigen? Die Liebe, die Güte zeigt sich bei uns Sterblichen durch ergebene herzenswarme Handlungen und Worte, und ein guter Vater erzieht seine Kinder mit Zärtlichkeit und nicht mit den raffiniertesten Grausamkeiten!
Wie unbeholfen ich war, dass ich vergass, das alles dem Unbekannten zu sagen. Aber das nächste Mal werde ich den Schaden wieder gut machen.
Drei Monate lang suchte ich vergebens persönliche Verbindungen mit der Swedenborg-Gesellschaft in Paris einzuleiten. Eine ganze Woche gehe ich jeden Morgen nach dem Pantheon hinauf, um die Rue Thouin zu erreichen, wo Kapelle und Bibliothek des schwedischen Propheten liegen. Schliesslich treffe ich jemand, der mir sagt, dass der Bibliothekar nur nachmittags empfängt, gerade zu der Zeit, wo ich allein mit meinen Gedanken sein will und zu müde bin, um Spaziergänge zu machen. Gleichwohl mache ich immer wieder den Versuch, nach der Rue Thouin zu kommen. Das erste Mal fühle ich mich beim Fortgehen unbehaglich niedergedrückt, und am Ende der Saint-Michel-Brücke artete dieses Gefühl zu einer Angst aus, die mich zwang, nach Hause zurückzukehren. Ein ander Mal ist es Sonntag, und man will Gottesdienst halten. Ich komme eine Stunde zu früh, und meine Kräfte reichen nicht aus, eine Stunde auf der Strasse zuzubringen. Das dritte Mal finde ich auf der Rue Thouin das Pflaster aufgerissen, und Arbeiter versperren den Weg mit ihren Gestellen und Gerätschaften. Da denke ich, dass es nicht Swedenborg sein darf, der mich auf den guten Weg führen soll, und unter dem Eindruck dieser Ahnung kehre ich um. Bei der Heimkehr fällt mir ein, dass ich mich von Swedenborgs unsichtbaren Feinden habe betrügen lassen, und dass ich sie bekämpfen muss. Der letzte Versuch wird im Wagen vorgenommen. Dieses Mal ist die Strasse barrikadiert, wie um ausdrücklich meine Absichten zu hindern. Ich steige aus dem Wagen, klettere über Hindernisse; als ich aber an der Tür des Swedenborghauses anlange, sind Trottoir und Treppe fortgenommen. Trotz allem schlage ich mich nach dem Eingang durch, ziehe am Glockenstrang und ... erfahre von einem Unbekannten, dass der Bibliothekar krank ist.
Mit einer Art Linderung in der Seele kehre ich der düsteren und dürftigen Kapelle mit ihren dunklen Fensterscheiben, die von Regen und Staub beschmutzt sind, den Rücken. Es hatte mich immer abgestossen, dieses Haus in strengem, barbarischem, schwermütigem Methodistenstil, dessen Mangel an Schönheit mich an den Protestantismus des Nordens erinnerte, und erst nach ernsten Kämpfen gegen meinen Hochmut verstand ich mich dazu, dort Eintritt zu suchen. Eine Frömmigkeitspflicht gegen Swedenborg, weiter nichts. Als ich mit leichtem Herzen umkehrte, gewahre ich auf dem Trottoir ein verzinntes Eisenstückchen, wie ein Kleeblatt geformt, und aus Aberglauben nehme ich es auf. Und sogleich wird eine Erinnerung zum Leben erweckt. Als ich nämlich das Jahr vorher, den 2. November in dem schrecklichen Jahr 1896, eines Morgens in Klam in Österreich promenierte, ging die Sonne hinter einer Wolkenwand in Form eines Bogens mit kleeförmigen Aussenlinien auf, der von blauen und weissen Strahlen umgeben war. Und diese Wolke glich meinem verzinnten Eisenblech wie zwei Wassertropfen einander gleichen; mein Tagebuch, in dem noch die Zeichnung zu finden ist, kann diese Tatsache bestätigen.
Was soll dies bedeuten? Die Dreieinigkeit, das ist klar. Und weiter?—
Ich verlasse die Rue Thouin, froh wie ein Schuljunge, der einer schweren Aufgabe entronnen ist, weil der Lehrer krank geworden. Und als ich am Pantheon vorbeigehe, finde ich den Tempel geöffnet, das grosse Tor sperrweit auf, und zwar auf eine herausfordernde Weise, die mir zurief: tritt nur ein. Tatsächlich habe ich trotz meinem langen Aufenthalt in Paris niemals diese Kirche besucht, hauptsächlich weil man mir über die Wandgemälde Lügen erzählt und versichert hat, sie behandeln Stoffe aus der Geschichte der Gegenwart, vor der ich Abscheu empfinde. Man denke sich mein Entzücken, als ich eintrete und eine Lichtdusche empfange, die vom Mittelgewölbe fällt, und mich mitten in einer goldenen Legende befinde, Frankreichs heiliger Geschichte, die unmittelbar vor dem Protestantismus schliesst. Die mehrdeutige Inschrift draussen "Aux grands hommes" hatte mich also betrogen. Wenig Könige, noch weniger Generäle und nicht ein Abgeordneter; ich atme wieder. Dagegen St. Denis, die heilige Genoveva, Ludwig der Heilige, St. Jeanne (d'Arc). Nie hätte ich geglaubt, dass die Republik in dem Grad katholisch wäre. Fehlt nur der Altar, das Tabernakel, und an Stelle des Gekreuzigten und der Himmelsmutter ist das Bild einer weltlichen Frau hier von Frauenverehrung errichtet; doch ich tröste mich mit dem Gedanken, dass diese Berühmtheit schliesslich unten in den Kloaken landen wird, wie so viele andere und ehrenvollere. Es ist schön und lieblich, in diesem Tempel, welcher der Heiligkeit geweiht ist, umher zu gehen, aber zugleich betrübt es, wenn man sieht, wie man die Tugendhaften und Wohltätigen enthauptet.
Muss man sich nicht um der Ehre des guten Gottes willen vorstellen, dass alle diese Fälle von schlechter Behandlung, die den Gerechten und Barmherzigen zuteil geworden, nur scheinbare Massregeln sind; und dass, wie wenig ermunternde sich auch der Weg der Tugend zeigen mag, der doch zu einem guten Endpunkt führt, der unserer Auffassung verborgen ist? Sonst müssten die Höllen dieser Schaffots und Scheiterhaufen, die den Heiligen angesichts triumphierender Henker vorbehalten sind, uns auf lästerliche Gedanken bringen über die Güte des höchsten Richters, der die Heiligkeit im Erdenleben zu hassen und zu verfolgen scheint, um sie in einer höheren Welt zu belohnen: "die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten."
Indessen werfe ich, als ich aus der Kirche trete, einen Blick nach der Rue Thouin und wundere mich, dass der Weg zu Swedenborg mich in den Tempel der heiligen Genoveva geführt hat. Swedenborg, mein Wegweiser und Prophet, hat mich gehindert nach seiner bescheidenen Kapelle zu gehen: hat er sich denn selbst verworfen und ist jetzt besser unterrichtet worden, so dass er sich zum Katholiken bekehrt hat? Während ich die Arbeiten des schwedischen Sehers studierte, hat es mich betroffen, wie er sich als Gegner Luther gegenüberstellt, der den Glauben allein pries; und in der Tat ist Swedenborg katholischer als er sich den Anschein hat geben wollen, da er den Glauben und die Werke gepredigt hat, ganz wie die römische Kirche.
Wenn es sich so verhält, dann bekämpft er sich selbst, und ich, sein Adept, werde zwischen Amboss und Hammer zermahlen werden.
Eines Abends nach einem von Gewissenbissen und Zweifeln erfüllten Tag, begab ich mich, nachdem ich mein einsames Mittagsmahl eingenommen hatte, nach dem Garten, der mich an sich lockt wie ein Gethsemane, wo unbekannte Leiden meiner warten. Ich habe ein Vorgefühl der Qualen und kann nicht entfliehen. Ich ersehne sie fast, wie der Verwundete sich einer grausamen Operation zu unterziehen wünscht, die ihm Genesung oder den Tod bringen wird.
Am Fleurus-Tor angelangt, befinde ich mich sogleich drinnen auf der Rennbahn, die in der Ferne vom Pantheon und dem Kreuz begrenzt wird. Vor zwei Jahren bezeichnete dieser Tempel für meinen weltlichen Sinn die Ehre, die "grossen Männern" gewidmet wird; jetzt lege ich das aus: den Märtyrern und den Leiden, die sie ausgestanden haben; so hat sich mein Gesichtspunkt verändert.
Die Abwesenheit des Unbekannten macht mich unruhig und ich empfinde eine Beklemmung der Brust. Einsam und zur Fehde bereit, fühle ich mich aus Mangel an einem sichtbaren Gegner matt werden. Gegen Schemen, Schatten zu kämpfen, das ist schlimmer als gegen Drachen und Löwen! Schrecken ergreift mich, und von dem Mut des Furchtsamen getrieben, gehe ich auf dem schlüpfrigen Boden zwischen den Platanen mit festen Schritten weiter. Ein eingeschlossener Geruch von schmutzigem Kabeljau, mit Teer und Talg gemischt, erstickt mich; ich höre das Schwappen der Wogen gegen Schiffsrümpfe und einen Kai; ich werde in den Hof eines gelben Ziegelgebäudes geführt, ich steige Treppen hinauf und gehe, durch unermesslich grosse Säle und zahllose Galerien, zwischen Schaukästen und Glasschränken voller ausgestopfter oder in Gefässen konservierter Tiere. Schliesslich ladet mich eine offene Tür in einen Saal von seltsamen Aussehen ein; er ist dämmrig und schwach von Lichtflecken erleuchtet, die von einer Menge in wohlgeordneten Schaukästen ausgestellter Münzen und Medaillen reflektiert werden. Ich bleibe vor einem mit Glas bedeckten Kasten in der Nähe eines Fensters stehen, und unter den Gold-und Silbermedaillen wird mein Blick von einer aus anderm Metall, das dunkel wie Blei ist angezogen. Es ist mein Bild, der Typus eines Frevlers und Ehrgeizigen mit hohlen Wangen, zu Berge stehendem Haar und hasserfülltem Mund. Und die Kehrseite der Medaille trägt die Devise: "Die Wahrheit ist immer rücksichtslos." O, die Wahrheit, die den Sterblichen so verborgen ist und die entschleiert zu haben ich übermütig genug war zu glauben, als ich das heilige Abendmahl verhöhnte, dessen Wunder ich jetzt bekenne. Ein gottloses Erinnerungszeichen, zur Unehre der Gottlosigkeit von lästerlichen Freunden errichtet! Es ist wahr, ich habe mich immer wegen dieser Verherrlichung der Brutalität geschämt und mich nicht darum gekümmert, dieses Erinnerungszeichen zu bewahren; ich habe es den Kindern zum Spielen hingeworfen, und es ist fortgekommen, ohne dass ich es vermisst hätte. In gleicher Weise wollte ein schicksalsschweres "Zusammentreffen", dass der Künstler der die Medaille machte, gleich danach geistesgestört wurde, nachdem er seinen Verleger betrogen und Fälschungen begangen hatte. O, diese Schmach! die nicht ausgetilgt werden kann, sondern immer im Gedächtnis bewahrt wird, da das Gesetz gebietet, dass dieses Anklage-Dokument in den Museen des Staates verwahrt wird. Da sieht man die Ehre.
Worüber habe ich mich zu beklagen, da die Vorsehung einer schimpflichen Bitte Erfüllung gewährt hat, die ich in meiner Jugend an sie richtete. Es war um mein fünfzehntes Jahr; müde der nutzlosen Kämpfe gegen das junge Fleisch, das auf Befriedigung der Leidenschaften pochte; erschöpft von den religiösen Konflikten, die meine Seele verheerten, welche lüstern war, das Rätsel des Daseins zu erfahren; in einer Umgebung frömmelnder Menschen, die mich unter dem Vorwand peinigten, meine Seele der Liebe zum Göttlichen zuneigen zu wollen, äusserte ich unumwunden folgende Worte zu einer alten Freundin, die mich zu Tode moralisiert hatte: Ich lasse die Moral fallen, wenn ich nur ein grosses Talent werden kann, das allgemein bewundert wird!—Später wurde ich in meiner Ansicht von Thomas Henry Buckle bestärkt, der uns lehrte, dass die Moral ein Nichts sei, das sie sich nicht entwickle, und dass die Intelligenz alles sei. Und mit zwanzig Jahren lernte ich von Taine, dass böse und gut zwei indifferente Sachen seien, denen unbewusste und verantwortungslose Eigenschaften innewohnten, wie die Acidität der Säure und Alkalität bei einem Alkali. Und diese Phrase, die von Georg Brandes im Fluge ergriffen und ausgearbeitet wurde, drückt ihr Gepräge von Immoralität auf die skandinavische Literatur. Ein Sophisma, das heisst, ein schwacher Vernunftschluss, der fehl geschossen hat, verführt eine Generation von freidenkenden Menschen! Eine solche Schwäche! Denn beim Analysieren von Buckels Epigramm: "Die Moral entwickelt sich nicht, also ist sie indifferent", entdeckt man leicht, dass der Schlusssatz besser so gezogen werden könnte: Die Moral, die unerschütterlich dieselbe bleibt, beweiset dadurch ihren göttlichen und ewigen Ursprung.
Als mein Wunsch endlich erhört wurde, war ich das anerkannte, bewunderte Talent und der verachtetste aller Menschen, die in diesem Jahrhundert in meinem Lande geboren sind. In den Bann getan von den besseren Kreisen, missachtet von dem Geringsten unter den Geringen, verleugnet von meinen Freunden, den Besuch meiner Bewunderer in der Nacht oder im geheimen empfangend! Ja, alle beugen sich vor der Moral, und eine Minderheit verbeugt sich vor dem Talent: das gibt uns manches zu denken über das Wesen der Moral! Und noch schlimmer ist die Kehrseite der Medaille! Die Wahrheit! Als ob ich mich nie der Lüge ergeben hätte, trotzdem ich in dem Ansehen stand wahrhaftiger, aufrichtiger als andere zu sein. Ich verweile nicht bei den kleinen Lügen der Kindheit, weil die so wenig bedeuten, hervorgegangen, wie sie meist waren, aus Furcht oder der Unfähigkeit, die Wirklichkeit von den Einbildungen zu trennen; und weil sie aufgewogen wurden von ungerechten Strafen, die auf falsche Anklagen der Kameraden erfolgten. Aber es sind andere Lügen, ernster wegen der verderblichen Folgen, die das schlechte Beispiel und das Entschuldigen einer schweren Versündigung hervorbringen. Es ist die unwahre Darstellung, die meine Selbstbiographie "Der Sohn einer Magd" über die Krisis der Pubertät gibt. Als ich dieses Jugendbekenntnis schrieb, scheint mich der liberalistische Geist der damaligen Zeit verführt zu haben, mit zu hellen Farben zu malen, in der verzeihlichen Absicht, junge Männer, die einem frühreifen Laster anheimgefallen sind, von der Furcht zu befreien.
Als ich zum Schluss dieser bitteren Reflexionen gekommen bin, schrumpft das Münzkabinett zusammen, die Medaille zieht sich in die Ferne zurück und verkleinert sich zur Grösse eines Bleiknopfes. Und ich sehe mich in einer Bodenkammer auf dem Lande, am Strande des Mälar, in einem Pensionat für Knaben bei einem Künstler, im Jahre 1861. Kinder in ungesetzlichen Verbindungen geboren, Kinder von Eltern, die aus dem Land geflohen sind, schlecht erzogene Kinder, die in zu zahlreichen Familien im Wege stehen, leben hier zusammen, in einen Bodenraum zusammengepfercht, ohne Aufsicht, zu zweien das Bett teilend, einander tyrannisierend und einander misshandelnd, um sich am Leben zu rächen, das so grausam ist. Eine hungrige Herde kleiner Missetäter, schlecht gekleidet und schlecht genährt, ein Schrecken für die Bauern und besonders für die Gärtner. Genug, der älteste in der Bande spielt die Rolle des Verführers, und das Laster nistet sich ein in die junge Schar....
Dem Fall, jawohl dem Fall, folgt unmittelbar die Gewissensqual, und ich sehe mich bei dem schwachen Schein des grauenden Sommertages im Nachthemd am Tisch sitzen, das Gebetbuch vor mir. Schamgefühl und Gewissensqual, trotzdem mir die Natur der Sünde vollständig unbekannt war. Unschuldig, weil ich unbewusst war, und doch verbrecherisch. Verführt und nachher Verführer, Reue und Rückfall, Zweifel an der Wahrhaftigkeit des anklagenden Gewissens! Zweifel, dass ein Gott gnädig ist, der die schrecklichsten Versuchungen für einen Unwissenden auslegt. Für ein Kind, das als einen von der Natur herzlich gern gebotenen Genuss hinnimmt, was das göttliche Gesetz mit dem Tode bestraft. Ohne Schuld vor sich selbst und doch von Gewissensbedenken gepeinigt, die den Unglücklichen der Religion zu jagen; die aber vergibt oder tröstet nicht, sondern verurteilt zu Wahnwitz und Hölle—den unschuldigen Wicht, das Opfer, dem die Kraft fehlt, im ungleichen Kampf mit der allmächtigen Natur stand zu halten.
Das höllische Kohlenfeuer ist angezündet, um bis ans Grab zu brennen, sei es, dass es in der Einsamkeit unter der Asche glüht oder Nahrung von den brennbaren Stoffen eines Weibes holt. Versucht man dieses Feuer durch Enthaltsamkeit zu löschen, so wird die Leidenschaft perverse Wege einschlagen und die Tugend auf unerwartete Weise bestraft werden. Begiesse den angezündeten Scheiterhaufen mit Petroleum, so bekommst du eine Vorstellung von der erlaubten Liebe!
Wahrhaftig, kommt ein Knabe und fragt mich jetzt, den Fünfzigjährigen: was soll man tun? so habe ich nur eine Antwort, nach so vielen Erfahrungen und so vielen Erörterungen und die ist:
—Ich weiss es nicht!
Und suchte mich ein junger Mann auf, um mich zu fragen, was vorzuziehen sei, unverheiratet zu bleiben oder die Ehe einzugehen, würde ich antworten: Das beruht auf Neigung und Geschmack; wenn Sie die Hölle des Junggesellen vorziehen, so wählen Sie die; gefällt Ihnen die eheliche Hölle besser, so treten Sie in diese ein. Für meine Person ziehe ich Gehenna an der Seite einer Gattin vor, weil das ein Paradies zur Folge hat, das allerdings künstlich ist aber entzückend und in dem es Erinnerungen an das goldene Zeitalter gibt: nämlich das Kind.
Ich möchte mich als Verführer der Jugend anklagen, aber kann es nicht, da der Zweck meines Bekenntnisses war, die Jünglinge von der Furcht zu befreien. Befreiung, das war die Losung für die skandinavische Literatur die ganzen achtziger Jahre. Ich befreite die Frauen, mit dem Erfolg, dass die Familienfrauen den Prostituierten gleich wurden und sich gegen ihren Befreier wandten, um ihn mit ihren zerbrochenen Ketten zu schlagen. Ich habe die Elenden und die Unterdrückten so befreit, dass die Gesellschaft von den schlimmsten Unterdrückern regiert wird, die zur Macht gekommen sind. Ich habe die Jugend von Gewissensqual und Verkehrtheit befreien wollen, und die Jugend, die in Laster und Verbrechen versunken ist, klagt mich an, ein Catilina zu sein, und Väter und Mütter haben mich auf den Index gesetzt! Also soll man das Befreien lassen, da das Leben ein Gefängnis ist; was ich nicht wusste; und das entschuldigt mich vor mir selbst, da ich in gutem Glauben und in guter Absicht gehandelt habe, um dem Vorbild des Erlösers zu folgen, der die Ehebrecherin und den Räuber frei sprach. Das einzige ist darin liegt der Hauptpunkt, dass ich die furchtbaren Gewissensqualen verleugnet habe, die den Fall eines Knaben begleiteten, und das ist mea culpa; das lässt mich erröten angesichts der Inschrift der Medaille, die ich nicht selbst besorgt habe.
Zu meinem Sohn möchte ich sagen: Versuch keusch zu bleiben, und auf alle Fälle weiche schlechten Weibern aus, denn die vergiften dich für das ganze Leben und sind besessene Unglückswesen, deren böse Geister auf eine reine Seele übergehen; das ist die Ursache, warum diese Weiber, denen man zu existieren erlaubt, weil es die tatsächlich gibt, Versuchungen ausmachen, denen widerstehen zu können sich ein junger Mann zur Ehre anrechnen muss. Und noch eins, mein Sohn, erliege nicht den Versuchungen einer verheirateten Frau, wenn sie auch deine männliche Eitelkeit reizt, indem sie dich Joseph nennt! Die Ehre gebührt nicht Potiphars Frau, sondern Joseph, dessen Ehrentitel auf den Mann übergeht, der den Mut hatte, dem Erlöser Pflegevater zu bleiben, ohne über seine für einen Mann zweideutige Stellung Unwille zu verraten.
Und an meine Töchter ein Wort, ein einziges: der Altar oder das Gelübde der Keuschheit! Das ist alles! Die freie Liebe und Rechnung der Frau hat es immer gegeben, und die freien Frauen sind Kokotten und Huren, und sie werden es bleiben, so lange die Welt steht; wie auch die ungetreue Gattin ihresgleichen werden wird, oder, richtiger, schlimmer als sie, weil sie einen Mann mordet und die Zukunft ihrer Kinder trübt.
Ich brenne vor Begierde, mich anzuklagen und mich zugleich zu verteidigen, aber es gibt kein Gericht, keine Richter, und ich verzehre mich hier in der Einsamkeit!
Als ich meine Verzweiflung nach allen Himmelsstrichen ausrief, wurde ich in ein Dunkel gehüllt, und als ich deutlicher zu sehen begann, fand ich mich mit dem Kopf gegen einen Kastanienbaum in der Fleurus-Allee lehnend. Es war der dritte Baum vom Eingang gerechnet, und die Allee hat siebenundvierzig auf jeder Seite und neun Bänke sind zwischen die Bäume als Haltepunkte gestellt. Bleiben also vierundvierzig Raststellen für mich, ehe ich die erste Station erreiche.
Einen Augenblick bleibe ich angesichts des ausgedehnten Tränenpfades ganz niedergeschlagen stehen, als sich unter den entlaubten Bäumen eine Lichtkugel nähert, die von zwei Vogelflügeln getragen wird.
Sie macht vor mir in gleicher Höhe mit meinen Augen Halt, und in dem klaren Schein, der sich um die Kugel breitet, sehe ich ein weisses Blatt Papier, das gleich einer Speisekarte verziert ist. Oben steht in rauchgefärbten Buchstaben: Iss! Und unten rollt sich in einer Sekunde mein ganzes verflossenes Leben auf, wie eine mikrographische Reproduktion auf einem ungeheuer grossen Plakat. Alles ist da zu finden! Alle Schrecken, die heimlichsten Sünden, die widerlichsten Szenen, in denen ich die Hauptrolle spiele.... Wehe, ich möchte vor Scham sterben, als ich im Bilde die Szenen sehe, die mein vergrösserndes Auge auf einmal auffasst, ohne lesen und verdolmetschen zu brauchen! Aber ich sterbe nicht, im Gegenteil, während einer Minute, die so lang ist wie achtundvierzig Jahre, sehe ich aufs neue mein ganzes Leben von der grünen Kindheit an bis auf diesen Tag. Mein Gebein verdorrt bis aufs Mark, mein Blut stockt, und vom Feuer der Gewissensqual verzehrt, falle ich mit dem Ausruf zu Boden: Gnade! Gnade! Und ich werde davon abstehen, mich vor dem Ewigen zu rechtfertigen, und ich werde davon abstehen, meinen Nächsten anzuklagen....
Als das Bewusstsein wiederkam, befand ich mich auf der Rue de Luxembourg, und bei einem Blick durch das Gittertor sah ich den Garten grünen, während ein Chor von kleinen lebhaften Spottvögeln mich hinter Buschen und Bäumen grüsst!
Die Rue Bonaparte hinuntergehend, fühle ich mich gegeisselt, und die Schmach weckt den Zorn, und die Widerspenstigkeit beginnt sich zu rühren.—Ich habe gesündigt, zugegeben, und ich bin bestraft worden. Das müsste doch genug sein, um die Zeichen auf der weissen Schiefertafel auszukratzen. Ein guter Vater kann verzeihen, nachdem er gestraft hat, und ich kenne welche, die begnadigen können, ohne Auge für Auge, Zahn für Zahn zu fordern; ich kenne welche, die nie anders strafen als durch milde Worte und nicht weiter davon sprechen, nachdem die Sache einmal ausgetragen ist. Aber ich habe nie einen gesehen, der über die Fehltritte und Versündigungen seiner Kinder Buch geführt hätte.
Der Geist des Aufruhrs erhebt sich wieder, das Gefühl menschlich-göttlicher Würde sagt: "Schwacher, du bist gefallen, du hast dich erniedrigt, als du die Selbstberechtigung deines Ichs gegenüber der der anderen verleugnet hast. Das ist gerade der Kampf des Lebens, der Versuchung sich vor den andern zu beugen zu widerstehen, denn im selben Augenblick, in dem du das tust, hast du dich richtend über den Herrn deines Schicksals gestellt und kriechend unter die andern". Wäre ich Herrscher, würde ich den Aufrührer hassen, aber ich müsste ihm grössere Achtung bezeigen als dem Gehorsamen. Seelenstärke ist schön, und das Schöne ist göttlich. Vor einem Gott, dem weisesten, schönsten und gütigsten, werde ich mich beugen, aber vor schlechten elenden Menschen, die mir gleichen, habe ich nicht das Recht die Knie zu beugen. Für grosse Geister habe ich immer Verehrung gehegt, und es ist eine Lüge, das mir die Fähigkeit zu bewundern gefehlt hat, wenn ich mich auch nicht habe zwingen können, das Kleine zu bewundern. Offen habe ich meine Verehrung ausgesprochen für Männer wie Linne, der Gott gesehen hat, für Bernardin de Saint-Pierre, für Balzac, für Swedenborg, für Nietzsche, dem die Hüftsehne und das Gehirn gelähmt wurden im Titanenkampf.... Aber ich weiss wohl, dass die Götter der Zeit mich vor allem Kleinen auf die Knie haben zwingen wollen, besonders vor allem Minderwertigen, körperlich, sittlich, geistig Schwachen. Aber ich bin nicht Tyrann gewesen, im Gegenteil, ich war mit dabei und führte die Sache der Enterbten, ich war mit dabei und kämpfte im Befreiungskrieg für die Unterdrückten, weil ich nicht verstand, dass sie sich auf dem Platz befanden, auf den sie von der Vorsehung gestellt waren. Ob es geschah, um mir die Folgen dieses Sklavenkrieges zu zeigen, weiss ich nicht, aber immer gab das Schicksal mich einer Sklavenseele in die Hand, die mein Herr wurde, die mich unter ihre Holzschuhe oder ihre Knopfstiefel trat; immer musste ich Stroh und Ziegel tragen für einen rohen ägyptischen Mann, oder für ein Weib, das von meinem Blute lebte und mir das, was übrig blieb, zu meiner Nahrung gab. Schliesslich, weise durch die Lehren geworden, machte ich mich frei aus den Gefängnissen, und da blieb mir nur die Freiheit der Wüste, wo mir wahrhaftig kein Manna und keine Wachteln geboten wurden. Zur Einsamkeit wurde ich verurteilt, und jedesmal wenn ich einen Menschen suchte, um mit ihm zu sprechen, wurde ein ägyptischer Mann gesandt, um mich anzuspucken; ein Unwissender, um mich darüber aufzuklären, wie viel kenntnisreicher der Ignorant sei; ein hoffärtiger Unfähiger, um mir zu sagen, dass ich der Hoffärtigste sei; ein Liederlicher, um mir Tugend zu predigen!—Wer verfolgt mich, wer demütigt mich mehr, als die andern gedemütigt werden? Ist es der Weise, so weiss er, dass ich nicht hochmütig war, und dass ich im Namen dessen stolz war, dessen Sprachrohr ich zu sein glaubte; und er kennt wohl die Bosheit der Menschen, die, wie ich mich auch drehe und wende, bereit sind, etwas gegen mich zu haben. Sage ich, das ich aus mir selbst spreche, so bin ich des Hochmuts schuldig; sage ich, dass ich das Meine von Gott habe, so bin ich der Lästerung schuldig.—Sind alle Menschen gleich, warum hat dann die Vorsehung Gesellschaftsklassen mit einer Rangordnung eingerichtet, wo der eine es besser hat als der andere und Untergebenen befehlen darf, die menschlicher Obrigkeit untertänig sein müssen? Warum werden einige zu Macht-und Ehrenstellen berufen, während andere verurteilt werden, sich andächtig, bewundernd, gehorchend unten zu halten? Ist das Gleichheit, und deutet das darauf, dass alle gleich geschaffen sind? Nein, ich kann weder in der Ordnung der Natur, wo das Rassepferd Namen und Titel, Stammbaum und Bedienung hat, aus Marmorkrippen frist und Alpaka trägt, während der elende Gaul den Strassenkehricht ziehen muss, ein Gesetz des Gleichgewichts sehen, noch in der Gesellschaftsordnung, wo selbst der Geselle seinen Lehrjungen zum Hundsfottieren unter sich hat. Und doch soll ich gezwungen werden, ganz gegen göttliche und menschliche Ordnung, eine Tatsache anzuerkennen, die jeden Augenblick am Tage widerlegt wird, eine Tatsache, die überhaupt nicht existiert! Ist Gott mit sich selbst entzweit oder sind seine Satrapen in Streit geraten? Ist jede Zeitperiode hier eine Anspielung von dem, was da oben vor sich geht? Ist dort auch Parteibildung mit Demokraten-Agitoren und Herrschlüsternen? So will es zuweilen scheinen, denn viele Stimmen sprechen auf einmal: Der Volksführer hört ein Gottesgebot aus den Wolken und er führt die Massen mit heiligem Eifer zu Mord und Brand, und es ist glückt ihm zuweilen, als stehe er unter einem mächtigen Schutz. Ein andermal führt der Volksvergeuder und-bezwinger seine geweihten Scharen unter Anrufung des himmlischen Schutzes gegen die Massen, und sein Vorhaben wird mit Erfolg gekrönt, als ob andere Mächte ihn zum Sieg geleitet hätten! Wehe den Menschenkindern, wenn die Herrscher und Gewalten uneinig geworden sind! Da gilt es, fein zu hören, wenn die Stimmen der Unsichtbaren Gehorsam gebieten, und den richtigen Weg zu wissen, denn der Sieger hat immer recht. Ist es Ragnarök, das bevorsteht oder schon da ist? Kämpfen nicht alle erwachten Göttermächte über den Wolken um die Herrschaft? Pan war ja eine Zeit oben und schien zu herrschen; Jehova hat ja sein auserwähltes Volk beschützt, und Christus hat seine Getreuen nicht verlassen; Allah hat kürzlich die Olympischen bei den Termopylen schlagen können; Buddha drängt sich vor mit einer Gewalt, die den Nazarener einen Augenblick ernstlich bedrohte! Wehe den Menschenkindern, wenn die Mächte kämpfen! Alle rufen sie zu dem Einzigen und Wahren Gott, aber keiner sagt mir, wer er ist! Ist er es, der mit dem Donner und dem Wirbelwind spielt? Aber die bewegten Zeus und Tor auch, und die Theosophen schwören, dass die Unsichtbaren in Hochasien mit diesen Naturmächten zu spielen verstehen, wie Jehova, Osirispriester und Zauberer es vermocht haben sollen. Alle verlangen Zeichen und Wunder, und es geschehen Zeichen und Wunder, aber niemand weiss, wer sie zustande bringt, denn die schwarzen Mächte sind ebenso zauberkundig wie die weissen. Wer ist der Herr, der so mächtig zu den Völkern spricht in diesen Zeiten? Oder wer ist mein Herr? Hat eine Menschenameise nicht das Recht, zu erfahren, wem sie dienen und gehorchen soll, und wie, ehe sie verworfen wird als ungehorsam? Wie oft habe ich nicht den Unbekannten angerufen, deutlicher zu sprechen, und als er schliesslich antwortete, geschah es mit einem Sonnenstrahl, einem Donnerschlag, einem Wassertropfen. Der Herr der Naturkräfte! Gut, ich erkenne ihn an, aber er war es nicht, der mit einen neuen Sinn geben und mich von Begierden, Hass und Hochmut reinigen sollte....
So mahlt und mahlt die ewige Sündenmühle; dieselben Anklagen, dieselben Verteidigungen. Sisyphus, der seinen Stein rollt, die Danaïden, die mit ihrem Sieb schöpfen: wahrhaftig, scheinen nicht die Strafen ewige zu sein!
Als ich in meine Zelle zurückkehre, finde ich, dass die Uhr erst neun ist, und öffne die Bibel, um Aufklärung und Ruhe zu finden. Als ich aber in den Psalmen Davids zu den grauenhaften Flüchen komme, die er mit Gebeten auf seine Feinde herabruft, kann ich nicht länger dabei sein: ich habe nur einen Feind, das bin ich; die andern, die mich quälen, haben ein Recht dazu, und es ist immer zu meinem Besten gewesen, und ich habe eben gelernt, das man seinen Feinden verzeihen soll: die Theosophen haben mir sogar gesagt, dass das Gebet schwarze Magie ist, dass Böses über Feinde erbitten envoütment ist d. h. Verhexungen, die mit dem Scheiterhaufen bestraft wurden! Mein alter Freund Hiob tröstet mich nicht mehr, denn ich bin teils kein gerechter Mann, wie bekannt, teils finde ich seine Kritik über des Ewigen Handlungsweise ebenso gottlos wie meine aufrührerischen Reden und Gedanken.
Da werfe ich mich auf das Neue Testament und stosse auf Paulus, der gleich mir ein Saulus gewesen ist und mir deshalb viel zu sagen haben müsste. Gewisse meiner Fehler finde ich bei ihm wieder, aber nicht darum habe ich ihn aufgesucht; und ich verstehe noch nicht, wie man den Mut haben kann, Strafpredigten zu halten und zum Satan zu verurteilen, wenn man mit beiden Beinen im Sündenpfuhl steht. Sein Eifer macht ihn kindlich und deshalb momentan sympathisch, so, wenn er einen Korintherbrief mit dem Bekenntnis beginnt: "Ich, Paul, der Euch verächtlich scheint, wenn ich Euch nahe bin, aber der voll von Kühnheit ist, wenn ich weit von Euch bin." Ich kann auf die Worte dieses Mannes nicht lauschen, als seien sie von Gott gekommen, da er alle meine Schwächen hat, die ich mit seiner Hilfe fortarbeiten wollte. Wie soll ich die Demut bewahren, wenn mein Lehrer zwei lange Briefe voll Prahlerei über sich schreibt. "Ich erachte, dass ich in nichts den ausgezeichnetsten Aposteln unterlegen gewesen bin." Oder: "Niemand betrachte mich als einen Törichten; wenn doch, so habe Geduld mit meinem Unverstand, dass ich mich auch ein wenig rühme." Und dann zählt er seine Leiden auf (ganz wie ich, obwohl ich schliesslich eingesehen habe, dass meine Leiden wohl verdient waren). "Ich habe mehr des Tages Last getragen als die andern, mehr Wunden, mehr Gefängnis. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen vierzig Streiche weniger eins; gestäupt dreimal; gesteinigt wurde ich einmal usw."
Da finde ich meine Schosssünden wieder und, was schlimmer ist, deren Verteidigung. "Ich bin töricht gewesen, da ich mich rühmte, aber Ihr habt mich dazu gezwungen, denn es stand Euch an, Gutes von mir zu reden, da ich, wie bekannt, in keinem Punkt den höchsten Aposteln unterlegen gewesen bin, wiewohl ich nichts bin." Die letzten Worte offenbaren das unsinnig Falsche in dieser gepriesenen Demut, mit welcher der Hochmut prahlt; und das entzündete in mir von neuem den Unwillen, den ich schon in meiner Jugend gegen diesen Propheten der Reiseprediger hegte, dessen Stil sie so gut nachzuahmen verstanden. Und ich verliess den Schüler, um vom Meister selbst Worte der Weisheit zu hören. Aber ich weiss nicht, welcher Dämon an diesem Abend, da ich allein und zerknirscht bin, die Blätter wendet, vielleicht das Gesicht verkehrt, so dass das Buch, das Antwort auf alles und Heilung für alles hat, mich nur täuscht und mir ins Angesicht schlägt. Als ich lese, wie Christus die Ehebrecherin freispricht, fühle ich die bodenlosen Zweifel wieder aufsteigen von den Toten. Es war 1872, als ich in meinem Jugenddrama "Meister Olof" den Reformator die Hure, Magdalena, mit ungefähr denselben Worten freisprechen liess. Was folgte darauf? Dieser Katarakt von Freisprechungen, und zwar von allen moralischen Verpflichtungen, der durch die Literatur über die Gesellschaft strömte und alles aufgelöst hat, Familie, Sitte, Ehre, Glauben. Und diese Befreiung, die auf edler Humanität fusste und Christi Gebot "richte nicht" gehorchte, die wird nun von "den Mächten" desavouiert, indem sie die Befreier mit Schrecken und neuen Plagen schlagen! Christi Nachfolger! Nein, nicht einmal die Bibel, nicht Christus, nicht Humanität——nichts.
Ich bin jetzt vollständig bankerott! Des Umgangs mit der Menschen beraubt, ohne zu wissen, warum; des Interesses für die Wissenschaften verlustig, die mich früher am Leben hielten durch das Grosse, das darin liegt, die Rätsel zu erfahren; dem Trost der Religion entzogen, weil sie Böses und Falsches lehrt, habe ich nur die leere Schale eines inhaltslosen Ichs vor mir. In meinem Stuhl sitzend, den Sternenhimmel durch das Gitter meiner Fensterluke betrachtend, denke ich an nichts, empfinde nichts, träume nichts. Fange schliesslich an neugierig zu werden, wie meine Stimme klingen wird, wenn ich sie wieder nach dreiwochenlangem Schweigen hören werde. Verlange so nach der Gesellschaft eines Menschen, dass ich die antipathischesten aufsuche könnte, die nur den Mund zu öffnen brauchen, um mich zu verletzen. Erwäge, ob diese Isolierung den Zweck haben soll, mich zu lehren, dass alle Menschen einander nötig haben, obwohl ich weiss, dass schlechte Gesellschaft zu meiden ist und dass manche Menschen eher meiner bedurft hätten, als ich ihrer. Als ich auf die Uhr sehe, ist es nicht weiter als halb zehn, und vor zehn wage ich nicht zu Bett zu gehen, weil die Nacht unruhig wird. Ich, der mein ganzes Leben darauf gewartet habe, dass das Gewünschte kommen werde, warte jetzt darauf, dass eine halbe Stunde verfliessen soll. Lesen kann ich nicht, denn wenn ich ein Buch öffne, glaube ich alles vorher zu wissen. Nichts interessiert mich, nichts erfreut mich, nichts schmerzt mich. Ich habe mehr als tausend Francs in der Tasche, aber sie sind ohne Wert, denn ich wünsche nichts. Früher und immer, wenn mir Geld fehlte, hatte ich vollauf an Wünschen: Bücher, Instrumente, Bezahlung von Schulden; und dieses Verlangen gab dem Leben Interesse, richtete den Willen auf die Zukunft, verankerte ohne zu vertäuen.
Schliesslich wird die Uhr zehn. Nach meiner gewöhnlichen Waschung gehe ich zu Bett und falle bald in Schlaf, müde bis zum Tod von lauter Beschäftigungslosigkeit und Langeweile.
Der folgende Tag ist gleich dem vorhergehenden bis sechs Uhr nachmittags. Da klopft es an meine Tür, und herein tritt der amerikanische Maler, den ich in meinem Buch "Inferno" mit Francis Schlatter identisch gemacht habe. Da wir ganz indifferent ohne Feindschaft oder Freundschaft geschieden sind, ist das Wiedersehen recht herzlich. Der Mann ist etwas verändert, merke ich. Er scheint mir körperlich kleiner zu sein, als ich ihn im Gedächtnis hatte; sein Ausdruck ist ernster, und ich kann ihn nicht dazu bringen, wie früher über die Plackereien des Lebens und über die ausgestandenen Leiden zu lächeln, die man so leicht trägt, wenn sie glücklich vorüber sind. Aber er behandelt mich auch mit einer auffallenden Achtung, die gegen die frühere Kameradschaftlichkeit absticht. Das Wiedersehen für mich wird eine Aufrüttelung, denn teils kann ich mit einem Menschen sprechen, der jedes Wort versteht, das ich sage, teils knüpfe ich an eine Periode meines Lebens an, in der ich mich auf das stärkste entwickelte, intensiv lebte, glaubte und wuchs. Ich fühle mich bald zwei Jahre jünger und bekomme Lust, eine halbe Nacht auf den Trottoiren beim Glas und gutem Gespräch zuzubringen. Als wir überein gekommen sind, in Montmartre zu Mittag zu essen, treten wird die Wanderung an. Der Lärm der Strasse dämpft etwas den Gang des Gespräches, und ich bemerke bei mir eine ungewöhnliche Schwierigkeit zu hören und aufzufassen.
Am Einlauf in die Avenue de l'Opéra ist der Volksstrom so stark, dass wir unaufhörlich von Begegnenden getrennt werden. Da trifft es sich auch, dass ein Mann, der eine Partie Watte trägt, meinen Kameraden so anstösst, dass er ganz weiss wird. Den Kopf voll von Swedenborgs Symbolik, suche ich im Gedächtnis, was das "bedeuten" soll, kann mich aber nur von der Graböffnung auf St. Helena erinnern, dass Napoleon aussah, als ob sein Körper von weissem Flaum umlaufen sei.
Auf der Rue de la Chaussée d'Antin bin ich schon so müde, dass wir beschliessen, eine Droschke zu nehmen. Da es Dinerzeit ist, ist die Strasse äusserst belebt, und als wir einige Minuten gefahren sind, steht der Wagen plötzlich still. Zugleich bekomme ich einen solchen Stoss in den Rücken, dass ich mich erhebe, fühle ein warmes feuchtes Schnaufen über meinem Nacken, und als ich mich umwende, habe ich die drei weissen Pferdeköpfe, einen Omnibus mit einem schreienden Kutscher vor mir. Das verstimmt mich, und ich frage mich, ob das eine Warnung sein soll.
Wir steigen an der Place Pigalle aus und dinieren. Hier finde ich Erinnerungen an meinen ersten Pariser Aufenthalt wieder, der in den siebziger Jahren stattfand; aber sie machen mich wehmütig, denn die Veränderungen sind gross. Mein Hotel an der Rou Douai ist nicht mehr. Der "Chat noir", der damals entstand, ist geschlossen, und Rudolphe Salis ist in diesem Jahr begraben. Das Café de l'Ermitage ist bloss eine Erinnerung, und das "Tambourin" hat Namen und Titel geändert. Die Freunde von damals sind tot, verheiratet, zerstreut, und die Schweden sind nach Montparnasse übergesiedelt. Da merke ich, dass ich alt geworden bin.
Das Diner wird nicht so lebhaft, wie ich erwartet habe. Der Wein ist von dieser schlechten Sorte, die verstimmt. Da ich nicht mehr daran gewöhnt bin, zu hören und zu sprechen, wird das Gespräch stockend und ermüdend. Die Hoffnung, die alte Stimmung beim Kaffee auf dem Trottoir wieder zu finden, verwirklicht sich nicht, und bald stellt sich dieses furchtbare Schweigen ein, das verkündet, dass man sich trennen möchte.
Lange kämpfen wir gegen die wachsende Verlegenheit, aber vergebens. Bereits um neun Uhr brechen wir auf, und meine Gemütsverfassung ahnend, geht der Kamerad seinen eigenen Weg, in dem er eine Zusammenkunft vorschützt. Allein, empfinde ich sofort eine unbeschreibliche Erleichterung; die Unlust hört auf, der Kopfschmerz verschwindet und es ist, als ob die Windungen im Gehirn und das Flechtwerk der Nerven mit denen eines andern verwickelt gewesen wären, aber jetzt anfingen sich zu entwirren. Wahrhaftig, die Einsamkeit hat mein Persönlichkeit so empfindsam gemacht, dass ich nicht den Kontakt des Fluidums eines Fremden ertrage. Ruhig, aber mit einer Illusion weniger, kehre ich nach Hause zurück, froh, wieder in meiner Zelle zu sein; aber glücklich darin, merke ich, dass das Zimmer sich unähnlich ist, nicht mehr dasselbe, dass eine Unlust sich dort häuslich niedergelassen hat. Möbel und Kleinigkeiten haben ihre Plätze behalten, machen aber einen fremden Eindruck: es ist jemand da gewesen und hat etwas hinterlassen. Ich fühle mich nicht wohl.
Am nächsten Tage merke ich bereits die Veränderung, und ich muss hinaus, um Gesellschaft zu suchen, finde aber keine. Am dritten Tage gehe ich nach Übereinkunft zu meinem Freund, dem Künstler, um seine Radierungen zu besehen. Er wohnt in Marais. Ich frage den Torhüter, ob er zu Hause ist. Ja, aber er sitzt unten im Café mit seiner Dame. Da ich seiner Dame nichts zu sagen hatte, gehe ich wieder.
Am folgenden Tage lenke ich die Schritte wieder nach Marais, und da der Mann zu Hause ist, beginne ich die sechs Treppen zu steigen. Als ich drei überwunden habe, die sich eng wie Turmtreppen in einer Röhre schlängeln, erwacht eine Erinnerung an einen Traum und eine Wirklichkeit. Der Traum, der oft wiederkehrt, handelt von einer solchen schraubenden, drängenden Treppe, in der ich krieche, bis ich ersticke, da sie immer enger wird. Das erste Mal kam mir mein Traum wieder im Turm zu Putbus, und ich kehrte sogleich nach unten zurück. Jetzt stehe ich hier, beklommen, keuchend, mit klopfendem Herzen, doch beschliesse ich zu steigen. Und ich schraube mich hinauf, komme ins Atelier und treffe den Freund mit seiner Dame. Als ich aber fünf Minuten gesessen habe, habe ich einen Schmerz tief im Kopfe und sage:
—Mein guter Freund, es sieht aus, als ob ich nicht mit Ihnen verkehren dürfte, denn Ihre Treppen töten mich. Ich habe jetzt den bestimmten Eindruck: steige ich noch einmal hier herauf, so sterbe ich.
—Aber Sie sind ja neulich den Montmartre und die Treppen zu Sacré-Coeur hinaufgestiegen.
—Ja, es ist wunderbar.
—Nun, wandte er ein, dann komme ich zu Ihnen, und wir essen abends zusammen.
Am Tage darauf essen wir wirklich zusammen und kommen in eine gute Stimmung, die man bei Tische sucht. Man behandelt einander mit Achtung, vermeidet es, Unannehmlichkeiten zu sagen, entdeckt Sympathien, stellt sich auf des andern Standpunkt und hat die Illusion, in allen Fragen einig zu sein. Nach dem Essen, da der Abend mild ist, setzen wir das Gespräch fort und ziehen über den Fluss auf die Boulevards, Trottoir und Tisch wechselnd, bis wir schliesslich die Höhe am Café du Cardinal erreicht haben. Da ist es Mitternacht, aber wir sind noch lange nicht müde, und nun beginnen diese wunderbaren Stunden, da die Seele sich aus ihrer Hülle löst und die Seelenkräfte, die zu Träumen gewandt werden sollten, in wachen und klaren Konzeptionen, geschärften Blicken in Vergangenheit und Zukunft verbraucht werden. Während dieser Nachtstunden ist es, als halte sich mein Geist über und ausserhalb meines Körpers, der wie ein für mich fremde Person dasitzt. Das Trinken ist Nebensache und nur dazu da, den Schlaf fern zu halten, vielleicht die Schleussen des Gedächtnisses zu öffnen, die mein ganzes grosses Lebensmaterial herauslassen, so dass ich in jedem Augenblick Tatsachen, Jahreszahlen, Szenen, Rede und Gegenrede daraus schöpfen kann. Das ist die Freude und das Machtgefühl des Rausches für mich, aber ein Okkultist, ein religiöser, hat mir auch gesagt, dass es Sünde sei, denn man nehme einen Vorschuss auf die Seligkeit, die gerade in der Befreiung der Seele von der Materie bestehe; deshalb werde auch dieser Übergriff mit den schrecklichen Qualen bestraft, die am andern Tage folgen und an die Unseligkeit erinnern sollen.
Man fängt an, uns mit Symptomen der Schliessung zu beunruhigen, und da ich noch nicht schliessen will, nenne ich das Wort Baratte, und mein Freund ist sofort bereit.
Café Baratte bei den Hallen hat für mich immer eine wunderbare Anziehungskraft gehabt, ohne dass ich weiss warum. Es kann die Nähe der Hallen sein, die zieht. Wenn es auf dem Boulevard Nacht ist, ist es bei den Hallen Morgen, wo es übrigens die ganze Nacht Morgen ist. Die triste Nacht mit ihrer erzwungenen Beschäftigungslosigkeit und ihren dunklen Träumen gibt es dort nicht. Der Geist, der sich an unmateriellen Welten berauscht hat, verlangt nach Essen und Schmutz, Laster und Lärm hinab. Auf mich wirkt dieser Geruch von Fisch, Fleisch, Gemüse, in deren Abfall man tritt, als ein herrlicher Kontrast gegen die hohen Themata, die man soeben behandelt hat. Das ist der Moder, aus dem wir geschaffen sind und täglich dreimal neugeschaffen werden; und wenn man von Halbdunkel, Schmutz und schäbigen Gestalten in das gemütliche Café tritt, wird man von Licht, Wärme, Gesang, Mandolinen und Gitarren begrüsst. Da sitzen Huren und ihresgleichen, doch zu dieser Stunde ist jeder Klassenunterschied ausgetilgt. Und hier sitzen Künstler, Studenten, Schriftsteller durcheinander, kneipen an langen Tischen und träumen wachend; oder haben sie den traurigen Schlaf geflohen, der vielleicht aufgehört hat sie zu besuchen? Es ist keine sprühende Freude, sondern eine stille Narkose ruht über dem ganzen; und für mich ist es, als trete ich in das Reich der Schatten, wo das gespensterhafte Leben nur halbe Wirklichkeit hat. Ich kenne einen Schriftsteller, der nachts dort zu sitzen und zu schreiben pflegte. Ich habe Fremde dort gesehen, die gekleidet waren, als kämen sie von einem glänzenden Souper aus dem Parc Monceau. Habe einen Mann aus dem Publikum mit dem Aussehen eines fremden Gesandten aufstehen und ein Solo singen sehen. Habe Leute, die verkleideten Prinzen und Prinzessinnen glichen, Champagner trinken sehen. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob es wirkliche Sterbliche sind, alle diese Schatten, oder ob es "Astralleiber" Schlafender sind, die sich draussen befinden und die Schlaftrunkenen, die da sitzen, halluzinieren. Das Merkwürdige ist, dass kein grober Ton die Gesellschaft beherrscht, die in das enge Lokal gepfercht ist: die Schwermut der Schlaflosigkeit dämpft und gibt allem, was geschieht, eine gewisse melancholische Farbe. Die Lieder der Sänger sind meist sentimental, und die melancholische Gitarre heilt die Nadelstiche, mit denen die scharfe stahlsaitige Mandoline die Gehirnmuskeln sticht....
Gerade jetzt erinnere ich mich einer Nacht vor zwei Jahren, als ich mit demselben Freunde hier im Café war. Wir hatten über die verborgenen Fähigkeiten der Seele gesprochen, und ich leugnete aus manchen Gründen die Rolle des Grosshirns als Gedankenmaschine. "Es ist ja ein Darm oder eine Drüse, das können Sie doch sehen!"—"Glauben Sie das nicht! Kommen Sie, wir wollen vor die Tür gehen und uns eins kaufen!"—Wir gingen in die Hallen hinunter und verlangten ein Gehirn. Man wies uns durch Korridore und Gewölbe in einen Keller. Schliesslich befanden wir uns in einem Saal, der mit blutigen Körpern und Eingeweiden dekoriert war. Wir wateten durch Blut und gelangten an den Raum für Gehirne. Blutige Männer mit blutigen Keulen und Stemmeisen schlugen abgehauene Tierköpfe so, dass der Schädel brach und das Gehirn herausflog. Wir kauften eins und gingen hinauf ans Licht, aber die grausige Szenerie folgte uns bis zum Tisch des Cafés, wo die vermeintliche Gedankenmaschine demonstriert wurde.
Jetzt in der Nacht, nach meiner langen Einsamkeitskur, fühle ich mich wohl unter der Menschenmenge, es strömt Wärme und Sympathie von ihr aus. Zum ersten Mal seit langem werde ich von einem sentimentalen Mitleid mit diesen unglücklichen Weibern der Nacht er fasst. Und neben unserm Tisch sitzen ein halbes Dutzend allein, niedergeschlagen, ohne etwas Bestelltes vor sich zu haben. Sie sind fast alle hässlich, verschmäht, und wahrscheinlich ausser stande, sich etwas zu bestellen. Ich schlage meinem Freund, der ebenso uninteressierte Absichten hat wie ich, vor, zwei einzuladen, von den hässlichsten, die neben uns sitzen. Angenommen! Und ich lade zwei ein, indem ich frage, ob sie etwas trinken wollen, und, hinzufüge: aber ohne irgend welche Illusionen sonst, und vor allem anständig.
Sie scheinen ihre Rolle zu verstehen und bitten zuerst um Essen. Der Freund und ich setzen unser philosophisches Gespräch auf Deutsch fort, dann und wann ein Wort an unsere Damen richtend, die nicht anspruchsvoll sind und mehr auf Essen erpicht scheinen als auf Aufwartung.
Einen Augenblick trifft mich der Gedanke: Wenn ein Bekannter dich jetzt sähe? Ja, dann weiss ich, was er sagen würde, und ich weiss auch, was ich antworten würde.—Ihr habt mich aus der Gesellschaft verstossen, mich zur Einsamkeit verurteilt, und ich bin genötigt, die Gesellschaft von Menschen zu kaufen, von Parias, hinausgeworfen wie ich, hungrig wie ich gewesen bin. Meine einfache Freude ist, diese Verschmähten prahlen zu sehen mit einer Eroberung, die keine ist, sie essen und trinken zu sehen, ihre Stimmen zu hören, die doch die von Frauen gewesen sind.... Und die ich in keiner Form bezahlt habe, nicht einmal damit, dass ich als Zugabe Moral gebe.
Ich empfinde nur ein Wohlbehagen, mit menschlichen Wesen zusammen zu sitzen und vom Überfluss des Augenblicks geben zu können, des Augenblicks, denn in einem Monat kann ich so arm sein wie sie....
Es ist Morgen geworden; die Uhr zeigt fünf, und wir gehen; aber da fordert meine Dame fünfzehn Francs dafür, dass sie mir Gesellschaft geleistet hat; was ich von ihrem Gesichtspunkt aus erklärlich finde; denn meine Gesellschaft ist wertlos ebenso wie mein Schutz ihrer Polizei gegenüber. Dass das meine Selbstachtung erhöhen wird, glaube ich nicht, eher das Gegenteil.
Doch wandere ich nach Haus mit gutem Gewissen, nach einer wohlverbrachten Nacht, schlafe bis zehn Uhr, erwache ausgeruht und verbringe den Tag mit Arbeit und Betrachtungen. Aber die Nacht darauf bekam ich einen Anfall der schrecklichen Art, wie sie Swedenborg in seinen "Träumen" schildert. Das war also die Strafe. Wofür? "Dass er isst und trinkt mit Huren und Zöllnern, während Johannes in die Wüste ging...." Mit Huren weil er keine andere Gesellschaft findet.... Ich verstehe nichts mehr; hatte geglaubt, es sei eine neue Lektion in der Lebensart, ich solle lernen, dass alle Menschen gleich gut seien; und hatte mir wirklich einen Augenblick eingebildet, meine Rolle im Nachtcafé sei mehr die des Menschenfreundes als des Ausschweifers gewesen, mindestens aber moralisch indifferent.
Die folgenden Tage bin ich sehr beklommen, und eines Abends sah ich einer Schreckensnacht entgegen. Um neun Uhr hatte ich Ciceros "Natura Deorum" vor mir und wurde so eingenommen von Aristoteles' Ansicht, die Götter kennten unsere Welt nicht und würden sich verunreinigen, wenn sie sich mit diesem Schmutz befassten, dass ich sie abzuschreiben beschloss. Dabei merke ich, dass Blut auf der oberen Seite der rechten Hand ausgebrochen ist, ohne irgend welche Ursache. Und als ich das Blut abtrocknete, fand sich kein Zeichen einer Schramme. Doch ich entschlug mich des Gedankens und ging zu Bett. Um halb eins erwachte ich mit dem voll ausgebildeten Symptom, das ich den elektrischen Gürtel genannt habe. Ungeachtet ich dessen Natur und innere Bedeutung kenne, werde ich sogleich gezwungen, die Ursache ausser mir zu suchen; denke, nun sind sie hier! Sie! Wer? Nahm mich dann zusammen und zündete die Lampe an. Da die Bibel daneben lag, beschloss ich sie um Rat zu fragen, und siehe, sie antwortete:
"Ich werde dich verstehend machen, und ich werde dir den Weg zeigen, den du gehen musst, und mein Auge wird dir folgen. Sie nicht wie ein Pferd oder Maultier, das da mit Zaum und Trense gerissen werden muss, um zu Gehorsam gebracht zu werden!"
Das war Bescheid und ich schlafe wieder, ruhig, dass es nicht böse Menschen sind, sondern eine wohlwollende Macht, die zu mir spricht, wenn auch etwas undeutlich.
Nachdem ich mich mit einigen Tagen Einsamkeit beruhigt hatte, ging ich eines Abends wieder aus, mit dem Amerikaner und einem jungen Franzosen, der meine Manuskripte berichtigt. Es wurde etwas langwierig, und ich kam kurz vor Mitternacht nach Haus, mit schlechtem Gewissen, weil ich, in eine hitzige Konversation hineingezogen, genötigt gewesen war, von einem Abwesenden Böses zu sagen. Was ich sagte, war eine Selbstverteidigung gegen einen Lügner und zwar volle Wahrheit. Um zwei Uhr erwachte ich und hörte einen Menschen im Zimmer über mir poltern; dann, wie er die Treppen hinunter in das Zimmer, das neben meinem liegt hineinging. Also dasselbe Manöver wie im Hotel Orfila. Bin ich denn bewacht? Denn wer besetzt sonst zwei Zimmer in dem Hotel, wo ich wohne, eins über mir, eins an meiner Seite? Dieselbe Geschichte hatte sich ja im September hier im Hotel wiederholt, als ich drei Treppen hoch wohnte. Es kann kein Zufall sein. Wenn nun, was wahrscheinlich ist, mein unsichtbarer Mentor mich strafen will, wie raffiniert ist es, mich in Ungewissheit zu halten, ob es Menschen sind, die mich verfolgen oder nicht. Obwohl ich volle Gewissheit gehabt habe, dass niemand mich verfolgt, so muss ich gleichwohl in den alten Gedankenkreis, dass es jemand tut, gepeinigt werden. Und als die Frage, wer ist es, aufsteigt, beginnt der Reigen von Vermutungen, bis mein Gewissen ihn aufhält. Das klagt mich an auch da, wo ich nur in reiner Selbstverteidigung gehandelt habe, indem ich ungerechte Beschuldigungen von mir abschüttele. Ich glaube mit dem Rücken an einen Pfahl gebunden zu sein, alle Vorbeigehenden haben das Recht, mich ungestraft anzuspucken, wenn ich aber wieder sie spucke, werde ich gestäupt, erstickt, von Furien gejagt. Die ganze Welt, auch der geringste Elende, hat mir gegenüber recht! Wenn ich nur wüsste warum! Die ganze Taktik erinnert so an Frauen, dass ich meinen Argwohn nicht lassen kann. Wenn nämlich eine Frau jahrelang einem Manne Schaden und Unrecht getan hat, ohne dass er aus angeborenem Edelmut die Hand zur Gegenwehr erhob, und er schliesslich um sich schlägt, wie man eine Fliege wegjagt, das macht sie ein Geschrei, ruft die Polizei und lamentiert: "Er verteidigt sich!" Oder wenn in der Schule ein unvernünftiger Lehrer einen unschuldig angeklagten Schüler überfällt, und dieser sich aus gekränktem Rechtsgefühl zu verteidigen sucht, was tut das der Lehrer? Er geht zur Körperstrafe über, indem er ausruft: "So, du antwortest."
Ich habe geantwortet und darum werde ich gepeinigt! Und die Pein geht nun acht Tage lang jede Nacht vor sich. Die Folgen davon sind, dass ich meine gute Laune verliere, und dass der Verkehr mit mir eine Plage wird. Mein Freund der Amerikaner ermüdet, zieht sich langsam zurück, und als er einen Haushalt zu Hause etabliert hat, befinde ich mich wieder allein. Aber es ist nicht ausschliesslich ein gegenseitiger Überdruss, der uns zum zweiten Mal getrennt hat; wir haben nämlich beide bemerkt, dass während unsers letzten Zusammenseins wunderliche Dinge geschehen sind; die können nur dem Einschreiten bewusster Mächte zugeschrieben werden, welche die Absicht gehabt haben, unsern Überdruss zu wecken. Dieser Mann, der fast nichts von meinem früheren Leben weiss, schien das letzte Mal die Absicht gehabt zu haben, mich an allen empfindlichen Punkten zu verletzen; es war, als habe er die geheimsten meiner Gedanken und Absichten gekannt, die doch nur ich kenne. Und als ich ihm diese meine Beobachtung sagte, ging ihm ein Licht auf.
—Ist das nicht der Böse! rief er aus. Ich ahnte, dass es etwas war, denn Sie konnten an dem Abend nicht den Mund öffnen, ohne mich auf das tiefste zu kränken, aber ich sah in Ihrem ruhigen Gesicht und dem freundlichen Ausdruck, dass Sie nichts Böses im Sinn hatten.
Wir versuchten zu trotzen. Aber drei Tage hinter einander ging er den langen Weg zu mir vergebens. Ich war nicht da, und auch nicht in meinem gewöhnlichen Restaurant, nirgends!
Und so schliess sich die Einsamkeit wieder um mich wie ein dichtes Dunkel. Es geht auf Weihnachten und das Entbehren von Heim und Familie bedrückt mich. Das ganze Leben wird widrig und ich beginne wieder ganz folgerichtig nach dem zu blicken, was von oben ist. Kaufe "Christi Nachfolge" und lese.
Es ist nicht das erste Mal, dass dieses wunderbare Buch mich trifft, aber dieses mal findet es den Boden bereitet. Lebend zu sterben von der Welt der verächtlichen, langweiligen, schmutzigen, das ist das Thema. Und der unbekannte Verfasser hat die ungewöhnliche Eigenschaft, nicht zu predigen oder zu strafen, sondern er spricht freundlich, überzeugend, logisch bindend und lockend. Er gibt unsern Leiden die Farbe, als seien sie nicht Strafen, sondern Prüfungen, und damit weckt er den Ehrgeiz, sie gut bestehen zu können.
Nun habe ich Jesus wieder, dieses Mal nicht Christus, und er schleicht sich bei mir ein, langsam aber sicher, als ob er auf Sammetsandalen komme. Und die Weihnachtsausstellungen auf der Rue Bonaparte helfen dazu. Da ist das Christuskind in der Krippe, das Jesuskind mit Königsmantel und Krone, das Kind auf dem Arm der Jungfrau, das Kind spielend, liegend, am Kreuz! Gut das Kind! Das verstehe ich. Der Gott, der so lange die Klagen der Menschen über das Elend des Erdenlebens gehört hat, dass er schliesslich beschloss niederzusteigen, sich geboren werden zu lassen und zu leben, um zu prüfen wie schwer es ist, sich mit einem Menschenleben zu schleppen. Den begreife ich.
Am Morgen eines Sonnabends ging ich an der Kirche St-Germain L'Auxerrois vorbei. Dieses Gebäude hat immer eine starke Ausstrahlung auf mich ausgebt, weil es so intim aussieht; die Vorhalle mit ihren Malereien ladet ein, und die Masse sind so klein, dass man nicht erdrückt wird oder verschwindet. In der Tür begegne ich Halbdämmerung und Orgelspiel, farbigen Bildern und Kerzen. Immer wenn ich in eine katholische Kirche trete, bleibe ich an der Tür stehen und fühle mich verlegen, unruhig, ausgestossen. Wenn der riesengrosse Schweizer sich mit seiner Hellebarde nähert, bekomme ich ein schlechtes Gewissen und meine, er will mich als Ketzer hinaus treiben. Hier in Saint-Germain L'Auxerrois fühle ich eine Angst, denn das Gedächtnis sagt mir, dass es in diesem Turm war, wo in der Bartholomäusnacht die Glocke ohne bekannte Ursache um zwei Uhr zu läuten anfing. (Um zwei Uhr nachts!) Heute beunruhigt mich meine Stellung als Hugenotte mehr als sonst, denn vor einigen Monaten las ich im Osservatore Romano einen Glückwunsch, den die katholische Priesterschaft an die Judenverfolger in Russland und Ungarn richtete, und einen hochgestimmten Vergleich mit den grossen Tagen, die auf die Bartholomäusnacht folgten und die der Verfasser bald zurückwünschte.
Die Orgel, unsichtbar, spielt Töne, Harmonien, die ich noch nie gehört habe, die mir aber vorkommen wie Erinnerungen; Erinnerungen an die Zeiten der Vorfahren oder an noch entferntere Tage. Wo hat der Komponist die her bekommen? frage ich mich immer, wenn ich grosse Musik höre. Aus der Natur und dem Leben nicht, denn hier gibt es keine Vorbilder, wie in den andern Künsten. Da habe ich keinen andern Ausweg, als mir seine Musik wie eine Erinnerung an einen Zustand zu denken, nach dem sich jeder Mensch in seinen besten Augenblicken zurücksehnt; und im Gefühl des Vermissens selbst muss ja ein dunkles Bewusstsein von etwas Vermissten liegen, das man früher besessen hat.
Sechs Lichter sind am Altar angezündet: der Priester in Weiss, Rot und Gold spricht nicht, aber seine Hand flattert, mit den graziösen Bewegungen eines Schmetterlings über einem Buch. Hinten treten zwei weissgekleidete Kinder vor und beugen die Knie. Es läutet eine kleine Glocke. Der Priester wäscht sich die Hände und bereitet eine Handlung, die mir unbekannt ist. Es geschieht etwas Seltsames, Schönes, Hohes da vorn in der Ferne zwischen Gold, Rauch und Licht ... ich verstehe nichts, aber fühle eine unerklärliche Ehrfurcht und ein unerklärliches Beben, und ein Gefühl schlägt in mich nieder; das hast du schon erlebt und mitgelebt....
Dann aber kommt das Schamgefühl des Heiden, des Ausgestossenen, der hier nicht zum Hause gehört. Und dann steht die ganze Wahrheit klar da: der Protestant hat keine Religion, denn der Protestantismus ist Freidenkertum, Empörung, Sonderung, Dogmatik, Theologie, Ketzerei. Und der Protestant ist in den Bann getan. Es ist der Bann, der Fluch, der über uns ruht und uns unbefriedigt, trist, irrend macht. Und in diesem Augenblick fühle ich den Bann, und ich verstehe warum der Sieger bei Lützen "in seinem Werke fiel" und warum seine eigene Tochter ihn dementierte; verstehe warum das protestantische Deutschland verheert wurde, während Österreich unberührt blieb. Und was wurde für uns gewonnen? Die Freiheit, ausgestossen zu sein, die Freiheit, uns zu sondern und abzusondern, um als konfessionslos zu enden.
Wogend bewegt sich die Gemeinde zu den Türen hinaus, und einsam bleibe ich zurück, indem ich, wie ich glaube, deren missbilligende Blicke ertrage. Es ist dunkel an der Tür, wo ich stehe, aber ich sehe, wie alle das Wasser im Weihkessel berühren und sich bekreuzigen, ehe sie hinausgehen; und da ich gerade davorstehe, sieht es aus, als ob sich alle vor mir bekreuzigen, und ich weiss, was das bedeutet, seit ich in Österreich Leute, die mir auf der Landstrasse entgegenkamen, das Kreuz vor dem Protestanten, der ich war, schlugen.
Als ich schliesslich allein bleibe, nähere ich mich dem Weihwasserbecken aus Neugier oder einem andern Grunde. Es ist aus gelbem Marmor in Form einer Muschelschale, und darüber ist ein Kinderkopf ... mit Flügeln hinten. Und das Gesicht des Kindes ist lebend, von einem Ausdruck verklärt, den man nur bei guten, schönen, wohlerzogenen Dreijährigen sieht. Der Mund steht offen, und die Mundwinkel halten ein Lächeln zurück. Die grossen herrlichen Augen sind niedergeschlagen, und man sieht, wie sich der kleine Schelm im Wasser spiegelt, aber unter dem Schutz der Augenlider, als sei er sich bewusst, etwas Ungesetzliches zu tun, ohne jedoch vor dem Strafer bange zu sein, den er, wie er weiss, mit einem einzigen Blick entwaffnen kann. Das ist das Kind, das noch das Gepräge von unserm fernen Ursprung trägt, einen Schimmer vom Übermenschen, das dem Himmel angehört. Man kann also im Himmel lächeln, und nicht nur das Kreuz tragen! Wie oft in den Augenblicken meiner Selbstanklage, wenn die ewigen Strafen wie objektive Wirklichkeiten vor mir stehen, habe ich nicht diese Frage aufgestellt, die mancher unehrerbietig finden wird: Kann Gott lächeln? lächeln zu der Torheit und dem Übermut der Menschenameisen? Kann er das, dann kann er auch verzeihen.
Das Kindergesicht lächelt mir zu und sieht mich durch das Augenlid an, und der geöffnete Mund sagt neckend: Versuch es, das Wasser ist nicht gefährlich!
Und ich berühre mit zwei Fingern das geweihte Wasser, es geht ein Kräuseln über die Fläche wie—ich glaube, es war im Teiche Bethseda—und nun führe ich den Finger von der Stirn nach dem Herzen und dann von links nach rechts, wie ich es meine Tochter habe tun sehen. Aber im nächsten Augenblick bin ich heraus aus der Kirche—denn der Kleine lachte, und ich—schämte mich, will ich nicht sagen, aber ich wünschte am liebsten, niemand hätte es gesehen.
Draussen an der Kirchentür steht ein Anschlag über etwas, und daraus werde ich belehrt, dass heute Advent ist! Draussen vor der Kirche sitzt in der schrecklichen Kälte eine Alte und schläft. Ich lege leise eine Silbermünze in ihren Schoss, ohne dass sie es merkt, und obwohl ich gern ihr Erwachen gesehen hätte, gehe ich. Welche billige und solide Freude, die Zwischenhand der Vorsehung bei der Erhöhung einer Bitte zu spielen, und einmal geben zu dürfen, wenn man so lange empfangen hat.
Jetzt lese ich "L'Imitation" und Chateaubriand, "Le Génie du Christianisme". Ich habe das Kreuz auf mich genommen und trage eine Medaille, die ich auf Sacre-Coeur in Montmartre bekommen habe. Aber das Kreuz für mich ist das Symbol der geduldig ertragenen Leiden, nicht das Wahrzeichen, dass Christus an meiner Stelle gelitten hat, denn das muss ich schon selbst besorgen. Ich habe sogar eine Theorie aufgestellt: da wir Ungläubigen nicht mehr von Christus sprechen hören wollten, überliess er uns uns selbst, eine satisfactio vicaria hörte auf, und wir mussten uns allein mit unserm Elend und unserm Schuldgefühl schleppen. Swedenborg sagt ausdrücklich, dass Christi Leiden am Kreuz nicht sein Versöhnungswerk war, sondern eine Prüfung, die der Gott sich auferlegt hatte, weniger die eines Schmerzes als die einer Schmach.
Gleichzeitig mit "Christi Nachfolge" bekomme ich Schwedenborgs "Vera Religio Christiana" in die Hand, in zwei starken Bänden. Mit seiner Allmacht, die jedem Widerstand trotzt, schleppt er mich in seine Riesenmühle und fängt an mich zu mahlen. Zuerst lege ich das Buch fort und sage: Das ist nicht für mich. Aber ich nehme es wieder, denn es ist so viel darin, was mit meinen Beobachtungen und Erlebnissen stimmt und so viel weltliche Weisheit, die mich interessiert. Zum zweiten Mal werfe ich es weg; bekomme aber keine Ruhe, ehe ich es wieder vorgenommen habe, und das Schreckliche der Situation ist, wenn ich lese erhalte ich den bestimmten Eindruck: das ist die Wahrheit, aber ich kann nie dahin kommen! Nie! denn ich will nicht.—Dann fange ich an, mich zu empören und sage mir: er hat sich getäuscht, und dies ist der Geist der Lüge. Dann aber kommt die Furcht, dass ich mich geirrt habe.
Was finde ich denn hier, das das lebendige Wort sein soll? Ich finde die ganze Ordnung der Gnade und die ewige Hölle: die Kindheitserinnerungen an die Hölle der Kindheit mit ihrem ewigen Unfrieden! Aber nun habe ich den Kopf in die Schlinge eingesteckt, und ich bin gefangen. Den ganzen Tag, die halbe Nacht spielen meine Gedanken um dieses eine: ich bin verdammt, denn ich kann unter anderm das Wort Jesu nicht aussprechen, ohne Christus hinzuzufügen, der nach Swedenborg das Schibboleth sein soll, das die Teufel verrät.
Nun habe ich den ganzen Abgrund in mir, und der milde Christus in "L'Imitation" ist der Dämon geworden, der Peiniger! Ich fühle lebhaft, wenn dieses sich weiter entwickelt, werde ich Pietist, aber das will ich nicht! Will nicht!
Drei Tage sind vergangen, seit ich Swedenborg fortgelegt habe, aber eines Abends, als ich mich mit Pflanzenphysiologie beschäftige, erinnere ich mich, etwas besonders Sinnreiches über die Stellung der Pflanze in der Schöpfungskette gerade in "Vera Religio Christiana" gesehen zu haben. Vorsichtig beginne ich nach der berühmten Stelle zu suchen, finde sie aber nicht; dagegen finde ich alles andere: Die Berufung, die Erleuchtung, die Heiligung, die Bekehrung, und wie ich die Blätter wende und die Seiten zu überfliegen suche, bleibt das Auge auf den grausigsten Stellen haften, die stechen und brennen. Zweimal suche ich die beiden Bände durch, aber das Gesuchte ist verschwunden. Es ist ein verzaubertes Buch, und ich möchte es verbrennen, wage es aber nicht, weil die Nacht bevorsteht und die Uhr zwei werden kann.... Ich fühle, wie ich Heuchler werde, und ich habe in mir beschlossen, morgen, wenn ich nur diese Nacht in Frieden schlafen darf, einen Kampf gegen diesen Seelenverderber aufzunehmen; ich werde seine eigenen Schwächen mit dem Mikroskop besichtigen, ich werde seine Stacheln aus dem Herzen ausreissen, wenn es auch dabei zerrissen werden sollte, und ich will vergessen, dass er mich von dem einen Irrenhaus gerettet hat—um mich in das andere zu bringen!
Nachdem ich die Nacht geschlafen habe, obwohl ich erwartet habe, erschlagen zu werden, ging ich am folgenden Morgen ans Werk, nicht ohne Skrupel, denn die Waffen zu ergreifen gegen einen Freund, ist die betrübendste von allen Unternehmungen. Aber es muss geschehen; es handelt sich um meine unsterbliche Seele, ob sie vernichtet werden soll oder nicht.
So lange Swedenborg in "Arcana" und der "Apokalypse" sich an Offenbarungen, Prophezeiungen, Auslegungen hielt, da machte er mich religiös, aber wenn er in "Vera Religio" anfängt über die Dogmen zu räsonieren, dann ist er Freidenker, Protestant, und zieht er blank mit der Vernunft, dann hat er die Waffen selbst gewählt, und schlechte Waffen. Ich will die Religion haben als eine stille Begleitung zu der eintönigen Alltagsmelodie des Lebens, aber hier handelt es sich um Berufsreligion, Kathederdisputation, also um Machtkampf.
Ich hatte schon beim Lesen von "Apokalypsis revelata" eine Stelle gefunden, die mich abstiess, weil sie eine menschliche Eitelkeit verriet, die ich bei einem Gottesmann nicht sehen möchte. Aber ich ging aus Rücksicht daran vorbei, jedoch nicht ohne sie zu notieren. Im Himmel trifft Swedenborg einen englischen König und beklagt sich ihm gegenüber, dass englische Zeitschriften es nicht geruht hätten, seine Schriften anzukündigen. Swedenborg drückte seinen Verdruss besonders über einige Bischöfe und Lords aus, die seine Schriften angenommen, aber ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Der König (Georg II.) war erstaunt und wandte sich zu den Unwürdigen, indem er sagte: "Gehet eure Wege! Wehe dem, der so gefühllos bleiben kann, wenn er etwas vom Himmel und dem ewigen Leben hört." Hier will ich als mir unsympathisch anmerken, dass sowohl Dante wie Swedenborg ihre Feinde und Freunde in die Hölle schicken, während sie selbst die Höhen besteigen. Darf ich mir wie Paulus ein kleines Selbstlob erlauben, so ist der Augenblick gekommen, daran zu erinnern, dass ich mich im Gegensatz zu den hohen Meistern allein mitten in die Gluthaufen des Inferno gesetzt habe und die andern wenigstens über mich ins Fegefeuer.
In "Vera Religio" ist die Sache noch unangenehmer, denn dort trifft man Calvin in einem Bordell, weil er gelehrt hat, dass der Glaube alles ist und die Werke nichts (vgl. den Räuber am Kreuz!). Luther und Melanchthon, ungeachtet ihres Protestantismus, sind rohem Hohn und albernen Possen ausgesetzt.... Nein, es regt mich auf, diese Flecke in dem Bilde eines erhabenen Geistes aufzusuchen. Und ich hoffe, es ist Swedenborg in seiner geistigen Entwicklung ergangen, wie es nach seinen Worten Luther ergangen sein soll: "Als dieser in die Geisterwelt eintrat, machte er starke Propaganda für seine Dogmen, aber weil diese nicht im innersten Wesen seines Geistes eingewurzelt, sondern nur von Kindheit an eingesogen waren, ging ihm bald eine grössere Klarheit auf, so dass er schliesslich des neuen Himmelsglaubens teilhaftig wurde."
Ist mein Lehrer zornig, dass ich dies geschrieben habe? Ich kann es nicht glauben; vielleicht teilt er meine Meinungen jetzt, und hat erfahren, dass dort oben nicht Theologie disputiert wird. So wie er das Leben in der Geisterwelt geschildert hat, mit Kathedern und Auditorien, Opponenten und Respondenten, hat er mich zu der lästerlichen Frage verleitet: Ist Gott Theolog?
Ich hatte nun Swedenborg eingeschlossen, von ihm Abschied genommen, mit Dankbarkeit, als von dem, der mich, wenn auch mit Schreckbildern, wie ein Kind zu Gott zurück gescheucht hat. Und siehe, der Schwarze Christus plagt mich nicht mehr mit Unseligkeit, sondern der Weisse, das Kind das lächeln und spielen kann, nähert sich mit dem Advent; damit findet sich ein gewisser froherer Blick aufs Leben ein, so lange ich nämlich wache über meine Handlungen, Worte und sogar Gedanken, die, wie es scheint, nicht geheim gehalten werden können vor dem unbekannten Schutzengel und Strafengel, der mir überall folgt.
Rätselhafte Begebenheiten treffen immer noch ein, aber nicht mehr so drohend wie früher. Swedenborgs Christentum habe ich verlassen, wie es hasserfüllt, rachgierig, kleinlich, sklavisch war, aber ich behalte "L'Imitation" mit gewissen Vorbehalten, und eine stille Kompromissreligion ist auf diesen unseligen Zustand gefolgt, der das Suchen nach Jesus begleitet. Ich sitze eines Abends und diniere mit einem jungen französischen Poeten, der soeben "Inferno" gelesen hat und vom okkultistischen Gesichtspunkt aus Erklärungen suchen will für die ausgestandenen Attacken, denen ich ausgesetzt war.
—Haben Sie keinen Talisman? fragte er. Sie müssen einen Talisman haben.
—Ich habe "L'Imitation"! antwortete ich. Er sah mich an, und ich nahm, etwas verlegen, da ich eben desertiert war meine Uhr hervor, um mich mit etwas zu beschäftigen zu können. Im selben Augenblick fiel die Medaille von Sacré-Coeur mit dem Christusbild von der Kette. Ich wurde noch verlegener, sagte aber nichts.
Wir standen bald auf und gingen nach einem Café beim Châtelet, um ein Glas Bier zu trinken. Der Saal ist geräumig, und wir nahmen an einem Tisch, der Tür gegenüber, Platz. Dort sassen wir eine Weile, und das Gespräch drehte sich um Christus und seine Bedeutung.
—Er hat sicher nicht für uns gelitten, sagte ich, denn hätte er das, würden sich unsere Leiden ja vermindert haben. Aber das haben sie nicht getan, sondern sind noch ebenso intensiv.
Jetzt macht ein Kellner Lärm, und mit einem Besen und Sägespänen fängt er an den Boden zwischen uns und der Tür zu fegen, wo kein Mensch hingetreten hat, seit wir gekommen sind. Auf dem weissen Parkettboden sieht man einen Kranz von roten Tropfen; und während der Kellner kehrt, murmelt er und betrachtet uns mit scheelen Augen als die Schuldigen. Ich frage meinen Begleiter, was es ist.
—Es ist etwas Rotes.
—Dann haben wir es getan, denn niemand hat den Platz nach uns betreten, und als wir eintraten, war er rein.
—Nein, antwortete der Kamerad, wir haben es nicht getan, denn es ist keine Fussspur, sondern als habe jemand geblutet; und wir bluten ja nicht.
Das war unheimlich, und auch unangenehm, weil unsere Personen sich die Aufmerksamkeit der andern Gäste auf unangenehme störende Weise zuzogen.
Der Poet las meine Gedanken, doch er hatte nicht das Abenteuer mit der Medaille gesehen. Deshalb, und um mein Herz zu erleichtern, schloss ich:
—Christus verfolgt mich.
Er antwortete nicht, obwohl er gerne eine natürliche Erklärung gesucht hätte, die er nicht finden konnte.
Ehe ich meinen Freund, den Amerikaner verlasse, den ich zum Versuch mit dem Therapeuten Francis Schlatter identifiziert habe, muss ich einige Züge erzählen, die den Argwohn bestärken, dass dieser Mann einen "double" hatte.
Als ich die Bekanntschaft mit ihm jetzt wieder anknüpfte, sagte ich ihm alle meine Meinungen rund heraus, und zeigte ihm das Heft der Revue Spirite, in dem der Artikel "mein Freund H—" stand. Er schien unschlüssig, aber mehr skeptisch.
Nach einigen Tagen, als er zum Diner kam, war er ganz verwirrt, und er erzählte mit einer gewissen Bewegung, seine Geliebte sei verschwunden, ohne Abschied genommen zu haben und ohne eine Nachricht zu hinterlassen.
Sie blieb einige Tage fort und kam dann wieder. Als er ein Verhör anstellte, bekannte sie schliesslich, sie fürchte sich vor ihrem Herrn, dem sie den Haushalt führte. Nach weiteren Fragen erfuhr er: als sie in der Nacht aufwachte, während er schlief, war sein Gesicht kalkweiss und unkennlich; was sie auf unbeschreibliche Weise erschreckte.
Übrigens wagte er sich nie vor Mitternacht zu legen, denn dann wurde er geplagt, als sei er auf einen Bratspiess aufgespiesst, der ihn drehte und drehte, bis er das Bett verlassen musste.
Als er "Inferno" gelesen hatte, sagte er:
—Sie haben nicht Verfolgungsmanie gehabt, sondern Sie sind verfolgt worden, jedoch nicht von Menschen.
Von meinen erzählten Erfahrungen geweckt, begann er in seiner Erinnerung zu suchen und brachte unerklärliche Begebenheiten aus seinem Leben der letzten Jahre hervor. So gab es einen gewissen Fleck auf dem Pont Saint-Michel; auf dem wurde er durch ein Ziehen in einem Bein zurückgehalten, und das zwang ihn, stehen zu bleiben. Das kehrte regelmässig wieder, und er hatte die Sache von Freunden bezeugen lassen. Er hatte auch einige andere Eigentümlichkeiten bemerkt und hatte "bestraft" zu sagen gelernt.
—Wenn ich raucht, werde ich bestraft, und wenn ich Absinth trinke, werde ich bestraft. Eines Abends, als wir uns getroffen hatten, aber die Mittagsstunde noch nicht gekommen war, gingen wir in das Café de la Fregate an der Rue du Bac. In lebhaftem Gespräch nahmen wir den ersten besten Platz und verlangten Absinth. Das Gespräch ging weiter, aber mitten darin stockte mein Kamerad, sah sich um und rief aus:
—Haben Sie eine solche Sammlung Banditen gesehen? Das sind ja alles Verbrechertypen. Und als ich mich umsah, wurde ich bestürzt, denn es war nicht das gewöhnliche Publikum des Ortes, sondern eine Schar zusammengerafften Gesindels, von denen die meisten verkleidet aussahen und Grimassen schnitten. Aus Mangel an Platz hatte mein Kamerad als Lehne eine Eisensäule bekommen, die wie aus seinem Rücken aufstieg und in der Höhe seines Halses einen Wulst wie ein Halsband bildete.
—Und Sie sitzen am Schandpfahl! rief ich aus.
Alle schienen uns jetzt zu betrachten; wir wurden unlustig, beklommen und standen auf, ohne auszutrinken.
Das war das letzte Mal, dass ich mit dem Kameraden Absinth trank. Doch ich machte einen späteren Versuch allein, aber ich erneuerte ihn nicht. Meinen Genossen zum Diner erwartend, setzte ich mich auf das Trottoir am Boulevard Saint-Germain Cluny gegenüber und bestellte einen Absinth. Sofort langten drei Figuren an, ich weiss nicht von wo, und stellten sich vor mich. Zwei Kerle mit zerrissenen Kleidern und mit Schmutz bespritzt, als ob sie aus den Kloaken gezogen wären, und neben ihnen ein Weib, barhäuptig mit struppigem Haar, mit Spuren von Schönheit, berauscht, schmutzig; und alle betrachteten mich mit höhnischen Blicken, frech, cynisch, als ob sie mich kennten und erwarteten, an meinen Tisch geladen zu werden. Ich habe nie solche Typen in Paris oder Berlin gesehen, vielleicht nur an der Mündung von London Bridge, wo das Publikum wirklich ein okkultes Aussehen hat. Ich denke meine Zuschauer zu ermüden und zünde Zigaretten an, aber es gelingt nicht. Da trifft mich der Gedanke: das sind nicht "richtige" Menschen, das sind Halbvisionen; ich erinnere mich an meine früheren Abenteuer von der Brasserie des Lilas und stehe auf—seitdem habe ich nicht mehr gewagt Absinth anzurühren.
Eins scheint mir sicher zu sein unter all meinem Schwanken, und das ist, dass ein Unsichtbarer Hand an meine Erziehung gelegt hat, denn es ist nicht die Logik der Begebenheiten, die hier spielt. Es ist nämlich nicht logisch, dass Schornsteinbrand ausbricht, oder sonst nicht vorhandene Gestalten vortreten, wen ich Absinth trinke; gewöhnliche Schicksalslogik wäre ja, dass ich krank würde. Logisch ist auch nicht, dass ich in der Nacht aus dem Bett genommen werden, wenn ich am Tage von einem Menschen etwas Böses gesagt habe. Aber es verrät sich in allen diesen Handlungen eine bewusste, denkende, allwissende Absicht mit gutem Endzweck, der zu gehorchen mir gleichwohl so schwer wird, hauptsächlich weil ich so schlechte Erfahrungen über Güte und Uneigennützigkeit von Absichten gemacht habe. Es hat sich indessen ein ganzes Signalsystem ausgebildet, das ich zu verstehen anfange, und dessen Richtigkeit ich geprüft habe.
So habe ich mich sechs Wochen lang nicht mit Chemie beschäftigt, und das Zimmer war nicht durch Hausrauch belästigt. Eines Morgens nahm ich zur Probe meine Goldapparate hervor und richtete die Bäder an. Sofort füllte sich das Zimmer mit Rauch; er stieg vom Boden auf, hinter dem Kaminspiegel, überall. Als ich den Wirt rief, erklärte er das unbegreiflich, weil es Steinkohlenrauch sei und man Steinkohlen im ganzen Hause nicht benutze. Also soll ich mich nicht mit Goldmacherei beschäftigen!
Die Holzharmonika, die ich oben erwähnt habe, bedeutet Frieden, das habe ich gemerkt, denn wenn sie fort ist, entsteht Unruhe.
Eine wimmernde Kinderstimme, die man oft im Schornsteinrohr hört, und die nicht natürlich erklärt werden kann, bedeutet: Du sollst fleissig sein; und daneben: Du sollst dieses Buch schreiben und dich nicht mit anderen Dingen beschäftigen.
Wenn ich in Gedanken, Worten oder Schrift aufrührerisch bin oder mich ungebührlichen Stoffen nähere, höre ich einen groben Basston wie aus einer Orgel oder aus dem Rüssel eines Elefanten, wenn er trompetet und böse ist.
Zwei Beweise, dass dieses nicht subjektive Wahrnehmungen bei mir sind, will ich anführen.
Wir dinierten am Bastilleplatz, der Amerikaner, der französische Poet und ich. Das Gespräch hatte sich einige Stunden um Kunst und Literatur gedreht, als beim Dessert der Amerikaner in das Junggesellenbereich hinüber glitt. Sofort hörte man in der Wand das Trompeten des Elefanten. Ich tat so, als höre ich nichts, aber meine Begleiter gaben darauf acht und wechselten unter einer gewissen Verstimmung den Gesprächsstoff.
Ein anderes Mal frühstückte ich mit einem Schweden, und in einem ganz andern Lokal. Er sprach gleichfalls gegen Ende des Desserts, über Huysmans "Là bas" und wollte die schwarze Messe schildern. Im selben Augenblick trompetet es, aber dieses Mal mitten im Saale, der menschenleer war.
—Was war das? unterbrach er sich.
Ich antwortete nicht; und er setzte die unheimliche Schilderung fort.
Es trompetet noch einmal, und zwar so heftig, dass der Erzähler stecken blieb, erst ein Weinglas umgoss und dann die ganze Sahnenkanne über seine Kleider leerte. Jetzt liess er das Thema fallen, das mich quälte.
Wie der Leser wahrscheinlich durchschaut hat, ist diese zweite Abteilung "Jacob Ringt" ein Versuch, in sinnbildlicher Schilderung den religiösen Kampf des Verfassers zu zeichnen, und als solcher misslungen. Deshalb ist er ein Fragment geblieben und hat sich wie alle religiösen Krisen in ein Chaos aufgelöst. Daraus scheint hervorzugehen, dass das Forschen in den Geheimnissen der Vorsehung wie alles Himmelstürmende mit Verwirrung getroffen wird, und dass jeder Versuch, auf dem Weg des Räsonnements sich der Religion zu nähern, zu Absurditäten führt. Die Ursache ist wohl, dass die Religion wie die Wissenschaften mit Axiomen beginnt, welche die Eigenschaft haben, nicht bewiesen werden zu brauchen, und nicht bewiesen werden können; wenn man doch die selbstverständlichen notwendigen Voraussetzungen zu beweisen sucht, gerät man ins Sinnlose hinein.
Als der Verfasser 1894 prinzipiell seine Skepsis verliess, die alles intellektuelle Leben zu verwüsten gedroht hatte, und sich experimentierend auf den Standpunkt eines Gläubigen zustellen begann, erschloss sich ihm das neue Seelenleben, das in "Inferno" und diesen "Legenden" geschildert ist. Im Lauf der Sache, als der Verfasser allen Widerstand eingestellt hatte, sah er sich von Einflüssen, Kräften überfallen, die ihn in Stücke zu zerreisen drohten; und auf dem Weg zu ertrinken, griff er schliesslich nach einigen leichteren Gegenständen, die ihn schwimmend erhalten konnten; aber auch diese begannen zu weichen, und es war nur eine Frage der Zeit, wann er zu grunde gehen würde. In solchen Augenblicken wird der Strohhalm für das Auge des Erschreckten zu einem Baumstamm, und dann hebt der hervorgezwungene Glaube den Gesunkenen aus der Woge, so dass er auf dem Wasser gehen kann. Credo quia absurdum, ich glaube, weil das Ungereimte, das aus dem Räsonnement hervorgegangen ist, mich aufklärt, dass ich dabei war, eine Axiom zu beweisen. Und damit ist die Anknüpfung zu dem obigen gemacht.
Ein französischer Schriftsteller schrieb in den 80er Jahren ein Buch gegen die Jesuiten, und in diesem Buch fand ich neulich diesen Satz: "Im Jahr 1867 sagte ich in einem Revueartikel "Der providentielle Atheismus" voraus, dass Gott sich jetzt verbergen werde, um die Menschen zu zwingen, ihn desto eifriger aufzusuchen."
Im Jahr 1867! Das ist wie zu Haus bei uns, wo um dieses Jahr alle religiöse Erörterung unter den Gebildeten aufhörte und Gott aus der Literatur verschwand. Wenn er nun wieder kommt, sind wir nicht sicher, dass er derselbe ist wie früher, wenn er wie alles andere wächst und sich entwickelt. Ist er auch strenger geworden, muss er doch den Agnostikern und den Forschern in dem Verborgenen verzeihen, dass sie ihn nicht fanden, weil er fort war oder nicht empfing.
Lund, 23. April 1898.
Der Verfasser.
Inferno.
1. Die Hand des Unsichtbaren
2. Der heilige Ludwig
3. Die Versuchungen des Teufels
4. Das wiedergefundene Paradies
5. Der Fall und das verlorene Paradies
6. Das Fegefeuer
7. Auszug aus meinem Tagebuch, 1896
8. Die Hölle
9. Beatrice
10. Swedenborg
11. Tagebuch eines Verdammten
12. Der Ewige hat gesprochen
13. Die entfesselte Hölle
14. Wallfahrt und Sühne
15. Der Erlöser
16. Trübsal
17. Wohin gehen wir?
Legenden.
Erster Teil
1. Der besessene Teufelsbeschwörer
2. Die Trostlosigkeit breitet sich aus
3. Erziehung
4. Wunder
5. Meines kleingläubigen Freundes Drangsale
6. Allerlei
7. Strahlung und Ausdehnung der Seele
8. Studien in Swedenborg
9. Canossa
10. Der Geist des Widerspruchs
11. Auszug aus meinem Tagebuch, 1897
12. In Paris
Zweiter Teil
JAKOB RINGT
End of the Project Gutenberg EBook of Inferno Legenden, by August Strindberg
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK INFERNO LEGENDEN ***
***** This file should be named 45916-h.htm or 45916-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/5/9/1/45916/
Produced by Marc D'Hooghe at http://www.freeliterature.org
(Images generously made available by the Internet Archive.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation information page at www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at 809
North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email
contact links and up to date contact information can be found at the
Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For forty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.